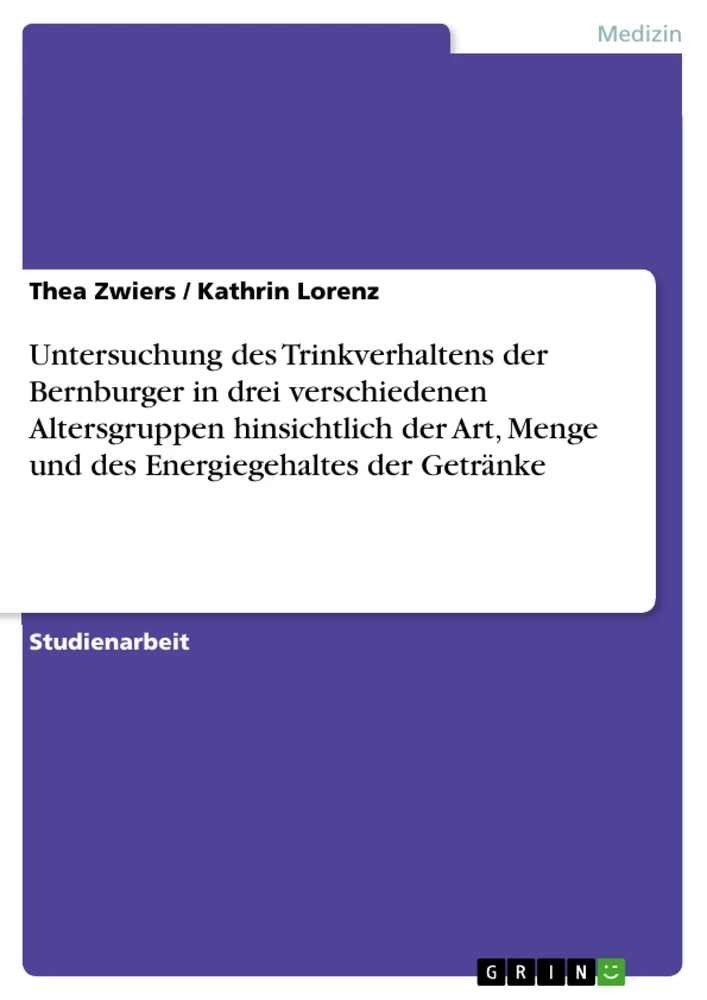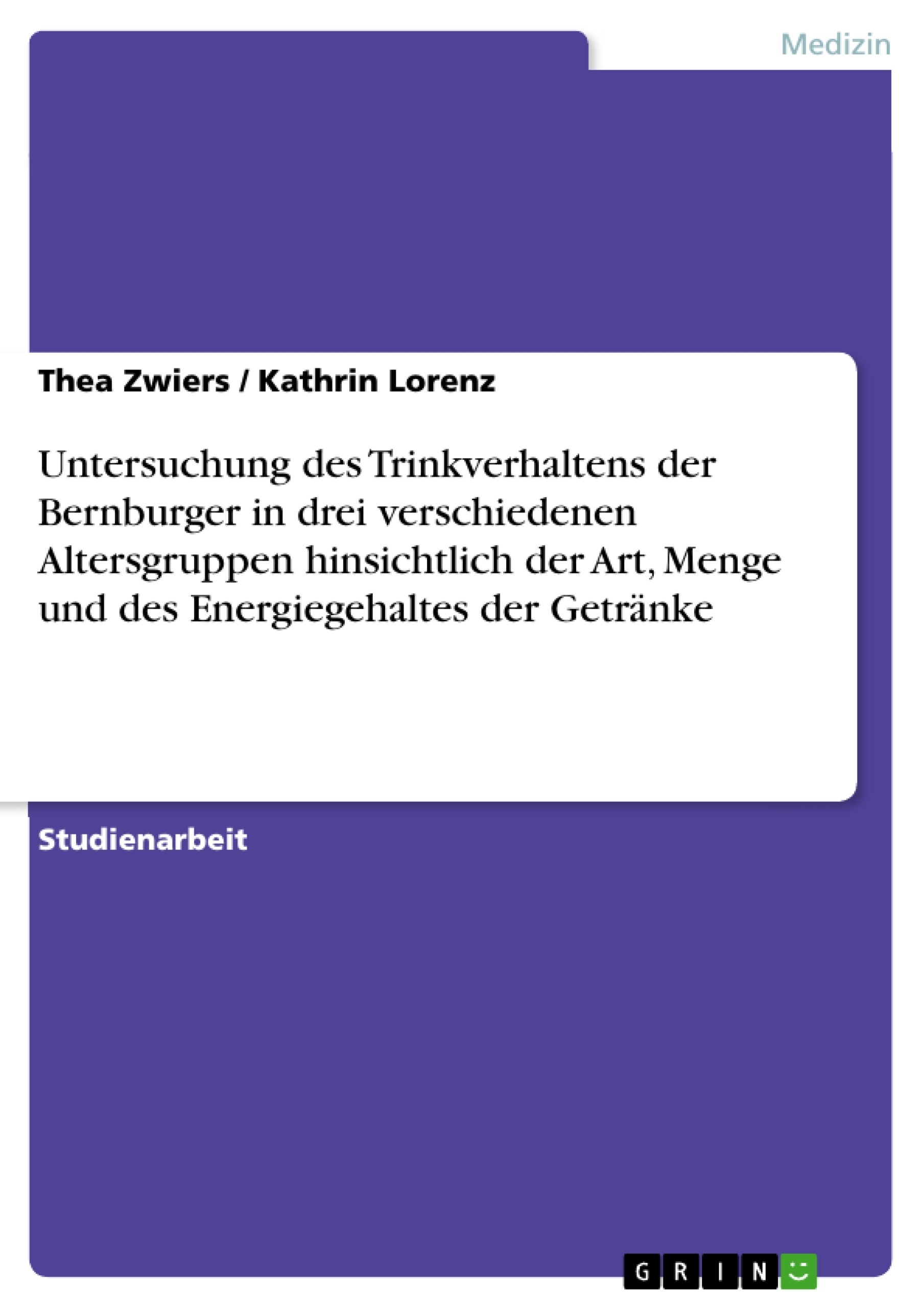Der Großteil der deutschen Bevölkerung trinkt zu wenig und erreicht somit nicht die von Ernährungswissenschaftlern empfohlene tägliche Flüssigkeitszufuhr. Vor allem bei Kindern und älteren Menschen kommt es häufig zu einer unzureichenden Flüssigkeitszufuhr, da bei diesen Bevölkerungsgruppen das Durstempfinden nicht so stark ausgeprägt ist bzw. im Alter nachlässt. Ein weiteres Problem stellen bei den älteren Menschen die Unannehmlichkeiten beim Wasserlassen bzw. Inkontinenz dar. Auch aus diesen Gründen kommt es zu einer unzureichenden Flüssigkeitszufuhr im Alter. Folgen dieses Flüssigkeitsmangels sind Einschränkungen sowohl in der körperlichen als auch in der geistigen Leistungsfähigkeit. So kommt es u.a. zu Kopfschmerzen, aber auch eine Verminderung der Konzentrationsfähigkeit und der Aufmerksamkeit kann einsetzen.
Nicht nur die unzureichende Flüssigkeitszufuhr in Deutschland ist problematisch, sondern auch, dass der Flüssigkeitsbedarf hauptsächlich durch Getränke mit hohem Energiegehalt und mit diuretischer Wirkung gedeckt wird. So werden z.B. in großen Mengen Limonade, Kaffee und auch Alkohol getrunken. Allerdings sind diese nicht als Durstlöscher zu empfehlen. Denn durch den Energiegehalt dieser Getränke und den Energiegehalt der Nahrung kommt es insgesamt zu einer Energiezufuhr, die über dem eigentlichen Energiebedarf der jeweiligen Bevölkerungsgruppe liegt.
Wenn über eine längere Zeit eine erhöhte Energiezufuhr vorliegt, kann es zur Ausbildung von Fettsucht kommen, die mit bedenklichen Folgen für die Gesundheit gekoppelt ist.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es den unterschiedlichen Getränkekonsum von den Einwohnern der Stadt Bernburg jüngeren, mittleren und höheren Alters darzustellen.
Dabei wird zwischen den Altersgruppen und zwischen Frauen und Männern der Getränkekonsum hinsichtlich der Quantität der Wasserzufuhr erfasst und gegenübergestellt. Die Ergebnisse werden außerdem mit den Empfehlungen der DGE verglichen.
Auch wurde die Energiezufuhr durch die Getränke ermittelt und unter den Gruppen verglichen. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass ein Unterschied im Trinkverhalten zwischen Männern und Frauen besteht.
So gehen die Autorinnen dieser Arbeit davon aus, dass überwiegend bei den Frauen auf energiereiche Getränke aufgrund des stärker ausgeprägten Schlankheitsbewusstseins verzichtet wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Zielsetzung
- Grundlagen
- Bedeutung des Trinkens für den Menschen und Funktion des Wassers im Körper
- Der Durst
- Tägliche Energiezufuhr und die Auswahl der Getränke
- Getränkearten
- Wasser
- Kaffeegetränke
- Teegetränke
- Erfrischungsgetränke
- Säfte und Nektare
- Milch und Milchmischgetränke
- Alkoholische Getränke
- Methode
- Auswahlverfahren
- Grundgesamtheit
- Stichprobe
- Erhebungsmethode
- Erhebungsinstrument
- Auswertungsmethode
- Ergebnisse
- Wasseraufnahme
- Auflistung der Mengen
- Vergleich zwischen den ermittelten Mengen
- Vergleich der ermittelten Mengen mit den Richtwerten der DGE
- Art der Getränke
- Wasser
- Kaffeegetränke
- Teegetränke
- Erfrischungsgetränke
- Säfte und Nektare
- Milch und Milchmischgetränke
- Alkoholische Getränke
- Energiezufuhr durch die Getränke
- Energiezufuhr durch Getränke bei den Männern in den drei Altersgruppen
- Energiezufuhr durch Getränke bei den Frauen in den drei Altersgruppen
- Vergleich der Energiezufuhr durch Getränke zwischen Männern und Frauen
- Diskussion
- Diskussion der Ergebnisse
- Diskussion der Methode
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Trinkverhalten der Einwohner von Bernburg in verschiedenen Altersgruppen. Dabei werden die Art, Menge und der Energiegehalt der Getränke betrachtet. Ziel der Arbeit ist es, Unterschiede im Trinkverhalten zwischen Männern und Frauen sowie zwischen verschiedenen Altersgruppen aufzuzeigen. Darüber hinaus werden die Ergebnisse mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) verglichen.
- Untersuchung des Trinkverhaltens der Einwohner von Bernburg in drei verschiedenen Altersgruppen
- Analyse der Art, Menge und des Energiegehalts der Getränke
- Vergleich des Trinkverhaltens zwischen Männern und Frauen
- Vergleich der Trinkgewohnheiten zwischen den Altersgruppen
- Bewertung der Ergebnisse im Kontext der Empfehlungen der DGE
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und Zielsetzung. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen des Themas beleuchtet, darunter die Bedeutung des Trinkens für den Menschen, der Durst und die tägliche Energiezufuhr. Es werden verschiedene Getränkearten im Detail beschrieben, um die Vielfalt der Getränke und ihre jeweiligen Eigenschaften zu beleuchten.
Im dritten Kapitel wird die Methodik der Hausarbeit vorgestellt, inklusive des Auswahlverfahrens, der Grundgesamtheit, der Stichprobe, der Erhebungsmethode, des Erhebungsinstruments und der Auswertungsmethode. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, getrennt nach Wasseraufnahme, Art der Getränke und Energiezufuhr durch die Getränke. Die Ergebnisse werden detailliert analysiert und mit den Empfehlungen der DGE verglichen.
Im fünften Kapitel erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse und der Methodik. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Trinkverhalten, Getränkekonsum, Bernburg, Altersgruppen, Energiegehalt, DGE, Wasseraufnahme, Kaffeegetränke, Teegetränke, Erfrischungsgetränke, Säfte, Nektare, Milch, Milchmischgetränke, alkoholische Getränke, Methodik, Ergebnisse, Diskussion.
Häufig gestellte Fragen
Warum erreichen viele Deutsche nicht die empfohlene Trinkmenge?
Häufige Gründe sind ein schwach ausgeprägtes Durstempfinden (besonders bei Kindern und Senioren) sowie die bewusste Vermeidung von Flüssigkeit bei Inkontinenzproblemen im Alter.
Welche Folgen hat ein chronischer Flüssigkeitsmangel?
Es kann zu Kopfschmerzen, verminderter Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeitseinbußen und einer generellen Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit führen.
Warum sind Limonaden und Alkohol als Durstlöscher ungeeignet?
Diese Getränke haben einen hohen Energiegehalt, was zu Übergewicht führen kann, oder wirken diuretisch (entwässernd), was den Flüssigkeitshaushalt weiter belastet.
Gibt es Unterschiede im Trinkverhalten zwischen Männern und Frauen?
Die Studie geht davon aus, dass Frauen aufgrund eines stärkeren Schlankheitsbewusstseins häufiger auf energiereiche Getränke verzichten als Männer.
Was sind die Empfehlungen der DGE zur Wasseraufnahme?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt Richtwerte für die tägliche Wasserzufuhr vor, mit denen die Ergebnisse der Bernburger Studie verglichen werden.
- Quote paper
- Thea Zwiers (Author), Kathrin Lorenz (Author), 2003, Untersuchung des Trinkverhaltens der Bernburger in drei verschiedenen Altersgruppen hinsichtlich der Art, Menge und des Energiegehaltes der Getränke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66976