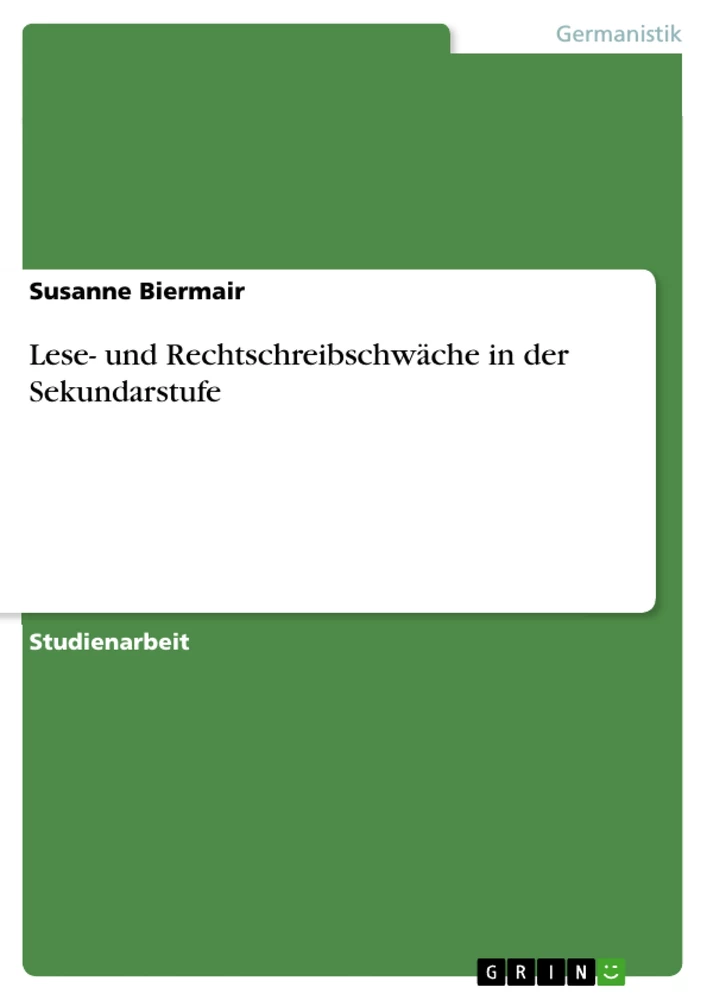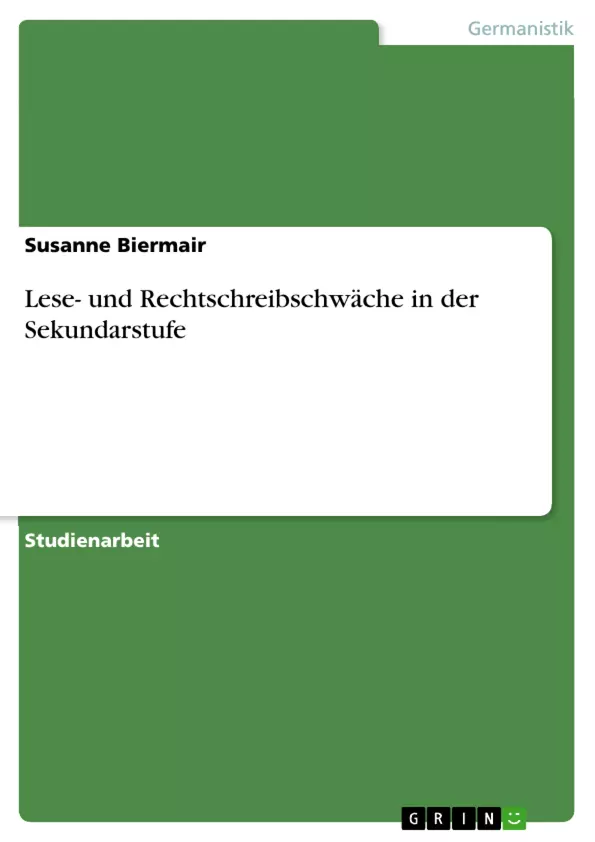In der Literatur findet sich eine verwirrende Vielzahl von unterschiedlich gebrauchten Bezeichnungen, die mit dem Phänomen Lese-Rechtschreibschwäche zu tun haben. Zu den gebräuchlichsten gehören im deutschen Sprachraum die Ausdrücke Legasthenie und Dyslexie. Beide Wörter bezeichnen eine Phänomen, das sich wörtlich genommen auf einen Bereich der Schriftsprache beschränkt, nämlich das Lesen bzw. die gesprochene Sprache. Das, was unter Störung des Schriftspracherwerbs verstanden wird, was als Ursache angenommen wird und wie Schriftspracherwerbsprozesse zu fördern sind, ist heterogen. Begriffe wie z.B. Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), A- bzw. Dyslxie bzw. Anbzw. Dysorthografie werden für das selbe Erscheinungsbild verwendet, nämlich für orthografisch nicht korrekte Schreibungen eines Schreibers zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Mehrzahl der Kinder/Schreiber über bessere Schreibungen verfügt.
UnterLegasthenie(altgr.:legein= sprechen [hier = lesen, schreiben],a= nicht [hier = ohne],sthenos= Kraft [hier = Stärke]; Lese-Rechtschreib-Schwäche/Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit) versteht man eine massive und lang andauernde Störung des Erwerbs der Schriftsprache.
Die betroffenen Personen (Legastheniker) haben häufig Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen zur geschriebenen Sprache und umgekehrt. Als Ursache werden Probleme der auditiven und visuellen Wahrnehmungsverarbeitung, der Verarbeitung der Sprache und vor allem der Phonetik angenommen. Ursprünglich war Legasthenie der nur in der Medizin und Psychologie benutzte Begriff für eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und der daraus resultierenden Probleme. In der Pädagogik sprach und spricht man eher von einer „isolierten Lese-Rechtschreibstörung“ oder einer „Lernstörung bei normal begabten Kindern“, um die Diskrepanz zwischen einer ausgesprochen niedrigen Lese- und Schreibleistung und normaler oder sogar oft überdurchschnittlich hoher Intelligenz in Worte zu fassen.
Als internationaler Begriff wird in den meisten Ländern für die isolierte Lese-Rechtschreibstörung Dyslexie bzw. Dyslexia (Dys-/ dys- = erschwert, schwierig, miss-/Abweichung von der Norm, lexis= Sprechen, Rede Wort) benutzt. Die Abkürzung LRS wird im Schulsystem vor allem für andere Formen von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten angewendet, z. B. für alle nichtlegasthenen Leseschwächen bedingt durch Erkrankung, Meningitis oder andere Behinderungen wie z.B. Down-Syndrom oder auch durch mangelnde Deutschkenntnisse wegen Migration.
Inhaltsverzeichnis
- Wichtige Lernvoraussetzungen
- Definition der Lese- Rechtschreibstörung
- Definition nach dem DSM-IV
- Erscheinungsbild
- Anzeichen für Lese-Rechtschreibstörung
- Lese-Rechtschreibstörung in der Sekundarstufe
- Die Teilleistungen
- Die richtige Hilfe
- Hilfen in der Schule
- Der Notenschutz
- Chronik von Richtlinien und Erlässen bezüglich Legasthenie in Österreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Lese-Rechtschreibschwäche in der Sekundarstufe und zielt darauf ab, die verschiedenen Facetten der Störung, ihre Ursachen und die Möglichkeiten der Hilfestellung zu beleuchten.
- Definition und Erscheinungsbild der Lese-Rechtschreibstörung
- Anzeichen und Diagnostik der Lese-Rechtschreibstörung in der Sekundarstufe
- Ursachen und Faktoren, die zu einer Lese-Rechtschreibstörung beitragen
- Möglichkeiten der Hilfestellung für Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche
- Relevante Richtlinien und Erlasse in Österreich bezüglich Legasthenie
Zusammenfassung der Kapitel
- Wichtige Lernvoraussetzungen: Dieses Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Lese-Rechtschreibstörung. Es definiert die Störung anhand des DSM-IV und beschreibt ihr Erscheinungsbild, das sich sowohl in der Lese- als auch in der Rechtschreibfähigkeit zeigen kann.
- Anzeichen für Lese-Rechtschreibstörung: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Anzeichen, die auf eine Lese-Rechtschreibstörung hindeuten können. Diese können sowohl im schulischen Kontext als auch im Alltag auftreten.
- Lese-Rechtschreibstörung in der Sekundarstufe: Dieses Kapitel befasst sich mit der besonderen Herausforderung der Lese-Rechtschreibstörung in der Sekundarstufe. Es beleuchtet die spezifischen Schwierigkeiten, mit denen Schüler in diesem Alter konfrontiert sind.
- Die Teilleistungen: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Teilleistungen, die bei der Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit eine Rolle spielen. Es zeigt auf, welche Bereiche bei Schülern mit Lese-Rechtschreibstörung häufig beeinträchtigt sind.
- Die richtige Hilfe: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Hilfsmöglichkeiten für Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche. Es werden sowohl schulische Unterstützungsmöglichkeiten als auch externe Hilfsangebote vorgestellt.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibstörung, Legasthenie, Dyslexie, Lese-Rechtschreibschwäche, LRS, Schriftspracherwerb, auditive und visuelle Wahrnehmungsverarbeitung, Diagnostik, Hilfestellung, Schulsystem, Richtlinien, Erlasse, Österreich.
Häufig gestellte Fragen zur Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)
Was ist der Unterschied zwischen Legasthenie und LRS?
Legasthenie wird oft als anlagebedingte, isolierte Störung bei normaler Intelligenz definiert. LRS wird häufig als Sammelbegriff für verschiedene Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (auch durch Krankheit oder Migration) verwendet.
Welche Ursachen werden für Legasthenie angenommen?
Als Ursachen gelten Probleme bei der auditiven und visuellen Wahrnehmungsverarbeitung sowie Schwierigkeiten bei der phonetischen Verarbeitung von Sprache.
Wie äußert sich eine Lese-Rechtschreibstörung in der Sekundarstufe?
Betroffene Schüler haben oft Probleme mit komplexen Texten, langsames Lesetempo, eine hohe Fehlerquote in der Rechtschreibung und daraus resultierende Motivationsprobleme.
Was versteht man unter Notenschutz?
Notenschutz bedeutet, dass die Rechtschreibleistung bei Schülern mit diagnostizierter Legasthenie nicht oder nur eingeschränkt in die Notengebung einfließt.
Welche Hilfen gibt es für betroffene Schüler in der Schule?
Neben dem Notenschutz gibt es den Nachteilsausgleich (z. B. mehr Zeit bei Prüfungen) sowie gezielte Förderkurse zur Stärkung der Teilleistungen.
- Quote paper
- Mag. Susanne Biermair (Author), 2006, Lese- und Rechtschreibschwäche in der Sekundarstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67032