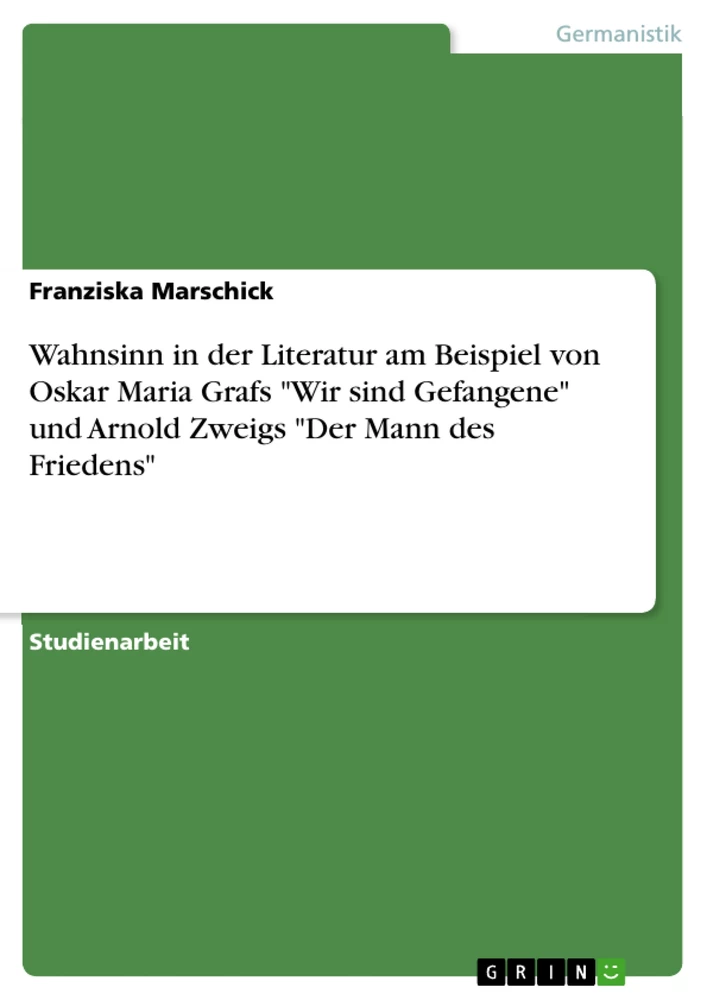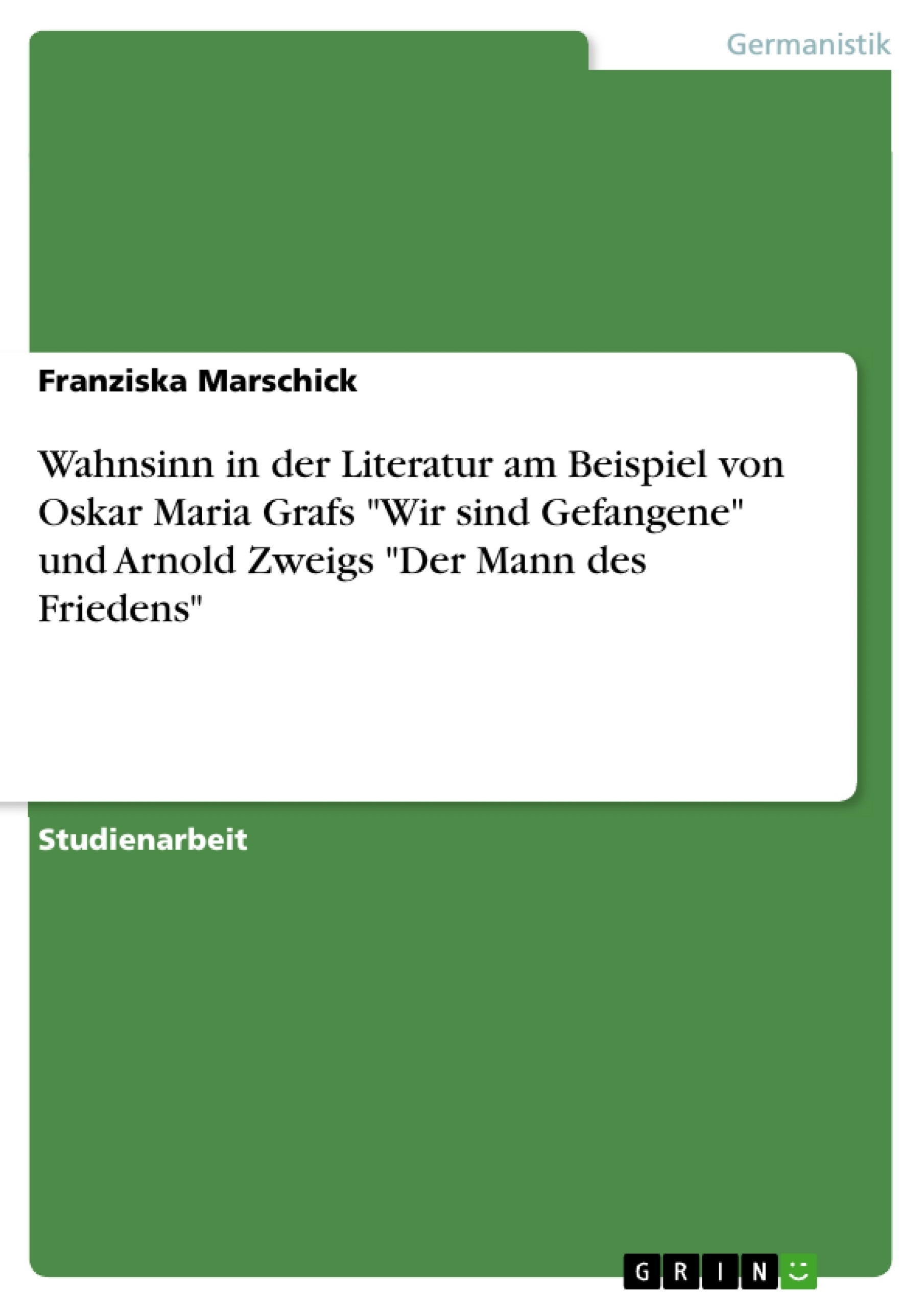Der Wahnsinn ist ein Motiv mit langer Tradition in der Literatur. Ob „Iwein“, der Ritter der Artusrunde, das Gretchen im „Faust“ oder der Bahnwärter „Thiel“, viele Figuren werden aus den verschiedensten Anlässen wahnsinnig und dies hat die unterschiedlichsten Folgen für sie. Die Gründe dafür sind zahlreich: Enttäuschung, Wut, Verzweiflung, etc.
Auch in der Literatur, welche zur Zeit des Ersten Weltkrieges spielt, erliegen die Protagonisten dem Wahnsinn, wie z.B. „Oskar“ in Oskar Maria Grafs „Wir sind Gefangene“ und der „Richter Helbret“ in Arnold Zweigs „Der Mann des Friedens“.
In dieser Seminararbeit möchte ich die beiden Figuren und deren Geisteszustand miteinander vergleichen. Zuerst werde ich dazu den Begriff Wahnsinn kurz definieren und auf die Tradition des Motivs in der Literatur eingehen, dann das Weltbild Oskar Maria Grafs dem von Arnold Zweig gegenüberstellen und den Inhalt der beiden Werke erläutern. Im Folgenden werde ich die zwei Protagonisten unter verschiedenen Gesichtspunkten beschreiben und herausarbeiten aus welchen Gründen sie „verrückt“ werden und welche Konsequenzen dieser Zustand für sie hat. Zuletzt werde ich darauf eingehen, welche Funktion das Motiv „Wahnsinn“ in den beiden Werken erfüllt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Wahnsinn - Der Versuch einer Definition
- 1. Definition
- 2. In der Literatur
- II. Hintergrund
- 1. Der Erste Weltkrieg
- 2. Autoren
- 2.1 Oskar Maria Graf
- 2.1.1 Im Krieg
- 2.1.2 Nach dem Krieg
- 2.2 Arnold Zweig
- 2.2.1 Im Krieg
- 2.2.2 Nach dem Krieg
- 2.1 Oskar Maria Graf
- 3. Inhalt
- 3.1 „Wir sind Gefangene“
- 3.2 „Der Mann des Friedens“
- III. Richter Helbret in „Der Mann des Friedens“
- 1. Ausgangslage
- 1.1 Stellung in der Gesellschaft
- 1.2 Helbrets Weltbild
- 2. Anlass
- 3. Anzeichen
- 3.1 Isolation
- 3.2 Körperliche Anzeichen
- 4. Folgen
- 4.1 Reaktion der Familie
- 4.2 Reaktion der Gesellschaft
- 1. Ausgangslage
- IV. Oskar in „Wir sind Gefangene“
- 1. Ausgangslage
- 1.1 Stellung in der Gesellschaft
- 1.2 Oskars Weltbild
- 2. Anlass
- 3. Anzeichen
- 4. Folgen
- 4.1 Reaktion der Familie
- 4.2 Reaktion der Gesellschaft
- 1. Ausgangslage
- V. Vergleich der beiden Protagonisten und deren Geisteszustand
- 1. Zu Anfang
- 2. Wahnsinn
- 3. Am Ende
- VI. Funktion des Wahnsinns in beiden Werken
- 1. Kriegsdarstellung
- 2. Erleben des Individuums
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Darstellung von Wahnsinn bei Oskar Maria Graf und Arnold Zweig im Kontext des Ersten Weltkriegs. Ziel ist der Vergleich der Figuren Oskar und Richter Helbret hinsichtlich ihrer Ausgangslage, der Anzeichen ihres Wahnsinns, der Folgen und der Funktion dieses Motivs in den jeweiligen Werken.
- Darstellung von Wahnsinn im Ersten Weltkrieg
- Vergleich zweier literarischer Figuren
- Soziale und gesellschaftliche Reaktionen auf Wahnsinn
- Funktion des Wahnsinnsmotivs als literarisches Mittel
- Analyse der Weltbilder der Protagonisten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Wahnsinn – Der Versuch einer Definition: Dieses Kapitel unternimmt den Versuch, den vielschichtigen Begriff „Wahnsinn“ zu definieren, wobei die Schwierigkeiten einer eindeutigen Abgrenzung herausgestellt werden. Es wird zwischen umgangssprachlicher Verwendung und fachlicher Terminologie differenziert und die subjektive Natur des Wahnsinns betont, der meist nur von außen wahrgenommen werden kann. Der Kapitelbeginn beleuchtet die historische und gesellschaftliche Behandlung von Wahnsinnigen, von der Ausgrenzung bis hin zu Ansätzen der Heilung. Die Grenzen der Definition des Wahnsinns werden diskutiert, und die unterschiedlichen Perspektiven (Psychologie, Justiz, Alltag) werden beleuchtet.
II. Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den historischen und biographischen Kontext für die Analyse der beiden literarischen Werke. Es behandelt den Ersten Weltkrieg und seine Auswirkungen sowie die Lebensläufe von Oskar Maria Graf und Arnold Zweig, jeweils mit einem Fokus auf ihre Kriegserfahrungen und die nachfolgende Phase. Dieses Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der dargestellten Figuren und ihrer psychischen Zustände. Es stellt die sozialen und politischen Umstände dar, in denen die Werke entstanden sind, und die somit den Wahnsinn der Protagonisten beeinflussen.
III. Richter Helbret in „Der Mann des Friedens“: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Figur des Richters Helbret in Arnold Zweigs Werk. Es werden seine soziale Stellung, sein Weltbild vor dem geistigen Zusammenbruch, die auslösenden Faktoren seines Wahnsinns, die Anzeichen seines Verfalls (Isolation, körperliche Symptome) und die Reaktionen seiner Familie und der Gesellschaft detailliert analysiert. Die Zusammenfassung soll zeigen, wie Zweigs Darstellung von Helbrets innerem Kampf und dessen gesellschaftliche Folgen gestaltet ist.
IV. Oskar in „Wir sind Gefangene“: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel, wird hier die Figur Oskar aus Oskar Maria Grafs Werk im Detail beleuchtet. Die Analyse umfasst seine soziale Position, seine Weltanschauung, die Ursachen seines Wahnsinns, die sich manifestierenden Symptome und die Reaktionen seines Umfelds. Die Zusammenfassung soll die spezifischen Aspekte von Oskars Wahnsinn und dessen Darstellung im Werk von Graf hervorheben und mit dem Fall Helbrets vergleichen.
V. Vergleich der beiden Protagonisten und deren Geisteszustand: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Protagonisten, Oskar und Richter Helbret, und analysiert ihre jeweiligen Wege in den Wahnsinn. Es untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ausgangslagen, den Anzeichen ihres Wahnsinns und den daraus resultierenden Konsequenzen. Der Vergleich soll die unterschiedlichen literarischen Strategien zur Darstellung von Wahnsinn hervorheben.
VI. Funktion des Wahnsinns in beiden Werken: Der abschließende Teil analysiert die Funktion des Wahnsinnsmotivs in beiden literarischen Werken. Es werden die unterschiedlichen Möglichkeiten untersucht, wie der Wahnsinn die Darstellung des Krieges und das Erleben des Individuums beeinflusst. Es soll erörtert werden, inwiefern der Wahnsinn als Metapher für die traumatischen Erfahrungen des Krieges gedeutet werden kann.
Schlüsselwörter
Wahnsinn, Erster Weltkrieg, Oskar Maria Graf, Arnold Zweig, „Wir sind Gefangene“, „Der Mann des Friedens“, Kriegsliteratur, Trauma, Gesellschaft, Individuum, psychische Erkrankung, Vergleichende Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Seminararbeit: Darstellung von Wahnsinn bei Oskar Maria Graf und Arnold Zweig
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Darstellung von Wahnsinn bei Oskar Maria Graf und Arnold Zweig im Kontext des Ersten Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Figuren Oskar (aus "Wir sind Gefangene") und Richter Helbret (aus "Der Mann des Friedens") bezüglich ihrer Ausgangslage, der Anzeichen ihres Wahnsinns, der Folgen und der Funktion dieses Motivs in den jeweiligen Werken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Wahnsinn im Ersten Weltkrieg, vergleicht zwei literarische Figuren, analysiert soziale und gesellschaftliche Reaktionen auf Wahnsinn, untersucht die Funktion des Wahnsinnsmotivs als literarisches Mittel und analysiert die Weltbilder der Protagonisten. Sie umfasst eine Definition von Wahnsinn, einen historischen und biographischen Hintergrund zu den Autoren und ihren Werken sowie eine detaillierte Analyse der beiden Hauptfiguren und ihrer Entwicklung.
Welche Werke werden analysiert?
Die Seminararbeit analysiert zwei Werke: "Wir sind Gefangene" von Oskar Maria Graf und "Der Mann des Friedens" von Arnold Zweig. Der Fokus liegt auf den Protagonisten Oskar und Richter Helbret und deren Darstellung des Wahnsinns.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Kapitel I definiert den Begriff "Wahnsinn"; Kapitel II liefert den historischen und biographischen Hintergrund; Kapitel III und IV analysieren die Figuren Richter Helbret und Oskar; Kapitel V vergleicht beide Protagonisten; und Kapitel VI untersucht die Funktion des Wahnsinnsmotivs in beiden Werken. Die Arbeit beinhaltet außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte des Wahnsinns werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Ausgangslage der Figuren (soziale Stellung, Weltbild), die Anzeichen ihres Wahnsinns (Isolation, körperliche Symptome), die auslösenden Faktoren, die Reaktionen der Familie und Gesellschaft sowie die Funktion des Wahnsinnsmotivs als literarisches Mittel zur Darstellung des Krieges und des individuellen Erlebens.
Wie werden die beiden Protagonisten verglichen?
Der Vergleich der Protagonisten Oskar und Richter Helbret umfasst ihre Ausgangslagen, die Anzeichen ihres Wahnsinns, die Folgen ihres Zustands und die unterschiedlichen literarischen Strategien zur Darstellung von Wahnsinn in den jeweiligen Werken. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgearbeitet.
Welche Funktion hat das Wahnsinnsmotiv in den Werken?
Das Wahnsinnsmotiv dient als Metapher für die traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und beeinflusst sowohl die Darstellung des Krieges als auch das Erleben des Individuums. Die Arbeit untersucht, wie der Wahnsinn die Kriegsdarstellung und die individuelle Perspektive prägt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wahnsinn, Erster Weltkrieg, Oskar Maria Graf, Arnold Zweig, „Wir sind Gefangene“, „Der Mann des Friedens“, Kriegsliteratur, Trauma, Gesellschaft, Individuum, psychische Erkrankung, Vergleichende Literaturanalyse.
- Citar trabajo
- Franziska Marschick (Autor), 2006, Wahnsinn in der Literatur am Beispiel von Oskar Maria Grafs "Wir sind Gefangene" und Arnold Zweigs "Der Mann des Friedens", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67090