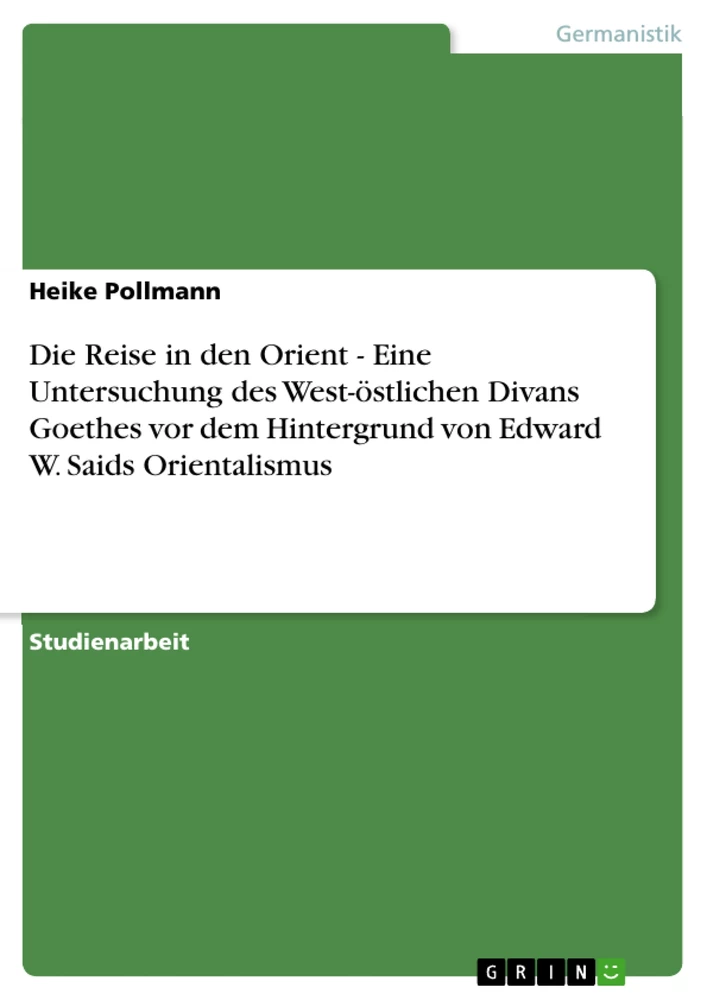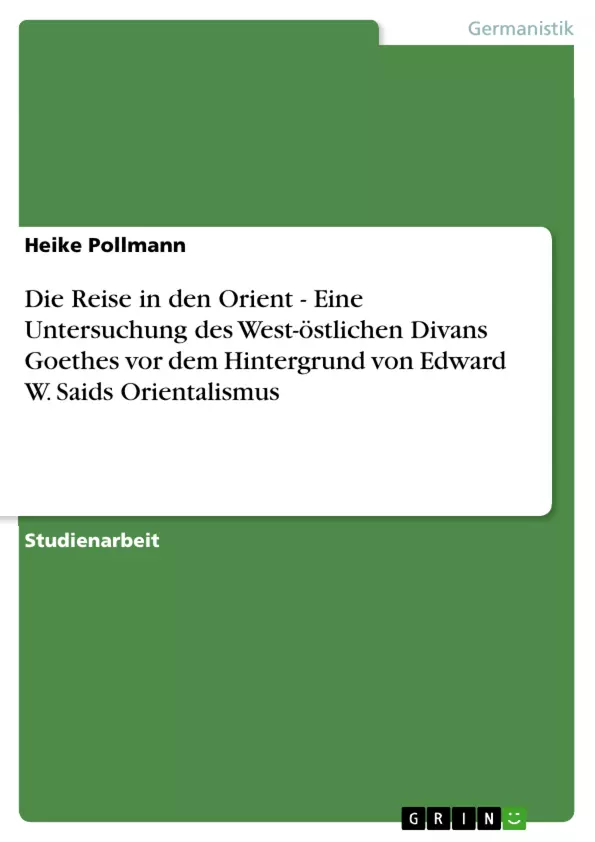„Der Orientalismus ist ein westlicher Stil der Herrschaft, Umstrukturierung und des Autoritätsbesitzes über den Orient.“ (Said 1981, 10)
Der Postkolonialist Edward W. Said bringt hier auf den Punkt, was der Kern seines Werks Orientalismus ist. Er definiert „Orientalismus“ als Methode der Unterwerfung, Degradierung und Manipulierung des Orients durch Europa und Nordamerika. Diese Vorgehensweise wird auf akademischer bzw. universitärer Ebene mit der Absicht eines wissenschaftlichen Diskurses über den Orient betrieben. (Daß der „Orient“ ein heterogener, geographisch wie kulturell nicht genau festgelegter Begriff ist, dessen Geltungsbereich sich von Nordafrika bis in den Fernen Osten erstreckt, setze ich hier voraus.) Doch auch politische Unternehmungen und fiktive Literatur bedienen sich Said zufolge dieser Methode. Zwar behandelt Said in Orientalismus hauptsächlich britische, französische und nordamerikanische Werke und Autoren, doch wird an mehreren Stellen deutlich, daß sich seine Thesen ebenso auf deutsche Literatur und Schriftsteller übertragen lassen (vgl. ebd., 26); mehrfach wird auch Goethes West-östlicher Divan erwähnt (vgl. ebd., 62).
Diese Arbeit soll ausschließlich den literarisch-fiktiven Bereich des Orientalismus berücksichtigen. Dabei wird vor dem Hintergrund verschiedener Thesen Saids untersucht, ob sich auch in Goethes West-östlichem Divan Anzeichen der Autorität und Kontrolle über den Orient finden lassen und ob Goethe sich dadurch als ein „Orientalist“ im Sinne Saids offenbart.
Said kritisiert die grundsätzliche Trennung von Osten und Westen in der Orient-Literatur westlicher Schriftsteller. Problematisch ist dabei, daß keine Gleichberechtigung der beiden Teile unterstellt wird, sondern eine Darstellung entsprechend des angenommenen Machtverhältnisses gewählt wird. Im ersten Teil der Arbeit wird geprüft, ob auch Goethe im West-östlichen Divan eine solche Trennung vorgenommen hat und wie er sein Verhältnis zum Orient gesehen hat. Gegenstand des zweiten Teils wird das in der Forschungsliteratur zum Divan vielbesprochene Motiv der Flucht sein, wobei der Schwerpunkt des Kapitels auf der Untersuchung des Gedichts Hegire liegen wird. Said stellt fest, daß für jeden Orient-Schriftsteller die Reise in den Orient die Erfüllung eines persönlichen Projektes ist. Welches Projekt wollte Goethe im Divan verwirklichen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spaltung von Orient und Okzident
- Zwillingsbruder Hafis
- Reise in den Orient
- Das Motiv der Flucht
- Hegire
- Typische Motive
- Liebestod
- Der Orient als poetologisches Konzept
- „Orientalismus“ und „Orientalität“
- Symbol und Allegorie
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob sich in Goethes West-östlichem Divan Anzeichen von Autorität und Kontrolle über den Orient finden lassen, und ob sich Goethe dadurch als ein „Orientalist“ im Sinne Saids offenbart. Die Arbeit untersucht den literarisch-fiktiven Bereich des Orientalismus vor dem Hintergrund verschiedener Thesen Saids.
- Die Spaltung von Orient und Okzident in Goethes Werk und die Frage, ob Goethe eine Gleichberechtigung von Ost und West anstrebt.
- Das Motiv der Flucht im West-östlichen Divan, insbesondere im Gedicht Hegire, und Goethes persönliches Projekt im Zusammenhang mit dieser Reise in den Orient.
- Die Verwendung stereotypisierender Bilder und Motive des Orients durch Goethe, anhand des altpersischen Motivs des Liebestodes.
- Die Verbindung von Saids These vom Orient als Erfüllung eines Projekts des Schriftstellers mit Goethes Ästhetik.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Kritik Saids an der Trennung von Orient und Okzident in der Orient-Literatur und untersucht, ob Goethe im West-östlichen Divan eine solche Trennung vorgenommen hat. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf das Motiv der Flucht im Divan und analysiert insbesondere das Gedicht Hegire, um Goethes Projekt im Zusammenhang mit der Reise in den Orient zu beleuchten. Das dritte Kapitel widmet sich der Verwendung stereotypisierender Bilder und Motive des Orients durch Goethe anhand des altpersischen Motivs des Liebestodes. Das vierte Kapitel setzt Saids These vom Orient als Erfüllung eines Projekts des Schriftstellers in Verbindung mit Goethes Ästhetik.
Schlüsselwörter
Orientalismus, West-östlicher Divan, Goethe, Hafis, Said, Orient, Okzident, Flucht, Hegire, Liebestod, Stereotype, Poetologie.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Edward W. Said den Begriff Orientalismus?
Said definiert Orientalismus als einen westlichen Stil der Herrschaft, Umstrukturierung und Autorität über den Orient, der oft auf Machtverhältnissen und Stereotypen basiert.
Wird Goethes „West-östlicher Divan“ als orientalistisches Werk eingestuft?
Die Arbeit untersucht, ob Goethe im Sinne Saids als Orientalist agiert oder ob er eine tatsächliche Gleichberechtigung zwischen Orient und Okzident anstrebte.
Welche Bedeutung hat das Gedicht „Hegire“ in diesem Kontext?
Das Gedicht „Hegire“ thematisiert das Motiv der Flucht und symbolisiert Goethes persönliche Reise in den Orient als ein literarisches Projekt.
Was kritisiert Said an der westlichen Orient-Literatur?
Er kritisiert die fundamentale Trennung von Ost und West, bei der der Westen oft als überlegen und der Osten als unterlegen oder „andersartig“ dargestellt wird.
Welche Rolle spielt das Motiv des Liebestodes?
Das altpersische Motiv des Liebestodes dient als Beispiel für die Verwendung stereotyper Bilder des Orients in der westlichen Dichtung.
- Quote paper
- Heike Pollmann (Author), 2005, Die Reise in den Orient - Eine Untersuchung des West-östlichen Divans Goethes vor dem Hintergrund von Edward W. Saids Orientalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67104