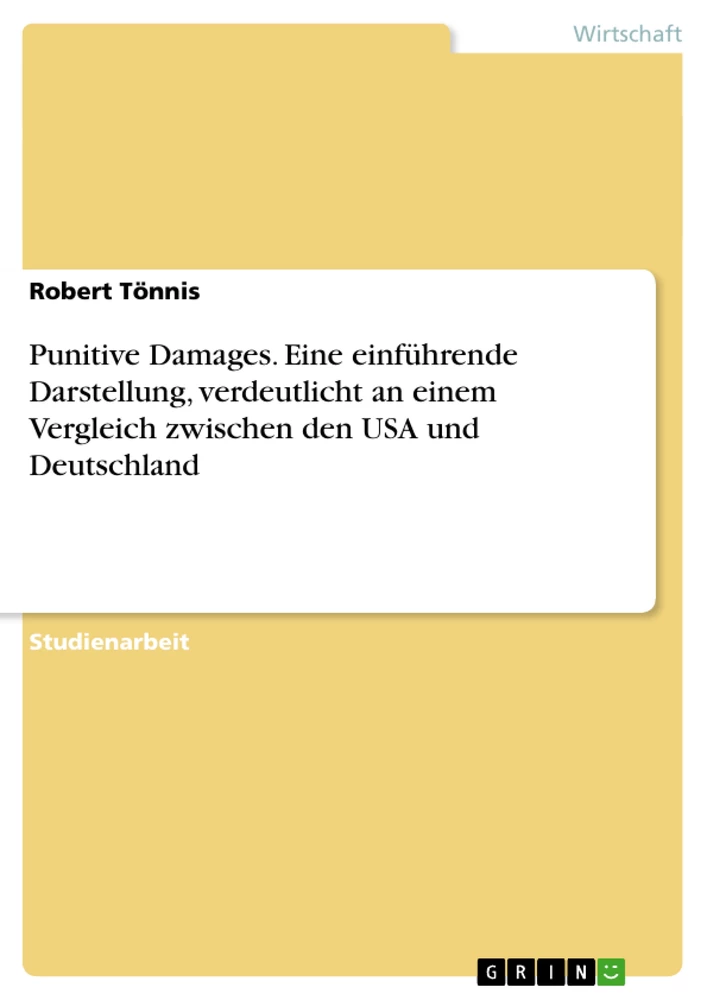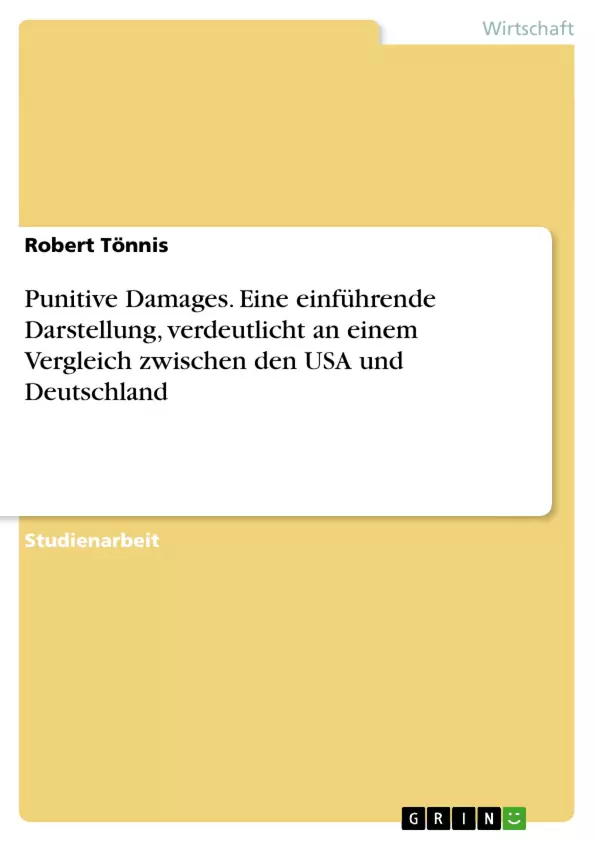Aufgrund der internationalen Verflechtung und der mit dem Eintritt in ausländische Märkte verbundenen Anerkennung des jeweiligen Rechtssystems, wächst das Interesse an Rechtsordnungen anderer Staaten und wie diese im Vergleich zum eigenen Rechtssystem stehen. Es ist zu erkennen, dass sich immer mehr Juristen mit den Fragestellungen des internationalen Rechts befassen, da die Anforderungen einer vernetzten Wirtschaft und Kultur heutzutage tiefgründigeres Wissen ausländischer Rechtsordnungen erfordern. Explizit sind hier Vergleiche zum eigenen Rechtssystem unerlässlich.
Ein besonders sensibles, aber für Unternehmen mit Ambitionen der Markterschließung im Common Law System nicht unerhebliches Thema, stellen dabei die punitive damages dar.
Bei den punitive damages geht es um Schadensersatz (damages) mit strafendem (punitive) Charakter und somit um die Verurteilung des Beklagten für sein schädliches Verhalten. Dies soll im selben Atemzug Dritte vor selbigen Handlungen abschrecken. Dabei ist die Bemessungsgrundlage das Vermögensverhältnis des Beklagten, die Art der Verletzung und der Charakter der Handlung. Außerdem handelt es sich um Bestrafungen, welche zusätzlich zu den eigentlichen Schadensersatzleistungen an das Opfer einer unerlaubten Handlung zu leisten sind. Zugebilligt werden punitive damages deshalb nicht im Straf-, sondern im Zivilprozess.
Dennoch ist ihre Existenz sowohl im angelsächsischen common law System als auch im kontinental-europäischen code law System umstritten. Die Befürworter betonen das Abschreckungsbedürfnis für die Fälle, in denen die compensatory damages die dem Beklagten erwachsenen Vorteile nicht abschöpfen. Ihnen kann aber auch eine gewisse Ausgleichsfunktion in den Fällen zukommen, in denen der erlittene Schaden höher ist als die zugesprochene Schadensersatzsumme, etwa wegen der Verfahrens- und Anwaltskosten.
Die Gegner dagegen verweisen auf die Vermischung von Zivil- und Strafrecht. Das Zivilrecht soll allein einen Ausgleich schaffen für die Verluste, die dem Kläger entstanden sind; der Strafcharakter bleibt dem Strafrecht vorbehalten. Die enormen Schadensersatzsummen widersprechen den ursprünglichen Zielen und können zu gesellschaftspolitisch verfehlten Folgen wie dem Konkurs von Unternehmen führen. Dadurch (…)
(…)Aufgrund der kontroversen Ansichten und der steigenden Bedeutung dieses Themas widmet sich diese Arbeit ausschließlich den punitive damages in einer objektiven Darstellung.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Geschichtliche Entwicklung
- Erste Rechtsprechungen in England
- Erste Rechtssprechungen in den USA
- Theoretisches Konstrukt der punitive damages
- Abschreckung und Bestrafung
- Kompensation
- Rechtsdurchsetzung untermalt durch Praxisfälle
- Voraussetzungen der Zuerkennung
- Ermittlung
- Beschränkungen
- Die Rolle der Jury im Zivilprozess
- Ausgesuchte Anwendungsbereiche in der Praxis
- Produkthaftungsrecht
- Unlauterer Wettbewerb
- „Bad faith insurance“
- Vergleich USA - BRD
- Zustellung von Klagen in Deutschland
- Zustellung an deutsche Tochterfirmen in den USA
- Vorlage von Konstruktionsunterlagen und Geschäftskorrespondenzen
- Deutsche Zivilrechtsverfahren
- Amerikanische Zivilrechtsverfahren
- Das „pre-trial“-Verfahren
- Auswirkungen auf die zwischenstaatliche Rechtshilfe
- Praktische Lösung
- Zuständigkeit: „forum non convenience“
- Vollstreckbarkeit
- Aktuelles Beispiel transnationaler Rechtssprechung
- Präventionsmaßnahmen im deutschen Zivilrecht
- Kritik an den punitive damages
- Stella-Award
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Phänomen der "punitive damages" im Vergleich des US-amerikanischen und deutschen Rechtssystems. Ziel ist es, die Funktionsweise, die rechtlichen Voraussetzungen und die Auswirkungen dieser strafenden Schadensersatzansprüche zu beleuchten und die daraus resultierenden Herausforderungen für international agierende Unternehmen aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung der punitive damages
- Das theoretische Konstrukt der punitive damages: Abschreckung, Bestrafung und Kompensation
- Anwendungsbereiche der punitive damages in der Praxis (Produkthaftung, unlauterer Wettbewerb)
- Der Vergleich der zivilprozessualen Verfahren in den USA und Deutschland
- Die Bedeutung des Stella Awards im Kontext von punitive damages
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von punitive damages für international agierende Unternehmen, insbesondere im Kontext des Unterschieds zwischen Common Law- und Code Law-Systemen. Sie hebt die kontroversen Meinungen zu diesem Thema hervor, die sowohl die Abschreckungsfunktion als auch die potenziellen negativen Folgen für Unternehmen betonen. Die Arbeit fokussiert auf eine objektive Darstellung der punitive damages.
Geschichtliche Entwicklung: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Entwicklung der punitive damages in England und den USA. Es verfolgt den historischen Kontext und die Präzedenzfälle, die zur Etablierung dieses Rechtsinstituts geführt haben. Die Entwicklung der Rechtsprechung wird analysiert und ihre Auswirkungen auf die heutige Anwendung von punitive damages dargestellt. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Meilensteinen und der Evolution des Verständnisses dieser strafenden Schadensersatzansprüche.
Theoretisches Konstrukt der punitive damages: Dieser Abschnitt analysiert die theoretischen Grundlagen der punitive damages, indem er die Konzepte der Abschreckung, Bestrafung und Kompensation im Detail untersucht. Er beleuchtet die verschiedenen Argumentationslinien, die die Rechtfertigung für punitive damages stützen oder kritisieren, und analysiert die Abgrenzung zu anderen Rechtsinstrumenten. Es werden die unterschiedlichen Ansichten zur Verhältnismäßigkeit und den möglichen gesellschaftlichen Folgen diskutiert.
Ausgesuchte Anwendungsbereiche in der Praxis: Dieses Kapitel illustriert die Anwendung von punitive damages anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Rechtsgebieten wie Produkthaftung, unlauterer Wettbewerb und „Bad faith insurance“. Es analysiert die jeweiligen Sachverhalte, die Urteilsbegründungen und die Höhe der zugesprochenen Schadensersatzzahlungen, um die praktische Relevanz und die Auswirkungen von punitive damages aufzuzeigen. Die Beispiele dienen dazu, die theoretischen Überlegungen zu konkretisieren und zu veranschaulichen.
Vergleich USA - BRD: Hier wird ein detaillierter Vergleich des US-amerikanischen und deutschen Zivilrechts hinsichtlich der punitive damages durchgeführt. Es werden die Unterschiede in den Zivilprozessordnungen, der Zuständigkeit der Gerichte und der Vollstreckbarkeit von Urteilen herausgearbeitet. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen für Unternehmen, die in beiden Rechtssystemen tätig sind, und beleuchtet die möglichen Konflikte im internationalen Kontext. Ein besonderer Fokus liegt auf den zwischenstaatlichen Spannungen, die durch unterschiedliche Rechtsauffassungen entstehen.
Stella-Award: Das Kapitel untersucht die Rolle und Bedeutung des Stella Awards im Zusammenhang mit punitive damages. Es analysiert die mediale Berichterstattung und die öffentliche Wahrnehmung dieses Preises für außergewöhnlich hohe Schadensersatzzahlungen. Der Zusammenhang zwischen dem Stella Award und den gesellschaftlichen Debatten über die punitive damages wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Punitive Damages, Schadensersatz, Strafrecht, Zivilrecht, USA, Deutschland, Vergleichendes Recht, Internationales Wirtschaftsrecht, Produkthaftung, Unlauterer Wettbewerb, Abschreckung, Kompensation, Rechtsvergleich, Zivilprozess, Jury, Common Law, Code Law, Transnationale Rechtssprechung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Punitive Damages im Vergleich USA - BRD
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Phänomen der "punitive damages" (strafender Schadensersatz) im Vergleich des US-amerikanischen und deutschen Rechtssystems. Sie beleuchtet Funktionsweise, rechtliche Voraussetzungen und Auswirkungen dieser Ansprüche und die Herausforderungen für international agierende Unternehmen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der punitive damages, das theoretische Konstrukt (Abschreckung, Bestrafung, Kompensation), Anwendungsbereiche in der Praxis (Produkthaftung, unlauterer Wettbewerb, "Bad faith insurance"), den Vergleich der zivilprozessualen Verfahren in den USA und Deutschland, die Bedeutung des Stella Awards und die Herausforderungen für international agierende Unternehmen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Problemstellung, der geschichtlichen Entwicklung, dem theoretischen Konstrukt der punitive damages, den Voraussetzungen der Zuerkennung, der Ermittlung, den Beschränkungen, der Rolle der Jury, ausgewählten Anwendungsbereichen in der Praxis, einem Vergleich USA-BRD (inkl. Zustellung von Klagen, Vorlage von Unterlagen, Zuständigkeit, Vollstreckbarkeit), und dem Stella Award befassen.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Ziel ist es, die Funktionsweise, die rechtlichen Voraussetzungen und die Auswirkungen von punitive damages zu beleuchten und die daraus resultierenden Herausforderungen für international agierende Unternehmen aufzuzeigen. Die Arbeit strebt eine objektive Darstellung an.
Welche Aspekte des Vergleichs zwischen dem US-amerikanischen und dem deutschen Rechtssystem werden behandelt?
Der Vergleich umfasst die Zivilprozessordnungen, die Zuständigkeit der Gerichte, die Vollstreckbarkeit von Urteilen, die Herausforderungen für Unternehmen, die in beiden Rechtssystemen tätig sind, und mögliche Konflikte im internationalen Kontext, insbesondere zwischenstaatliche Spannungen durch unterschiedliche Rechtsauffassungen.
Welche Rolle spielt der Stella Award in der Seminararbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle und Bedeutung des Stella Awards im Zusammenhang mit punitive damages, analysiert die mediale Berichterstattung und die öffentliche Wahrnehmung und beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Award und den gesellschaftlichen Debatten über punitive damages.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Punitive Damages, Schadensersatz, Strafrecht, Zivilrecht, USA, Deutschland, Vergleichendes Recht, Internationales Wirtschaftsrecht, Produkthaftung, Unlauterer Wettbewerb, Abschreckung, Kompensation, Rechtsvergleich, Zivilprozess, Jury, Common Law, Code Law, Transnationale Rechtssprechung, Prävention.
Welche praktischen Beispiele werden in der Seminararbeit verwendet?
Die Arbeit illustriert die Anwendung von punitive damages anhand konkreter Beispiele aus der Produkthaftung, dem unlauteren Wettbewerb und "Bad faith insurance". Es werden Sachverhalte, Urteilsbegründungen und die Höhe der zugesprochenen Schadensersatzzahlungen analysiert.
Was ist die Kernaussage der Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die einzelnen Kapitel prägnant zusammen und verdeutlicht die zentralen Argumente und Erkenntnisse der Arbeit. Sie betont die Bedeutung von punitive damages für international agierende Unternehmen und die kontroversen Meinungen zu diesem Thema.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich des Rechts, insbesondere im internationalen Wirtschaftsrecht und im Vergleichenden Recht. Sie ist auch von Interesse für Unternehmen, die international tätig sind.
- Arbeit zitieren
- Robert Tönnis (Autor:in), 2006, Punitive Damages. Eine einführende Darstellung, verdeutlicht an einem Vergleich zwischen den USA und Deutschland , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67145