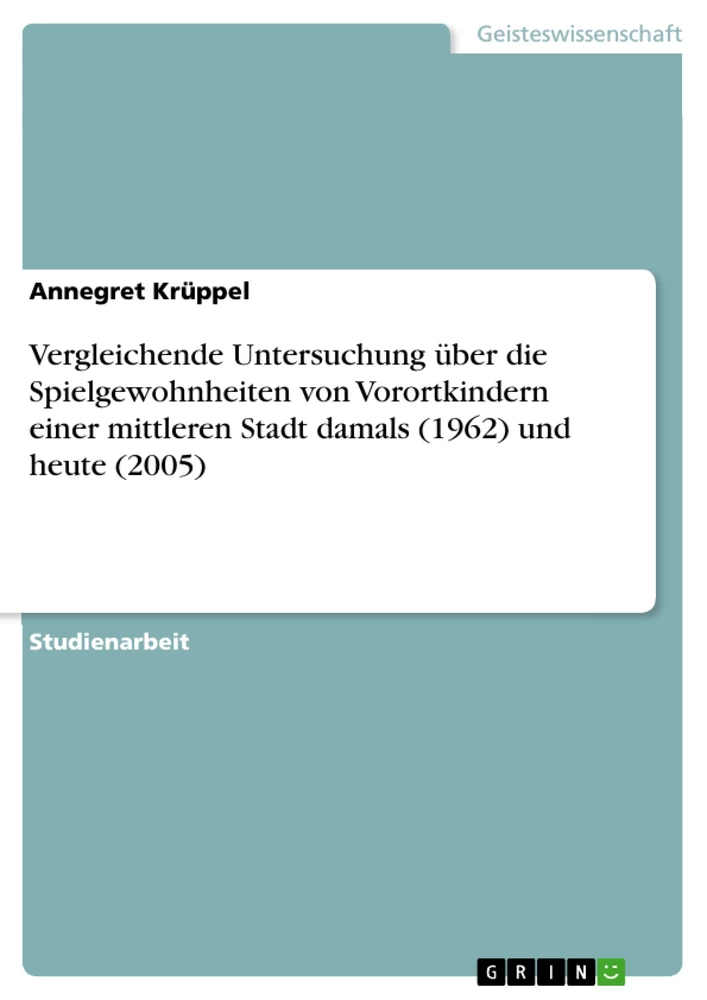Herbert OTTERSTÄDT untersuchte 1962 den Spielraum von Vorortkindern einer mittleren Stadt. Er befragte etwa 70 Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren zu ihrem Freizeitverhalten. Ziel seiner Untersuchung war es, herauszufinden, welchen Spielraum Kinder benötigen, um ungehindert und harmonisch aufzuwachsen.
Diese Untersuchung habe ich aufgegriffen um festzustellen, wie sich das Spiel- /Freizeitverhalten von Kindern im ländlichen Raum in den letzten vierzig Jahren verändert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Was versteht man unter „Kindheit“ – Ein historischer Überblick
- Die Erhebung von OTTERSTÄDT 1962 – Eine kurze Darstellung
- Beschreibung der eigenen Erhebung 2005
- Beschreibung der Wohnumgebung der befragten Kinder
- Durchführung der Befragung
- Auswertung des Fragebogens
- Was treiben „Land\"- Kinder am Nachmittag? - Zusammenfassung der Ergebnisse
- Vergleich der beiden Untersuchungen
- Übereinstimmungen
- Unterschiede
- Fazit
- Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Spielverhalten von Kindern im ländlichen Raum und analysiert, wie sich dieses im Vergleich zu einer ähnlichen Untersuchung von Herbert Otterstädt aus dem Jahr 1962 verändert hat. Die Arbeit untersucht, ob das Idealbild vom „Aufwachsen auf dem Land“ noch immer gültig ist oder ob sich Tendenzen der „Verinselung“ und „Verhäuslichung“ auch hier beobachten lassen.
- Der Wandel des Spiel- und Freizeitverhaltens von Kindern im ländlichen Raum seit 1962.
- Der Vergleich der Ergebnisse der eigenen Erhebung mit den Daten von Otterstädt.
- Die Auswirkungen der veränderten Umwelt auf das Umweltverhalten von Kindern.
- Die Frage, ob Kinder Natur „brauchen“, um sich optimal zu entwickeln.
- Die historische Entwicklung des Begriffs „Kindheit“.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt die Diskrepanz zwischen der empirisch erforschten Stadtkindheit und der normativen Landkindheit dar und zeigt, dass die Lebensbedingungen im ländlichen Raum vielfältig sind. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das Spielverhalten von Kindern im ländlichen Raum im Vergleich zu einer Studie aus dem Jahr 1962 zu untersuchen.
- Was versteht man unter „Kindheit“ – Ein historischer Überblick: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Kindheit“ von der Antike bis ins 18. Jahrhundert und verdeutlicht, dass die Vorstellung von Kindheit eine relativ junge Entwicklung ist. Es zeigt, wie sich die gesellschaftliche Wahrnehmung des Kindes und seiner Bedürfnisse im Laufe der Zeit verändert hat.
- Die Erhebung von OTTERSTÄDT 1962 – Eine kurze Darstellung: Dieses Kapitel beschreibt die Untersuchung von Herbert Otterstädt aus dem Jahr 1962, die das Spielverhalten von Vorortkindern einer mittleren Stadt untersuchte. Die Arbeit beleuchtet die Zielsetzung und Methodik von Otterstädt und dient als Vergleichsbasis für die eigene Erhebung.
- Beschreibung der eigenen Erhebung 2005: In diesem Kapitel wird die eigene empirische Untersuchung vorgestellt, die den Fragebogen von Otterstädt verwendet, um das Spielverhalten von Kindern im ländlichen Raum im Jahr 2005 zu untersuchen. Es werden die Methodik, die Durchführung und die Auswertung der eigenen Erhebung beschrieben.
- Vergleich der beiden Untersuchungen: Dieses Kapitel vergleicht die Ergebnisse der eigenen Erhebung mit den Daten von Otterstädt. Es werden sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede in den Spielgewohnheiten der Kinder in den beiden Untersuchungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Spielverhalten von Kindern, Landkindheit, Vergleichende Untersuchung, Umweltverhalten, historische Entwicklung des Begriffs „Kindheit“, Empirische Forschung, Tendenzen der „Verinselung“ und „Verhäuslichung“.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Spielverhalten von Kindern seit 1962 verändert?
Die Untersuchung zeigt einen Trend zur „Verhäuslichung“, bei dem Kinder weniger Zeit im Freien und mehr Zeit in geschlossenen Räumen oder organisierten Aktivitäten verbringen.
Was versteht man unter „Verinselung“ der Kindheit?
Damit ist gemeint, dass Kinder sich nicht mehr frei im Raum bewegen, sondern zwischen isolierten „Inseln“ (Schule, Verein, Zuhause) hin- und hergefahren werden.
Wer war Herbert Otterstädt?
Ein Forscher, der 1962 eine bedeutende Studie über den Spielraum von Vorortkindern durchführte, die als Vergleichsbasis für moderne Erhebungen dient.
Brauchen Kinder Natur für ihre Entwicklung?
Die Arbeit diskutiert, dass Naturerfahrungen essenziell für die motorische und psychische Entwicklung sind, dieser Freiraum jedoch durch Bebauung und Medienkonsum schwindet.
Ist die „Landkindheit“ heute noch ein Idealbild?
Obwohl das Land mehr Platz bietet, gleichen sich die Spielgewohnheiten durch Computer und Fernsehen immer mehr denen der Stadtkinder an.
- Citation du texte
- Annegret Krüppel (Auteur), 2006, Vergleichende Untersuchung über die Spielgewohnheiten von Vorortkindern einer mittleren Stadt damals (1962) und heute (2005), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67229