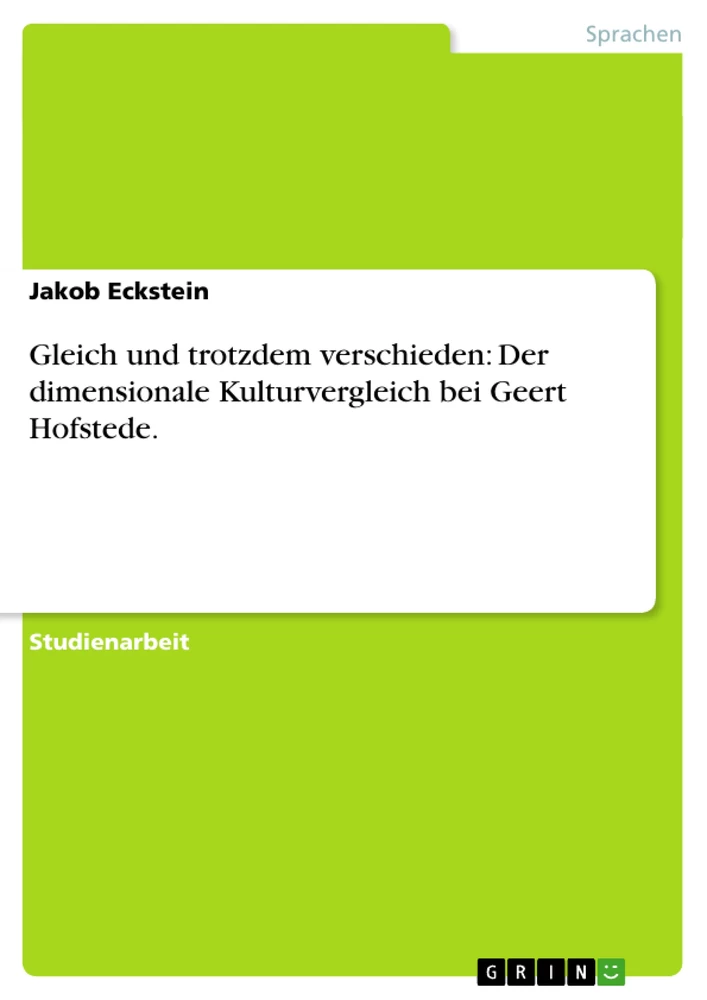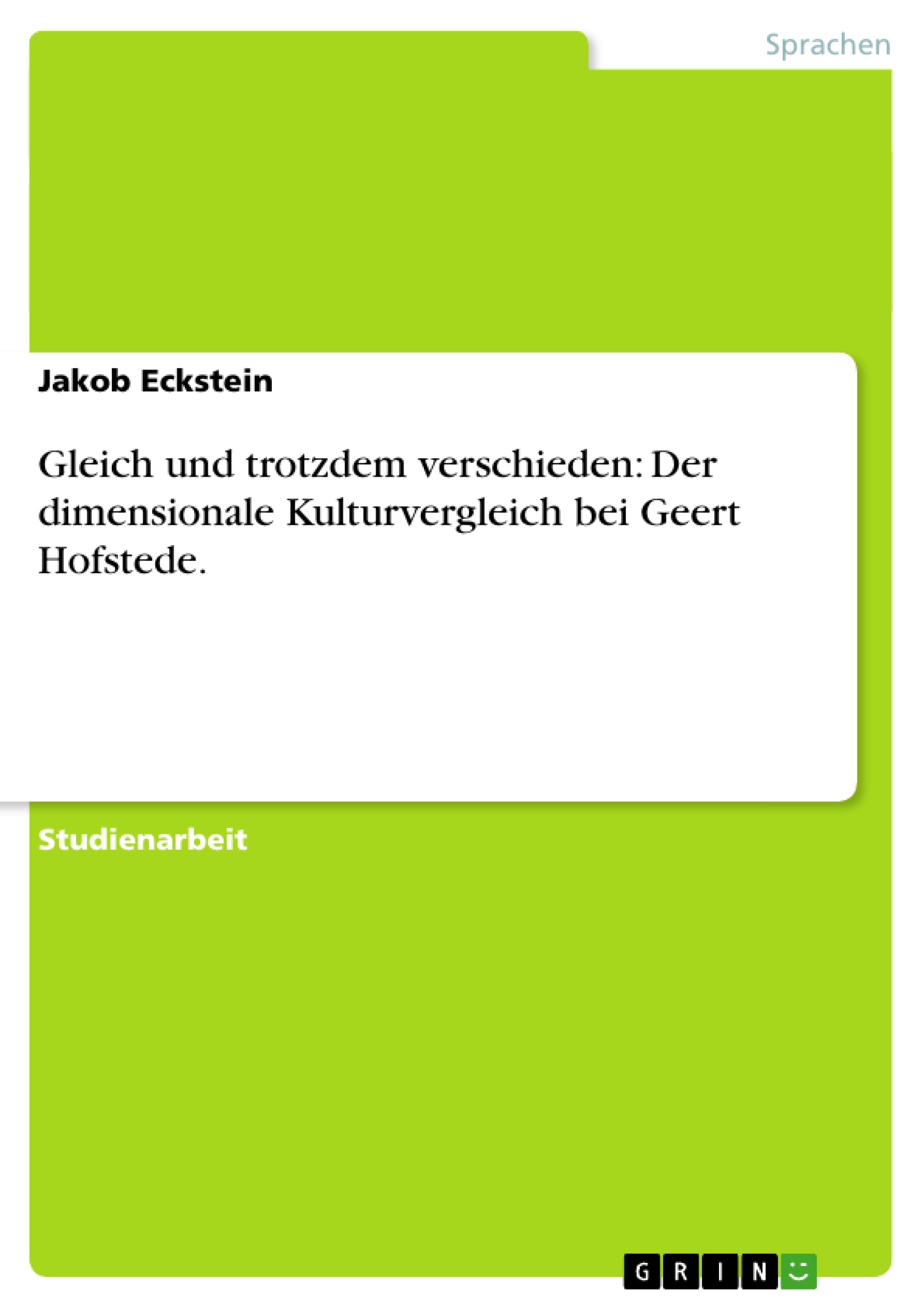Ziel dieser Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, inwieweit die Kulturdimensionen Hofstedes valide sind und ob sein Modell für einen Vergleich von Kulturen (heutzutage) geeignet ist. Zudem interessiert, ob das Modell Anwendbarkeitscharakter besitzt.
Es ist somit zu klären, inwiefern die Sonderposition des Modells, die vor allem durch Geert Hofstede immer wieder unterstrichen wird, gerechtfertigt ist. Sind sein Ansatz und seine Erhebungsmethode geeignet, oder ergeben sich Zweifel, die dazu führen, dass das Modell in seiner jetzigen Form überarbeitet oder sogar verworfen werden muss? Diesen Fragen soll in der vorliegenden Arbeit durch Aufzeigen des aktuellen Forschungsstands nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Kulturbegriff bei Hofstede
- 2.1 Kultur als Zwiebel
- 2.2 Kulturebenen
- 3. Die IBM-Studie
- 4. Kulturdimensionen nach Hofstede
- 4.1 Machtdistanz
- 4.2 Individualismus/Kollektivismus
- 4.3 Maskulinität/Femininität
- 4.4 Unsicherheitsvermeidung
- 4.5 Langzeit- vs. Kurzzeitorientierung
- 5. Kultur und Globalisierung
- 6. Lob und Kritik
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Kulturdimensionen nach Geert Hofstede und untersucht deren Validität für den Vergleich von Kulturen. Darüber hinaus wird die Anwendbarkeit des Modells im heutigen Kontext beleuchtet. Ziel ist es, die Sonderposition des Modells, die von Hofstede selbst immer wieder betont wird, zu hinterfragen und zu ergründen, ob sein Ansatz und seine Erhebungsmethode geeignet sind oder ob Zweifel bestehen, die eine Überarbeitung oder gar Verwerfung des Modells in seiner gegenwärtigen Form erforderlich machen könnten.
- Der Kulturbegriff bei Hofstede und dessen konzeptionelle Grundlage.
- Die vier Kulturdimensionen nach Hofstede und ihre Bedeutung für den Kulturvergleich.
- Die Anwendbarkeit des Hofstede-Modells im Kontext der Globalisierung.
- Kritik am Hofstede-Modell und dessen Einordnung in den aktuellen Forschungsstand.
- Bewertung der Relevanz und Anwendbarkeit des Modells für die interkulturelle Kommunikation.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Zielsetzung der Arbeit dargelegt und die Vorgehensweise zur Analyse des Hofstede-Modells skizziert. Kapitel 2 beleuchtet das Kulturverständnis von Hofstede und erläutert die konzeptionelle Grundlage seiner Forschung. Die IBM-Studie, die als Grundlage für die postulierten Kulturdimensionen dient, wird in Kapitel 3 vorgestellt. Kapitel 4 widmet sich den vier Kulturdimensionen nach Hofstede, wobei die einzelnen Dimensionen umfassend erläutert und mit Beispielen verdeutlicht werden. Kapitel 5 behandelt die Aktualität des Modells im Kontext der Globalisierung und nimmt die Auffassung von Kultur in diesem Zusammenhang erneut in den Blick. Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Kritik am Hofstede-Modell und beleuchtet die Einwände gegen die verwendete Methode, die Plausibilität der Dimensionen, den Anwendbarkeitscharakter und die gesamte Herangehensweise. In Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Kulturdimensionen, Kulturvergleich, Interkulturelle Kommunikation, Geert Hofstede, IBM-Studie, Machtdistanz, Individualismus, Kollektivismus, Maskulinität, Femininität, Unsicherheitsvermeidung, Langzeitorientierung, Kurzzeitorientierung, Globalisierung, Kritik, Anwendbarkeit.
- Arbeit zitieren
- Jakob Eckstein (Autor:in), 2006, Gleich und trotzdem verschieden: Der dimensionale Kulturvergleich bei Geert Hofstede., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67246