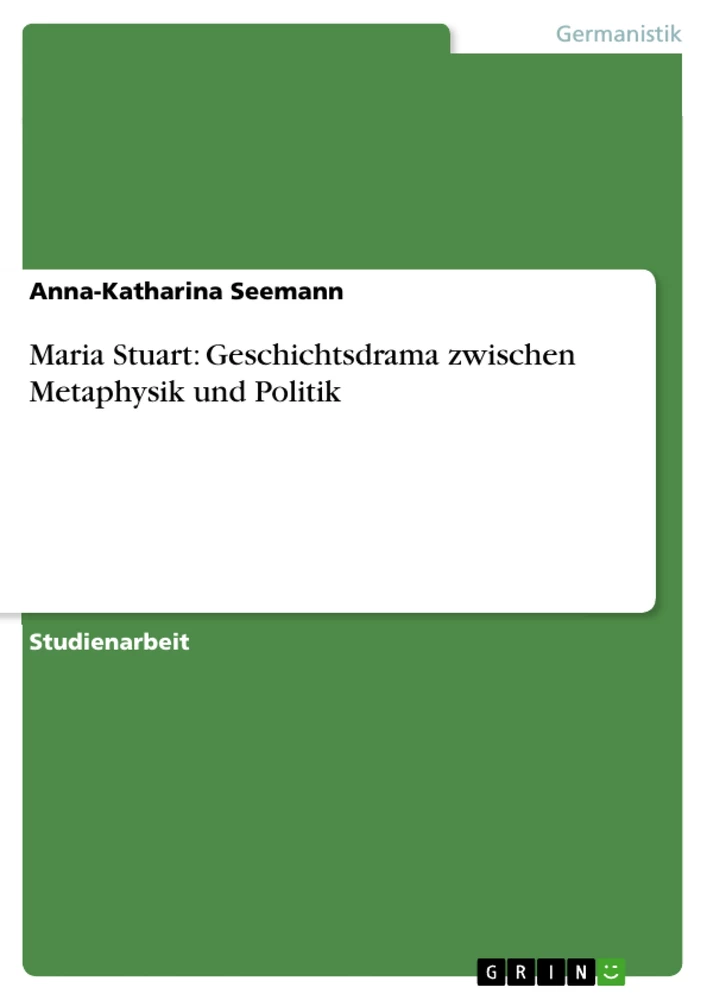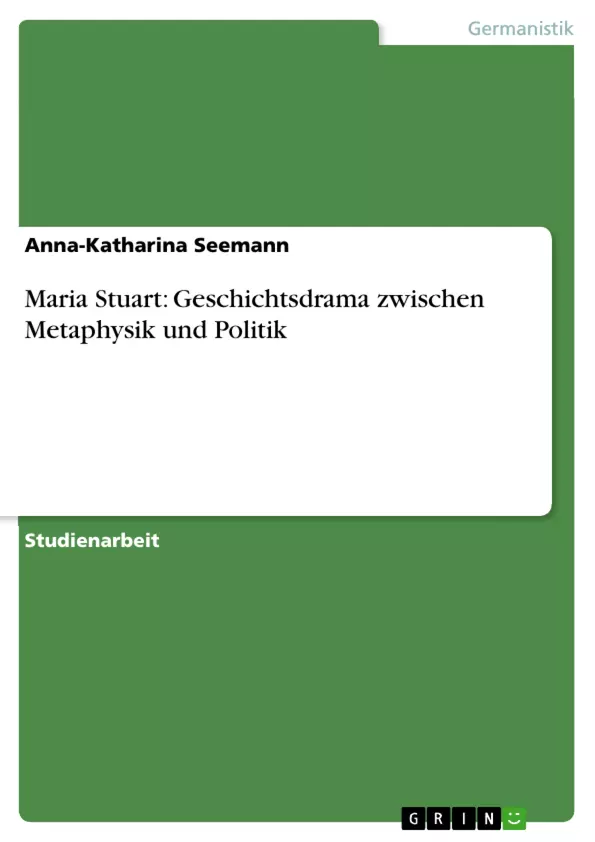Die Wahrheit, die Schiller in diesem Stück vermittelt, besteht aus seiner Philosophie von der „Freiheit“, die im Durchbruch des Erhabenen erlangt wird.
Für dieses Werk der Weimarer Klassik muss man Schillers ästhetische Schriften für die Interpretation heranziehen. Ausgangspunkt seiner Gedanken ist die Enttäuschung über den Umschlag der französischen Revolution in die Schreckensherrschaft. Damit stellt sich für Schiller die Frage, was der Anlass für diesen Umschlag war und wie ein vernünftiger bürgerlicher Staat den dekadenten Feudalstaat ablösen könne, ohne dass Europa „in Barberei und Knechtschaft zurückgeschleudert“ werden würde.
Bei der Frage nach dem Anlass geht er von einer Zerissenheit in Sinn und Geist aus, die zu einem Verlust der Totalität führe, während hingegen bei den Griechen noch Harmonie herrsche, da Einheit von Geist und Sinn noch gegeben.Doch in der Zeit der Moderne sei diese Einheit zerstört und auch der Staat könne dies nicht wieder herstellen, da er gerade auf diese Individualität baut. In der Folge gibt es nur eine Instanz für die Besserung der Menschheit durch die Wiedergewinnung der Harmonie- die Kunst. Als Beweis führt Schiller an, dass die meisten Menschen reiner Vernunft nicht zugänglich sind, da sie „durch Empfindungen zum Handeln bestimmt“ sind. Deshalb müsse „der Weg zum Kopf […] durch das Herz geöffnet werden“.
Durch die Freiheit, die der Mensch in der Kunst erführe, könne er sich grundlegend verändern. Diese Erfahrung der Freiheit ist auf zwei Darstellungsweisen möglich: zum einen durch die Darstellung des Schönen, in der Geist und Sinnlichkeit in der Natur miteinander harmonieren, zum anderen durch die Darstellung des Erhabenen, in welchem der Geist über die Sinnlichkeit „triumphiert“ und sich somit von allen äußerlichen Zwängen und Gewalt frei macht. Auf diese Weise erführe das Individuum, dass Freiheit möglich sei, erlebe selbst für einen Augenblick Freiheit in seinem Sein. Dies könne zur Veränderung in ihm führen.
In "Maria Stuart" führt er genau diese Entwicklung zur Freiheit dem Zuschauer vor Augen.
Maria als authentischer Mensch, findet zu einem selbst bestimmten Leben, nachdem sie alle Fesseln bis hin zur Todesangst abgeworfen hat. Sie gelangt zur Erhabenheit, kann ihre Moralität und Totalität aber nur durch Rückzug in die Innerlichkeit bewahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedrich Schiller im Kontext seiner Zeit
- Schillers Humanitätsideal - seine Philosophie der Freiheit
- Schillers Auffassung von der Natur des Menschen
- Schillers Lehre vom Schönen
- Schillers Lehre vom Erhabenen
- Darstellung des Übersinnlichen als Aufgabe der Kunst
- Anwendung von Schillers Philosophie auf „Maria Stuart“
- Marias Entwicklung zum erhabenen Charakter
- Elisabeth als Beispiel ex negativo des modernen Menschen
- Schillers Geschichtsbild: poetische Wahrheit und historische Wahrheit
- Poetische Wahrheit in „Maria Stuart“
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schillers „Maria Stuart“ im Kontext seiner Zeit und Philosophie. Sie analysiert, wie Schillers Humanitätsideal, sein Freiheitsgedanke und sein Geschichtsbild im Drama umgesetzt werden. Der Fokus liegt auf der Interaktion von metaphysischen und politischen Aspekten im Werk.
- Schillers Zeitlicher und philosophischer Kontext
- Schillers Humanitätsideal und seine Philosophie der Freiheit
- Die Anwendung von Schillers Philosophie in „Maria Stuart“
- Schillers Geschichtsbild und die „poetische Wahrheit“ in seinem Drama
- Kritik am Zeitgeist und der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Gliederung der Arbeit und skizziert die zentralen Fragestellungen. Sie betont die Bedeutung des zeitgeschichtlichen Kontextes und Schillers Philosophie für das Verständnis von „Maria Stuart“. Die Arbeit untersucht, wie Schiller seine theoretischen Überlegungen in der Praxis seines Dramas umsetzt und wie er seine Kritik an seiner Zeit im Werk zum Ausdruck bringt. Der Fokus liegt auf der Analyse von Schillers Geschichtsbild und der von ihm intendierten „poetischen Wahrheit“.
Friedrich Schiller im Kontext seiner Zeit: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Kants Philosophie und der Französischen Revolution auf Schillers Werk. Es analysiert die Ambivalenz Schillers gegenüber der Revolution, seine Akzeptanz der Ziele bei gleichzeitiger Kritik an den Mitteln. Es betont Schillers Krankheit und die daraus resultierende Hinwendung zu philosophischen Schriften. Das Kapitel beleuchtet außerdem Schillers kritische Auseinandersetzung mit der Aufklärung und der modernen Gesellschaft, insbesondere mit ihrem Fokus auf den „Nutzen“ und dem vorherrschenden Egoismus. Schillers frühe Dramen werden als Ausdruck der Krise des moralischen Bewusstseins im Kontext der Aufklärung interpretiert. Die zunehmende Arbeitsteilung und Ausdifferenzierung der Gesellschaft werden als Ursachen für Zerrissenheit und die Abspaltung des Individuums vom Ganzen analysiert, wobei Schillers spezifische Ungleichzeitigkeit in seiner Entwicklung und seine kritische Reflexion etablierter Begriffe hervorgehoben wird. Das Kapitel schließt mit Schillers Aussage, dass der Mensch selbst, nicht der Staat, die Quelle der Kraft und der Schöpfer des Gedankens ist.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Maria Stuart, Geschichtsdrama, Metaphysik, Politik, Humanitätsideal, Philosophie der Freiheit, Aufklärung, Französische Revolution, Poetische Wahrheit, Historische Wahrheit, Zeitkritik, Moderne Gesellschaft, Egoismus.
Häufig gestellte Fragen zu Friedrich Schillers "Maria Stuart"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit zu Friedrich Schillers „Maria Stuart“. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Text dient als Vorabinformation und ermöglicht eine strukturierte Auseinandersetzung mit den zentralen Argumenten der Arbeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert Schillers „Maria Stuart“ im Kontext seiner Zeit und Philosophie. Im Mittelpunkt stehen Schillers Humanitätsideal, sein Freiheitsgedanke, sein Geschichtsbild und deren Umsetzung im Drama. Es wird die Interaktion von metaphysischen und politischen Aspekten untersucht. Weitere Themen sind Schillers Auseinandersetzung mit der Aufklärung, der Französischen Revolution, der Kritik an der modernen Gesellschaft und dem Konzept der „poetischen Wahrheit“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Friedrich Schiller im Kontext seiner Zeit, Schillers Humanitätsideal - seine Philosophie der Freiheit (mit Unterkapiteln zu Schillers Menschenbild, Lehre vom Schönen und Erhabenen, sowie der Darstellung des Übersinnlichen in der Kunst), Anwendung von Schillers Philosophie auf „Maria Stuart“ (mit Unterkapiteln zu Marias Entwicklung und Elisabeth als Beispiel), Schillers Geschichtsbild: poetische Wahrheit und historische Wahrheit (mit Unterkapitel zur Poetischen Wahrheit in „Maria Stuart“) und Konklusion.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Schillers philosophische Überlegungen in seinem Drama „Maria Stuart“ zum Ausdruck kommen und wie er seine Kritik an seiner Zeit im Werk verarbeitet. Der Fokus liegt auf der Analyse von Schillers Geschichtsbild und der von ihm intendierten „poetischen Wahrheit“ im Verhältnis zur historischen Wahrheit. Es wird die Interaktion zwischen metaphysischen und politischen Aspekten in Schillers Werk beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Maria Stuart, Geschichtsdrama, Metaphysik, Politik, Humanitätsideal, Philosophie der Freiheit, Aufklärung, Französische Revolution, Poetische Wahrheit, Historische Wahrheit, Zeitkritik, Moderne Gesellschaft, Egoismus.
Wie wird Schillers Philosophie in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert, wie Schillers Humanitätsideal, seine Philosophie der Freiheit und sein Geschichtsbild in „Maria Stuart“ umgesetzt werden. Sie untersucht beispielsweise Marias Entwicklung zum erhabenen Charakter und stellt Elisabeth als Gegenbeispiel dar. Schillers Kritik am Zeitgeist und der modernen Gesellschaft wird ebenfalls im Kontext seiner Philosophie interpretiert.
Welche Rolle spielt der historische Kontext?
Der historische Kontext, insbesondere der Einfluss von Kants Philosophie und der Französischen Revolution auf Schiller, spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert Schillers ambivalente Haltung zur Revolution, seine Kritik an der Aufklärung und der modernen Gesellschaft, sowie deren Auswirkungen auf sein Werk und seine Figuren.
Was ist mit „poetischer Wahrheit“ gemeint?
Die Arbeit untersucht Schillers Konzept der „poetischen Wahrheit“ im Gegensatz zur „historischen Wahrheit“. Es wird analysiert, wie Schiller seine theoretischen Überlegungen in der Praxis seines Dramas umsetzt und wie er seine „poetische Wahrheit“ als Mittel der Kritik und der Darstellung seiner philosophischen Ideen nutzt.
- Quote paper
- Anna-Katharina Seemann (Author), 2006, Maria Stuart: Geschichtsdrama zwischen Metaphysik und Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67331