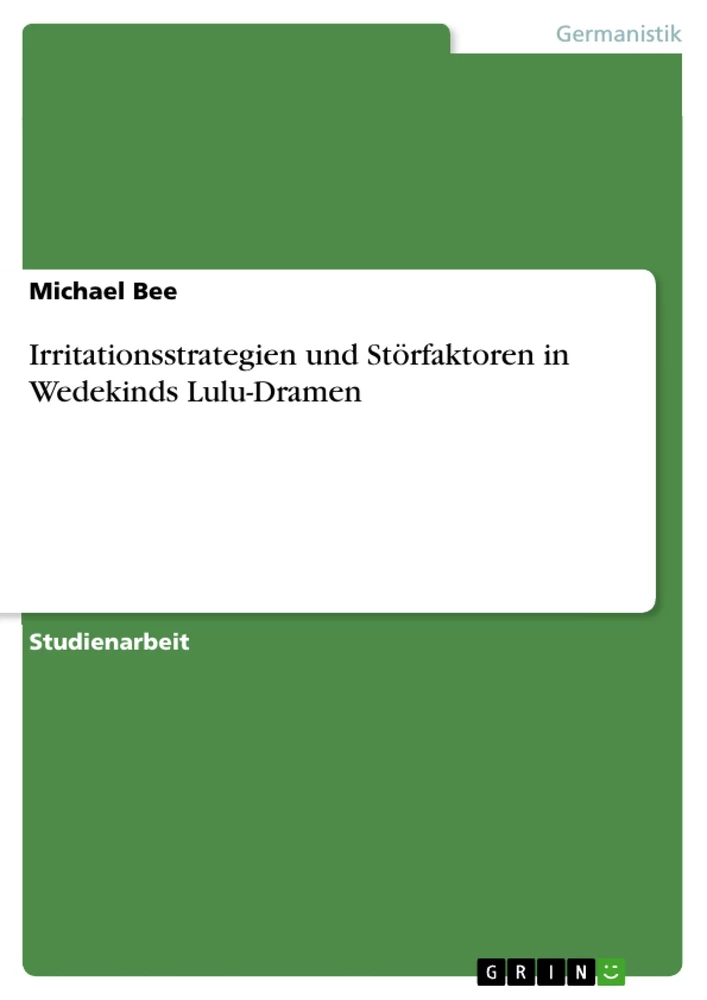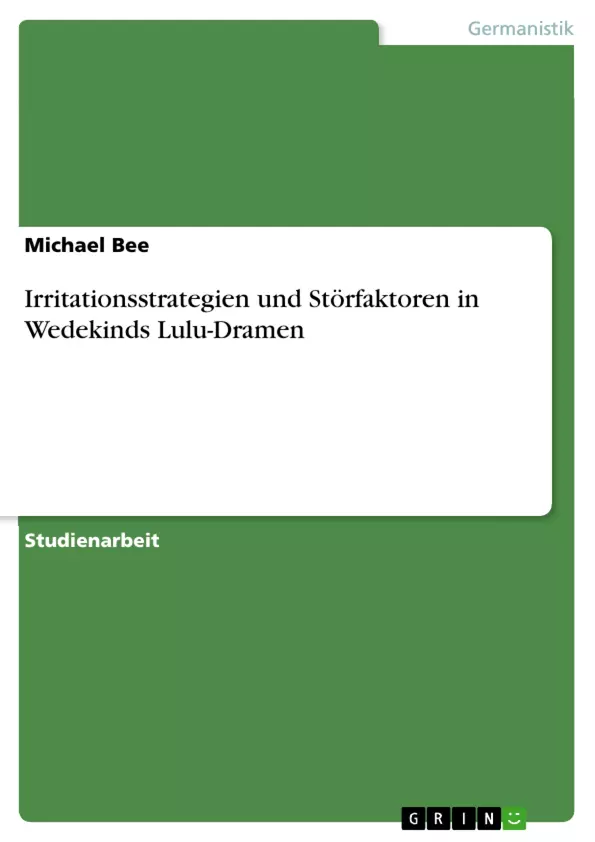Die hochgradige Artifizialität der Lulu-Tragödie ist von Wedekind-Philologen, die sich einer forcierten Lektüre verschrieben haben, in den letzten drei Jahrzehnten vielfach hervorgehoben worden. Von „Leerstelle“, „weiße[r] Fläche“ oder „Spiegel männlicher Weiblichkeitsbilder“ ist die Rede, wenn die Protagonistin der beiden Dramen in den Blick gerückt wird. Solche ‚offenen Lesarten’ markieren eine vehemente Abwehrhaltung gegenüber Interpretationen, die in der Figur der Lulu wahlweise eine „Femme fatale“ und „Hetäre“, ein Opfer des wilhelminischen Patriarchats, eine Vorreiterin weiblicher Emanzipation oder eine „Trägerin einer allgemein- menschlichen Moral“ sehen wollen. Denn die „auf Abgeschlossenheit und Endgültigkeit insistierenden Interpretationen ignorieren, indem sie die Figur eindeutig festlegen wollen, die Gebrochenheit, in der die konventionalisierten Bilder des Weiblichen im Stück präsentiert werden.“
Die Vorteile dieser vornehmlich feministisch geprägten Herangehensweise liegen auf der Hand: Die genuin hermeneutische Kategorie der psychologischen Wahrscheinlichkeit verliert an Relevanz, während die Modernität des Textes, seine fragmentarische Struktur und Inkohärenz fokussiert werden kann. Gleichwohl ist den genannten Untersuchungen gemein, dass das Thema der Sexualität bisweilen strapaziert wird. Selbstverständlich nimmt Lulus sinnliche Weiblichkeit – ihre Promiskuität, ihre unkontrollierten Triebe, ihr laszives Spiel mit ihren Liebhabern - eine prominente Position innerhalb des Dramas ein. Eine Reduktion des Textes auf diese Elemente unterschlägt jedoch weitgehend, dass plot, Figuration und einzelne Handlungselemente in ähnlicher Weise unbestimmt bleiben und erst in ihrer Ambivalenz angemessen zu verstehen sind.
Ich möchte in dieser Hausarbeit versuchen, einige dieser ‚strukturellen Leerstellen’ offen zu legen und ihre Produktivität für die Rezeption des Dramas darzustellen. Dieser Fragestellung liegt die Annahme zugrunde, dass der Autor Strategien der Irritation und Störung verwendet, welche Erwartungshaltung und Hypothesenbildung des Rezipienten bewusst unterlaufen.8 Gleichermaßen soll gezeigt werden, in wie weit diese Irritationsstrategien die Oppositionshaltung Frank Wedekinds gegenüber naturalistischer Dramentheorie- und praxis konstituieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Produktivität,struktureller Leerstellen'
- I. Zur Modernität der verschiedenen Textstufen
- II. Der Prolog des Erdgeist
- 1. Irritierende Selbstverständlichkeiten
- 2. Der Zuschauer als Raubtier
- 3. Naturalistische Dramentheorien als Kontrastfolie
- III. Irritation und Störung
- 1. Defizitäre Informationsvergabe
- 2. Väter und Geliebte: Beispiele unaufgelöster Leerstellen
- IV. Schluss: Lulu und Fin de Siècle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Lulu-Dramen von Frank Wedekind und untersucht die darin enthaltenen Irritationsstrategien und Störfaktoren. Im Mittelpunkt stehen dabei die „strukturellen Leerstellen" des Textes und ihre Produktivität für die Rezeption. Darüber hinaus wird die Beziehung Wedekinds zur naturalistischen Dramentheorie beleuchtet und analysiert, inwieweit seine Irritationsstrategien eine Opposition gegen diese darstellen.
- Die Produktivität "struktureller Leerstellen" in den Lulu-Dramen
- Irritationsstrategien und Störfaktoren als bewusstes Unterlaufen von Erwartungen
- Die Opposition Wedekinds gegenüber naturalistischen Dramentheorien
- Die Modernität der verschiedenen Textfassungen der Lulu-Dramen
- Die Bedeutung der Sexualität in den Dramen und ihre Ambivalenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik „struktureller Leerstellen" in den Lulu-Dramen von Frank Wedekind vor und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel I beleuchtet die Modernität der verschiedenen Textfassungen der Lulu-Dramen und geht dabei auf die Kritik ein, die an den späteren Versionen, insbesondere in Bezug auf die Reduktion des Provokationspotentials, geäußert wird. Kapitel II analysiert den Erdgeist-Prolog im Hinblick auf die darin enthaltenen Textsignale, den Status des Zuschauers/Lesers und die Kontrastierung zur zeitgenössischen naturalistischen Dramentheorie. Kapitel III zeigt anhand von zentralen Beispielen die "strukturellen Leerstellen" in beiden Dramen auf und diskutiert, ob diese zu einer Auflösung von Kohärenz führen oder ob trotz Ambivalenzen eine Festlegung möglich bleibt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Frank Wedekind, Lulu-Dramen, Irritationsstrategien, Störfaktoren, "strukturelle Leerstellen", Modernität, Naturalismus, Dramentheorie, Sexualität, Ambivalenz, Rezeption und Interpretation. Die Arbeit analysiert insbesondere die Lulu-Dramen "Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora" und untersucht die Produktivität der offenen Stellen im Text für die Leserschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „strukturelle Leerstellen“ in Wedekinds Lulu-Dramen?
Es sind bewusste Unbestimmtheiten im Text, die Interpretationen offen lassen und den Zuschauer zur eigenen Hypothesenbildung zwingen.
Wie grenzt sich Wedekind vom Naturalismus ab?
Durch Irritationsstrategien und die Abkehr von psychologischer Wahrscheinlichkeit widersetzt er sich der naturalistisch-mimetischen Dramenpraxis.
Welche Rolle spielt die Sexualität in den Lulu-Dramen?
Lulus Promiskuität und Sinnlichkeit sind zentral, werden aber in der Arbeit als Teil einer umfassenderen Ambivalenz und Gebrochenheit weiblicher Bilder gesehen.
Was symbolisiert der „Prolog des Erdgeists“?
Er inszeniert den Zuschauer als Raubtier und bricht mit konventionellen Theatererwartungen durch irritierende Selbstverständlichkeiten.
Welche zwei Dramen bilden die „Lulu-Tragödie“?
Die Tragödie besteht aus den Dramen „Erdgeist“ und „Die Büchse der Pandora“.
- Quote paper
- Michael Bee (Author), 2007, Irritationsstrategien und Störfaktoren in Wedekinds Lulu-Dramen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67415