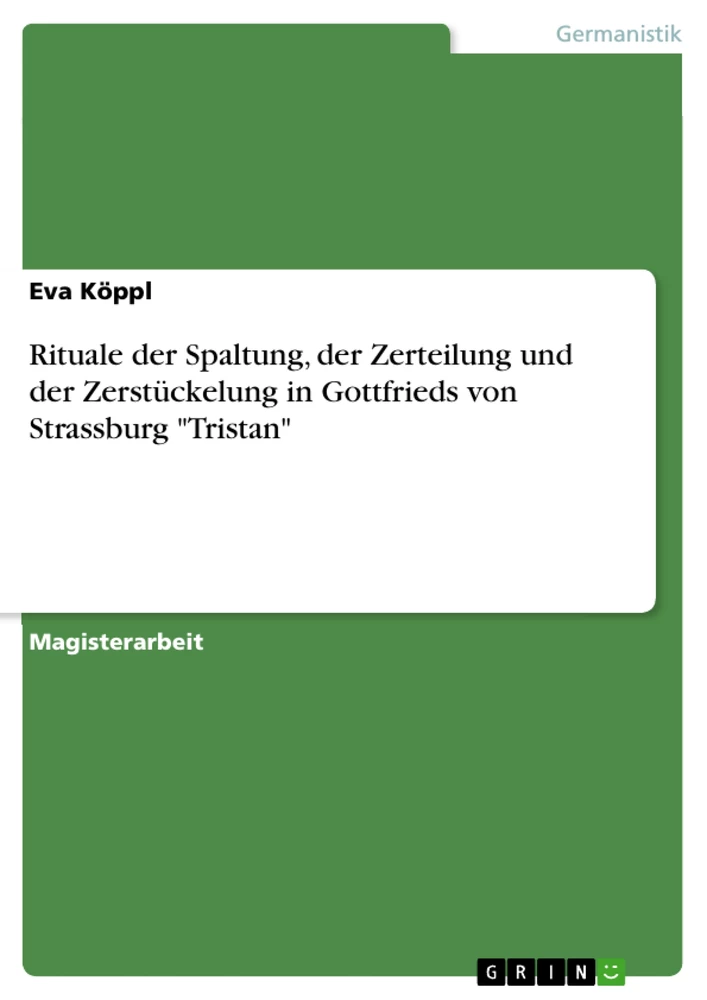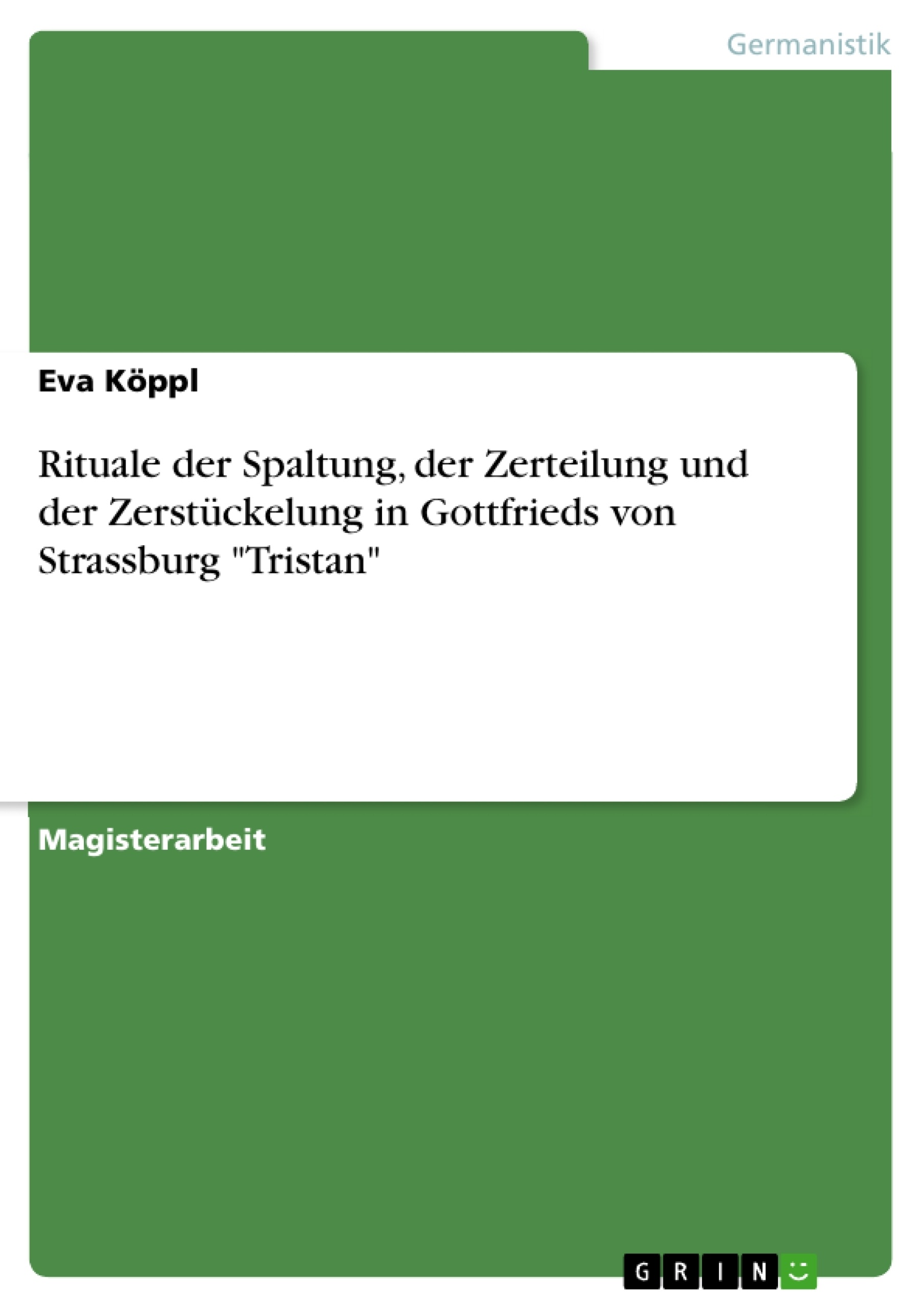Zu Gottfrieds von Strassburg um 1210 entstandenem Versroman-Fragment Tristan,einem der Hauptwerke der mittelalterlichen Hochepik, gestalten sich die Interpretationsansätze inzwischen derart komplex, dass ein Konsensus in der Forschung als unerreichbar gilt. Dies mag kaum verwundern, zumal die Widersprüchlichkeit des Werkes und seine gleichzeitige Vielgestaltigkeit als eines seiner Hauptcharakteristika zu bezeichnen sind. So wird Gottfrieds Roman, der gemeinhin als der richtungsweisende Liebesroman des Mittelalters gehandelt wird, unter anderem auch als Künstlerroman interpretiert. Der in ihm geführte Diskurs über Bildung ist für den Handlungsverlauf von Relevanz, und manche Forscher entdecken für das Werk die (auch strukturelle) Bedeutung der Musik. In der Tat ist seine ästhetische Seite ebenso bedeutsam wie die ethisch-moralische.
Vor allem die ältere Forschung widmete sich ausgiebig der Auseinandersetzung mit irokeltischen, kymrischen und piktischen Paralleltexten, aber auch mit orientalischen Einflüssen. Gottfrieds mögliche Affinität zu Strömungen wie dem Katharertum und dem Neoplatonismus und ihre Wirkung auf den Roman wird in der Sekundärliteratur ebenso diskutiert wie Bezüge zu antikem Denken und Implikationen aus dem religiösen und geistlichen Diskurs seiner Zeit. Was für einzelne Romangestalten oder Motive gilt, ist häufig auch bezüglich der Gesamtstruktur des Tristan relevant: Verschiedene Folien scheinen quasi übereinander projiziert und liefern eine eigene Form der „Illumination“ bzw. eine spezielle ästhetische Mischfärbung. Sie spiegeln eine Vielzahl von Quellen bzw. im Roman verarbeitete Diskurse, die sich unter der Hand des Dichters zu einer neuen, heterogenen Einheit formieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Uneinheitlichkeit als strukturelles Merkmal
- Rituelle Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung in Gottfrieds Tristan
- Verwendete Forschungsliteratur
- Einbeziehung verwandter Fassungen
- Ritualtheorien
- Anmerkungen zum Thema Ritual
- Das Ritual als Mittel, um Unkontrollierbares unter Kontrolle zu bringen
- van Genneps Stufenmodell des rite de passage und Turners Thesen zum Schwellenreich
- Zum Initiationsritus
- Der Initiationsritus als Übergangsphänomen
- Initiation im Hochmittelalter
- Initiatorischer Tod, Zerstückelung und Wiedergeburt in der Mythologie
- Allgemeine Überlegungen zu Ritual und Spaltung in Gottfrieds Tristan
- Die Präsenz von Ritualen in der Literatur des Mittelalters
- Tod, Spaltung und „Wiedergeburt“ als textstrukturierende Elemente
- Entwicklungsweg, Initiations- und Übergangsriten in Gottfrieds Tristan
- Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung als rituelle Formen in Bastritual und Moroldkampf
- Ritual, Spaltung und Zerstückelung im Moroldkampf
- Die Bedeutung des Moroldkampfes im Werk
- Der Moroldkampf und die „militärische Initiation“
- Kennzeichen militärischer Initiationsformen nach Eliade
- Das liminale Setting des Moroldkampfes
- Heilige Hitze und hitzige Wut
- Magische Hitze und die symbolische Aneignung der Kräfte eines wilden Tieres - die Ebersymbolik
- Der Kampf ganzer Heere als Kennzeichen der militärischen Initiationsform
- Sakrale Führung und rechtliche Fixierung
- Fazit zu Elementen der militärischen Initiationsform im Moroldkampf
- Indexikalität, Ästhetik, Stellvertreterkampf und gender
- Indexikalität und gender: Rituelle Funktionen des Moroldkampfes nach den Theorien von Rappaport, Laqueur und Geertz
- Zerstückelung des Körpers und des Panzers im Moroldkampf und der rituelle Akt der Determinierung von „gender“
- Zusammenfassung: Veränderung der Wertigkeit - die Diskursivität der sakralen Mächte und die Konstruktion von Männlichkeit im Stellvertreterkampf
- Die Funktion von Ästhetik bei der Einkleidung und Ausrüstung Tristans und die Sprengung des künstlichen Panzers
- Exkurs I: Heilung von den Wunden und der Prozess der Entfragmentierung als Gegenprinzip der Spaltung
- Spaltung und Zerteilung im Bastritual
- Das Bastritual und seine rituellen Funktionen
- Die Signifikanz des Bastrituals als Ritual der Zerteilung und Spaltung
- Liminale Ausgangssituation: Zur Vorgeschichte des Bastrituals
- Zeigen geht vor Erklären: Der Bast als performatives Ritual der Spaltung und Zerteilung und die Vermittlung von Können und Wissen
- Bast als Enthäutung und Enthüllung; Entkleiden und Bekleiden
- Tristans Vorgehen und seine rituelle Bedeutung
- Der Bast als Teilritual: Zerteilung eines Lebewesens als Performance
- Die Furkie. Überhöhung, symbolische Kastration und rituelle Verschleierung
- Die Curie: Symbolisches Verwerfen und Arrangement des „Minderwertigen“
- Die Semantik des prîsant; symbolisches Wieder-Zusammensetzen des Zerteilten
- Sakrales und initiatorisches Opfer und der Bast
- Zerteilung, initiatorisches Opfer und Transformation im Bastritual
- Sakralität und Gemeinschaftsopfer: Brotmetapher und Bastritual im Vergleich
- Mythologisches Opfer und Initiation. Zum mythischen Bild des Gespaltenseins und der Zerstückelung. Dionysos und andere zerstückelte Gottheiten als liminale Gestalten und rituelle Opferhelden und Gottfrieds Tristan
- „Gläubige“ Reaktion und Mythosanalogie in der Bastszene
- Gruppenbildung und Nahrungskommunikation
- Gruppenbildung und rituelle Gesichtspunkte der Nahrungsaufnahme und des Opferungs-mythos im Zusammenhang mit Zerteilung und Synthese
- Das Jagdmotiv und der Aspekt der Nahrungskommunikation
- Transsubstantiation und symbolisches Mahl. Die Mysterien der Nahrungsaufnahme und die Naturphilosophie
- Der Nahrungszirkel und seine Analogien zum initiatorischen Opferritual
- Archaische und mythische Jagd und die Performance der Zerteilung. Paradigmenwechsel in der Semantik des Hirschen und seiner Mittlerfunktion und die Bezüge zu Gottfrieds Tristan
- Bast, Sezierung, Analyse und Wissenschaft. Die sezierende „Analyse“ der Teile und das Ganze
- Zusammenfassung und Ergänzungen zu ritueller Verschleierung und Bewältigung des Unwägbaren
- Euphemistische Sprache und rituelle Elemente im Bastritual
- Bewältigung von Unwägbarem in der „royal procession“
- Dramatisierung der Konflikte: Deep play von Clifford Geertz in Bastritual und Moroldkampf
- Fazit: Vergleich zwischen ritueller Spaltung/Zerteilung/Zerstückelung in Moroldkampf und Bastritual
- Exkurs II
- Synthese, Verschmelzung und Vereinigung in der Minnegrotten-Episode
- Die „Erlebnisstruktur“ der Grotte als symbolischem Ort der Minne
- Die Bedeutung der Höhlen- und Grottensymbolik für initiatorische Themen und Gottfrieds Minnegrotte
- Einheit und Verschmelzung als initiatorisches Thema und der Ort die Grotte als Minneort. Rundheit und Geschlossenheit, Uterus und Urorobus
- Einfachheit und Einheitlichkeit
- Fazit: Verschmelzung und Zerteilung: Bastritual und Minnegrotten-Episode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ritualisierten Formen der Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung in Gottfried von Straßburgs „Tristan“. Ziel ist es, die Bedeutung dieser rituellen Elemente für die Struktur und die Interpretation des Werkes aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf die literarische Darstellung von Ritualen und deren Funktion im Kontext des mittelalterlichen Weltbildes.
- Rituale als strukturierende Elemente in Gottfrieds „Tristan“
- Initiationsriten und Übergangsrituale im Werk
- Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung als rituelle Formen
- Bedeutung der Symbolik und der rituellen Handlungen
- Vergleich verschiedener ritueller Szenen (Moroldkampf, Bastritual)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Komplexität der Interpretationsansätze zu Gottfrieds „Tristan“. Sie hebt die Uneinheitlichkeit des Werkes als zentrales Merkmal hervor und diskutiert verschiedene Interpretationsansätze, die den Roman als Liebesroman, Künstlerroman oder Werk mit musikalischer Bedeutung betrachten. Die Arbeit konzentriert sich auf die literarischen Repräsentationsformen von Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung im Kontext der Uneinheitlichkeit des Werkes.
Ritualtheorien: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ritualtheorien, beginnend mit allgemeinen Anmerkungen zum Thema Ritual. Es analysiert das Ritual als Mittel zur Kontrolle des Unkontrollierbaren und untersucht van Genneps Stufenmodell des rite de passage sowie Turners Thesen zum Schwellenreich (liminal space). Der Fokus liegt auf dem Initiationsritus als Übergangsphänomen, besonders im Hochmittelalter, und dessen Verbindung zu Motiven wie initiatorischem Tod, Zerstückelung und Wiedergeburt in der Mythologie. Das Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse der rituellen Elemente in Gottfrieds „Tristan“.
Allgemeine Überlegungen zu Ritual und Spaltung in Gottfrieds Tristan: Dieses Kapitel diskutiert die Präsenz von Ritualen in der mittelalterlichen Literatur und analysiert Tod, Spaltung und „Wiedergeburt“ als textstrukturierende Elemente in Gottfrieds „Tristan“. Es untersucht Entwicklungsweg, Initiations- und Übergangsriten und beschreibt Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung als rituelle Formen im Bastritual und im Moroldkampf. Der Abschnitt legt die Verbindung zwischen den theoretischen Grundlagen und der konkreten Analyse im „Tristan“ dar.
Ritual, Spaltung und Zerstückelung im Moroldkampf: Dieses Kapitel analysiert den Moroldkampf als militärischen Initiationsritus, indem es die Bedeutung des Kampfes im Werk, seine Kennzeichen und das liminale Setting untersucht. Es werden Elemente wie heilige und magische Hitze, die symbolische Aneignung der Kräfte eines wilden Tieres (Ebersymbolik), der Kampf ganzer Heere und die sakrale Führung und rechtliche Fixierung als charakteristische Merkmale militärischer Initiationsformen nach Eliade betrachtet. Der Exkurs I befasst sich mit der Heilung von Wunden und der Entfragmentierung als Gegenprinzip zur Spaltung.
Spaltung und Zerteilung im Bastritual: Das Kapitel untersucht das Bastritual und seine rituellen Funktionen, analysiert die Bedeutung des Bastrituals als Ritual der Zerteilung und Spaltung, und betrachtet Tristans Vorgehen und seine rituelle Bedeutung. Es untersucht Aspekte wie symbolische Kastration, rituelle Verschleierung, Opfer, Transformation und die Bedeutung der Nahrungskommunikation und Jagdmotive im Kontext des Rituals. Die Rolle des Bastrituals als performatives Ritual der Spaltung und Zerteilung wird analysiert, ebenso wie die "sezierende Analyse" der Teile und des Ganzen. Exkurs II behandelt die Synthese, Verschmelzung und Vereinigung in der Minnegrotten-Episode.
Schlüsselwörter
Gottfried von Straßburg, Tristan, Ritual, Spaltung, Zerteilung, Zerstückelung, Initiationsritus, Übergangsritus, Moroldkampf, Bastritual, Minne, Mittelalter, Literatur, Symbol, Mythologie, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ritualisierte Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung in Gottfrieds Tristan
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ritualisierten Formen der Spaltung, Zerteilung und Zerstückelung in Gottfried von Straßburgs „Tristan“ und deren Bedeutung für die Struktur und Interpretation des Werks. Der Fokus liegt auf der literarischen Darstellung von Ritualen und deren Funktion im Kontext des mittelalterlichen Weltbildes.
Welche konkreten rituellen Szenen werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf zwei zentrale Szenen: den Moroldkampf und das Bastritual. Diese werden als militärischer bzw. initiatischer Ritus untersucht.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Ritualtheorien, insbesondere van Genneps Stufenmodell des rite de passage und Turners Thesen zum Schwellenreich (liminal space). Weitere relevante Theorien von Eliade, Rappaport, Laqueur und Geertz werden einbezogen, um die rituellen Aspekte im Kontext von Gender, Indexikalität und Ästhetik zu beleuchten.
Wie wird der Moroldkampf interpretiert?
Der Moroldkampf wird als militärischer Initiationsritus analysiert. Untersucht werden Kennzeichen wie das liminale Setting, heilige und magische Hitze, die Ebersymbolik, der Kampf ganzer Heere, sakrale Führung und rechtliche Fixierung. Die Heilung von Wunden und die Entfragmentierung werden als Gegenprinzip zur Spaltung betrachtet.
Wie wird das Bastritual interpretiert?
Das Bastritual wird als initiatisches Opferritual und performatives Ritual der Spaltung und Zerteilung analysiert. Es werden Aspekte wie symbolische Kastration, rituelle Verschleierung, Opfer, Transformation und die Bedeutung der Nahrungskommunikation und Jagdmotive untersucht. Die "sezierende Analyse" der Teile und des Ganzen spielt eine wichtige Rolle.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Neben den Hauptanalysen des Moroldkampfes und des Bastrituals werden auch die Minnegrotten-Episode (als Gegenstück zur Spaltung) und die Bedeutung von Symbolen wie dem Bast, dem Eber und der Grotte im Kontext von Initiation und Transformation untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Ritualtheorien, ein Kapitel zu allgemeinen Überlegungen zu Ritual und Spaltung in Gottfrieds Tristan, Kapitel zu den Einzelanalysen des Moroldkampfes und des Bastrituals, ein Fazit und zwei Exkurse (Heilung/Entfragmentierung und die Minnegrotten-Episode).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Gottfried von Straßburg, Tristan, Ritual, Spaltung, Zerteilung, Zerstückelung, Initiationsritus, Übergangsritus, Moroldkampf, Bastritual, Minne, Mittelalter, Literatur, Symbol, Mythologie, Interpretation.
Wo finde ich die detaillierte Inhaltsangabe?
Die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, das alle Unterkapitel und Unterpunkte auflistet.
- Arbeit zitieren
- Eva Köppl (Autor:in), 2006, Rituale der Spaltung, der Zerteilung und der Zerstückelung in Gottfrieds von Strassburg "Tristan", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67429