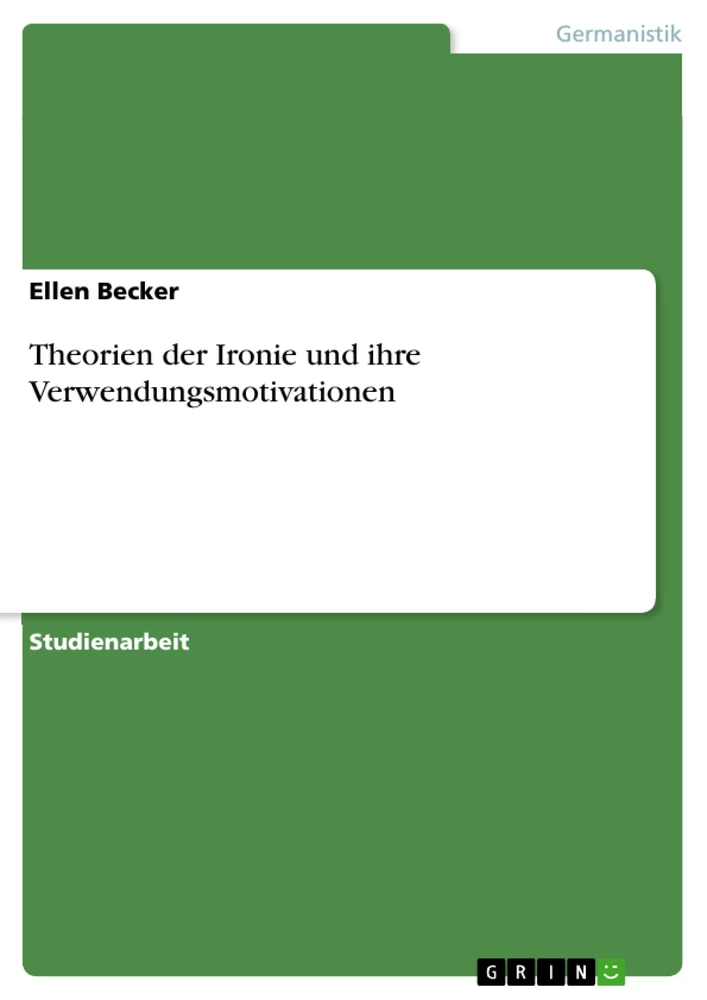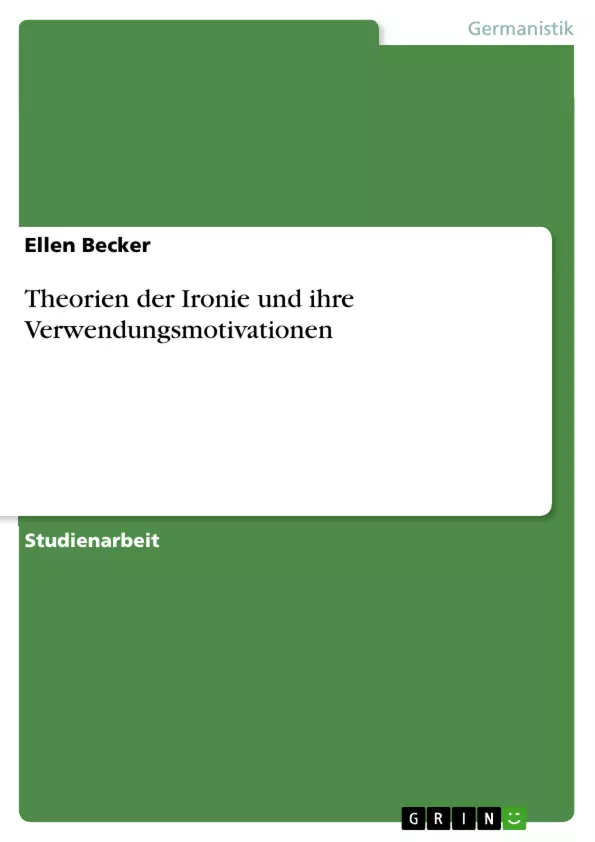„Grundsätzlich gehört die Fähigkeit zur ironischen Verwendung von Sprache zu den Möglichkeiten jedes Sprechers. Ebenso ist grundsätzlich jeder fähig, Ironie zu erkennen.“ (Gießmann 1977:420)
Wie das Zitat richtig zeigt, hat jeder Sprecher die Möglichkeit sich ironisch zu äußern. Sprecher benutzen und Hörer verstehen Ironie meist intuitiv, welche komplexen Strukturen jedoch dahinter stecken, ist weder leicht zu durchschauen noch einfach zu erklären. Es drängen sich einige Fragen auf:
Was genau ist Ironie? Wie wird Ironie überhaupt verbalisiert und wie wird sie verstanden? Warum setzt sich ein Sprecher der Gefahr aus, missverstanden zu werden, denn das kommt durchaus vor? Warum sagt man etwas indirekt, wenn es auch direkt geht, dies entspricht nicht der Sprachökonomie? In welchen Fällen bzw. Situationen kommt Ironie zum Ausdruck? Diese Fragen sollen hier geklärt werden.
Zunächst wird kurz der Bereich der Rhetorik dargestellt. Schon früh befasste sich z.B. Aristoteles mit dem Phänomen der Ironie und mit dem was sich dahinter verbirgt. Sie wurde als Stilmittel in öffentlichen Auseinandersetzungen bzw. Reden eingesetzt, um den Gegner bloßzustellen oder um die eigene Aussage zu pointieren.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch auf den linguistischen Ironietheorien. Sie sollen klären, was Ironie ist, wie sie demnach erklärt werden kann. Die hier erwähnten Autoren versuchen sich an einer Rahmentheorie, die, wie man sehen wird, nicht einfach zu fassen ist. Des Weiteren soll es darum gehen, wie Hörer ironische Äußerungen verstehen, denn es gilt eine Unterscheidung zwischen Gesagtem und Gemeintem zu machen. Wie kommen Hörer dazu, das Gemeinte als das Eigentliche zu verstehen?
In Kapitel 4 werde ich zudem einige Verwendungsmotivationen für ironische Äußerungen vorstellen, die, wie ich finde, als Hauptgründe gelten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Hintergrund
- Rhetorik
- Ironietheorien
- Implikaturtheorie
- Konversationsmaximen von Grice
- Generelle und partikuläre Implikaturen
- Ironie als konversationelle partikuläre Implikatur
- Ironie als Echo und Zitat
- Sprechakttheoretische Modelle
- Ironie als Sprechakt
- Ironie als indirekter Sprechakt
- Ironie als uneigentlicher Sprechakt
- Fazit
- Implikaturtheorie
- Die Verwendungsmotivationen von Ironie
- (Un-)Höflichkeit
- Bewertung
- Ästhetischer Humor
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Phänomen der Ironie aus linguistischer Perspektive. Sie befasst sich mit verschiedenen Theorien der Ironie und deren Erklärungen, wie Ironie verbalisiert und verstanden wird. Die Arbeit untersucht die Frage, warum Sprecher sich trotz der Gefahr des Missverständnisses für ironische Äußerungen entscheiden, anstatt die Sache direkt anzusprechen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Verwendungsmotivationen für ironische Äußerungen untersucht, um ein besseres Verständnis des sprachlichen Phänomens Ironie zu erlangen.
- Die verschiedenen linguistischen Ironietheorien und deren Verhältnis zueinander
- Die Erklärung von Ironie als konversationelle Implikatur und Sprechakt
- Die Rolle von Kontext und Hörerinterpretation bei der Rezeption ironischer Äußerungen
- Die verschiedenen Verwendungsmotivationen für Ironie, wie z.B. Höflichkeit, Kritik und Humor
- Die Bedeutung der Ironie als sprachliches Phänomen im alltäglichen Sprachgebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt das Thema Ironie ein und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von Ironie im Sprachgebrauch und die Komplexität ihrer Strukturen.
Historischer Hintergrund: Dieser Abschnitt beleuchtet die historischen Wurzeln der Ironie in der Rhetorik, wobei die Entwicklung des Konzepts von der antiken bis zur modernen Zeit verfolgt wird. Besondere Aufmerksamkeit wird der Bedeutung von Ironie als Stilmittel in öffentlichen Auseinandersetzungen gewidmet.
Ironietheorien: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Theorien der Ironie, die von der Implikaturtheorie nach Paul Grice über die Echo-Zitat-Theorie bis hin zu sprechakttheoretischen Modellen reichen. Die unterschiedlichen Ansätze werden vorgestellt und miteinander verglichen.
Die Verwendungsmotivationen von Ironie: Dieser Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Gründe, warum Sprecher sich für Ironie entscheiden. Es werden verschiedene Motivationen wie (Un-)Höflichkeit, Bewertung und ästhetischer Humor untersucht.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf die linguistische Analyse des Phänomens Ironie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Ironie, Implikatur, Sprechakttheorie, Konversationsmaximen, Verwendungsmotivationen, Höflichkeit, Kritik, Humor, Sprache, Kommunikation.
- Quote paper
- Ellen Becker (Author), 2005, Theorien der Ironie und ihre Verwendungsmotivationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67436