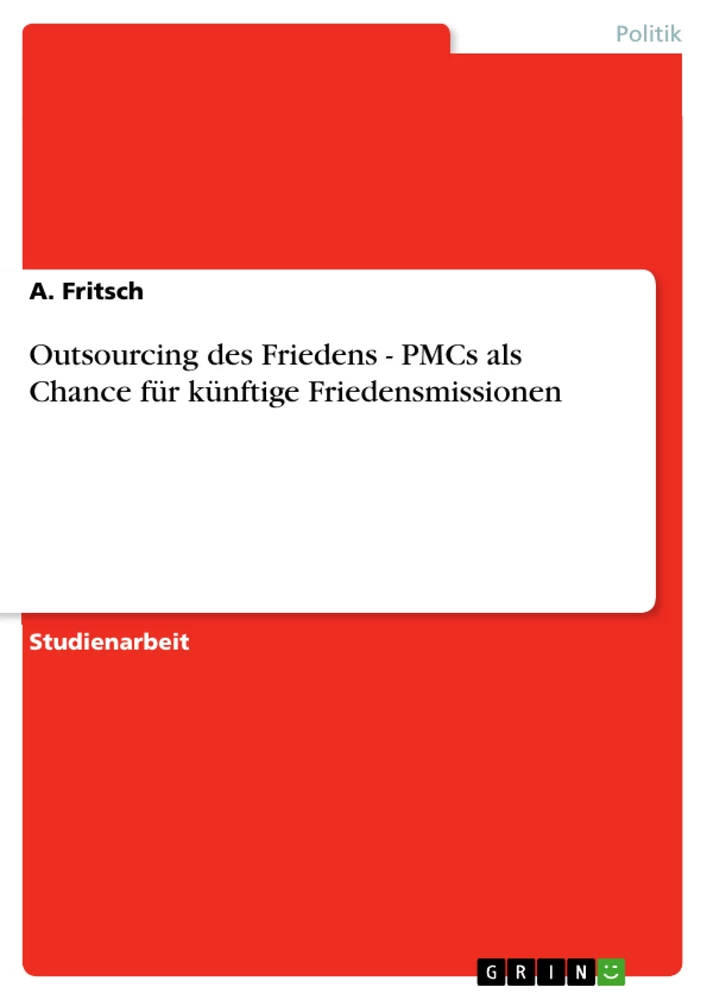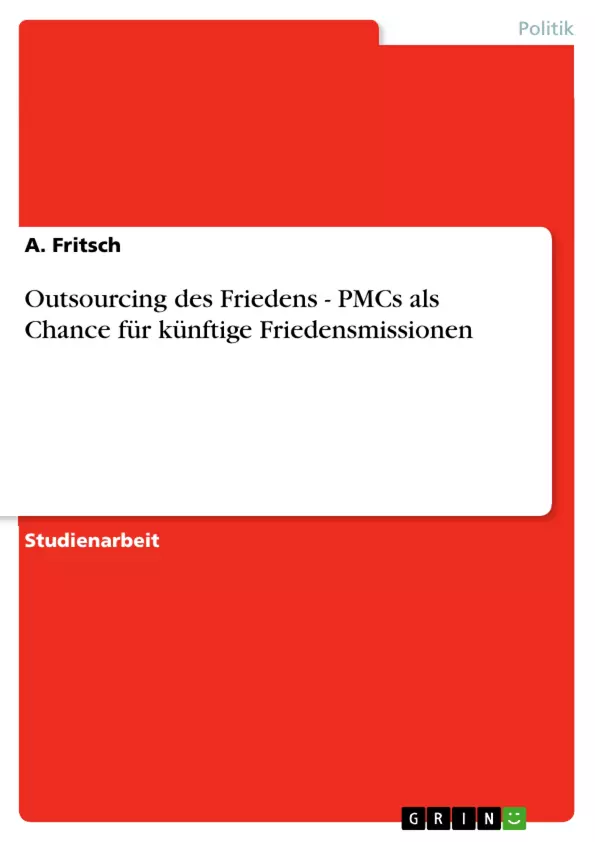Im Jahr 2005 gab es 249 politische Konflikte, wovon 74 vom Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung (HIIK) als Krisen mit sporadischem Gewalteinsatz und 24 als echte Konflikte mit massivem Gewalteinsatz klassifiziert werden.
Es liegt auf der Hand, dass sich eine Organisation, die als Zusammenschluss von Nationalstaaten gegründet wurde, um die Menschheit „von der Geißel des Kriegs“ zu befreien, angesichts dieser Situation einige Fragen über Zukunftsperspektiven stellen muss und das auch getan hat.
In unterschiedlichen Analysen taucht hierbei die Frage, wie mit privaten Militärfirmen umzugehen ist, ob sie als moderne Söldner abzustempeln sind, oder als aktive Partner bei der Bewältigung humanitärer Einsätze, immer wieder auf.
Nach dem Reformvorstoß des ehemaligen UN-Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali in seiner „Agenda for peace“ wurden die Reformansätze nach den Misserfolgen in Ruanda und Somalia zunehmend realistischer und verfolgten eine Politik der kleinen Schritte.
Die beim Völkermord in Ruanda vom damals zuständigen stellvertretenden UN-Generalsekretär Kofi Anan abgegebene Erklärung ließ aufhorchen: “Als wir kampferprobte Soldaten brauchten, um Kombattanten und Flüchtlinge voneinander zu trennen, habe ich die Möglichkeit erwogen, eine Privatfirma zu engagieren. Aber vielleicht ist die Welt noch nicht bereit dazu, den Frieden zu privatisieren" .
Die Präsenz der PMCs ist im Bereich aktiver militärischer Einflussnahmen in den letzten Jahren zurückgegangen und hat sich zunehmend auf den Bereich logistischer Dienste konzentriert. Dennoch ist ihr militärisches Potenzial für internationale Organisationen nicht zu unterschätzen, wie das Angebot der Northbridge Services Group Anfang des Jahres 2003 über die Ergreifung des liberischen Präsidenten und Kriegsverbrechers Charles Taylor deutlich macht.
Die Frage über den Einsatz von PMCs bei Friedensmissionen auch im Bereich des peace-enforcement ist also keineswegs geklärt und weiterhin von Brisanz. Ich widme mich in dieser Arbeit der Frage, welchen Beitrag diese Firmen in Zukunft im internationalen Konfliktmanagement leisten können, und wie sie vielleicht einige der zentralen Probleme der bei der Jubiläumsfeier 1995 als „erfolgreiche Organisation mit Reformbedarf“ charakterisierten UNO lösen könnten. Der Fokus liegt bei militärischen Dienstleistungen, da logistische Unterstützung sowie Training und Ausbildungsaufträge bereits fester Bestandteil von UN-Einsätzen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Struktur und Vorgehensweise
- 3. Die Problematik internationaler Einsätze unter UN-Mandat
- 3.1. Fehlendes Gewaltmonopol
- 3.2. Unklares Mandat
- 3.3. Trägheit bei Entscheidungen u. deren Umsetzung
- 3.4. Abhängigkeit von den Nationalstaaten
- 3.4.1. Finanzierung
- 3.4.2. Truppenstellung
- 3.4.3. Kommandostrukturen
- 4. Das Desaster einer humanitären Intervention unter Kommando der Vereinten Nationen (UNISOM I und UNITAF bzw. UNISOM II)
- 4.1. Chronologie
- 4.2. Welche Probleme traten zutage?
- 5. PMCs als Lösung?
- 5.1. Welche Vorteile sind mit dem Einsatz von PMCs in Friedensmissionen verbunden?
- 5.2. Welche Ressentiments gibt und gab es seitens der UNO?
- 6. Alternativen?
- 7. Conclusio und weiterführende Thesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Eignung Privater Militär- und Sicherheitsfirmen (PMCs) für zukünftige Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Sie analysiert die strukturellen Schwächen des UN-Systems im Umgang mit internationalen Einsätzen und bewertet das Potenzial von PMCs als Lösungsansatz. Die Arbeit konzentriert sich auf die militärische Dienstleistung von PMCs, da logistische Unterstützung bereits etabliert ist.
- Schwächen des UN-Systems bei internationalen Einsätzen
- Potenzial von PMCs im Konfliktmanagement
- Vorteile und Nachteile des Einsatzes von PMCs in Friedensmissionen
- Ressentiments der UNO gegenüber PMCs
- Alternativen zu PMCs im Kontext von UN-Friedenseinsätzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund des Endes des Kalten Krieges und des damit verbundenen Anstiegs innerstaatlicher Konflikte. Sie stellt die Frage nach dem Umgang mit PMCs im Rahmen von UN-Friedensmissionen und verweist auf die unterschiedlichen Ansichten darüber, ob PMCs als moderne Söldner oder als Partner im humanitären Einsatz zu betrachten sind. Die Einleitung erwähnt den "Agenda for Peace"-Vorschlag von Boutros Boutros-Ghali und die skeptische Haltung Kofi Annans gegenüber der Privatisierung des Friedens, die nach den Ereignissen in Ruanda und Somalia entstand. Der Fokus liegt auf der militärischen Dienstleistung von PMCs.
2. Zur Struktur und Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und den methodischen Ansatz der Arbeit. Es werden die Forschungsfragen skizziert, die sich mit den strukturellen Problemen des UN-Systems bei internationalen Einsätzen, der Rolle der Nationalstaaten, den Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung über Interventionen und dem Scheitern des Somalia-Einsatzes befassen. Der zweite Teil der Arbeit wird die möglichen Beiträge von PMCs, die Vorbehalte der UNO und alternative Lösungsansätze untersuchen.
3. Die Problematik internationaler Einsätze unter UN-Mandat: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen bei internationalen UN-Einsätzen. Es beleuchtet das fehlende Gewaltmonopol der UN, unklare Mandate, träge Entscheidungsfindungsprozesse und die Abhängigkeit von den Nationalstaaten hinsichtlich Finanzierung, Truppenstellung und Kommandostrukturen. Es wird argumentiert, dass viele Probleme aus dem Spannungsverhältnis zwischen der veränderten Konfliktsituation und den Instrumentarien der UN-Charta resultieren, aber auch nationale Interessen eine entscheidende Rolle spielen.
4. Das Desaster einer humanitären Intervention unter Kommando der Vereinten Nationen (UNISOM I und UNITAF bzw. UNISOM II): Dieses Kapitel behandelt den gescheiterten UN-Einsatz in Somalia als Fallbeispiel für die im vorherigen Kapitel dargestellten Probleme. Es wird die Chronologie der Ereignisse und die aufgetretenen Probleme im Detail analysiert, um die strukturellen und politischen Herausforderungen von UN-Friedensmissionen zu veranschaulichen. Die Analyse dient als Grundlage für die spätere Bewertung des Potenzials von PMCs.
5. PMCs als Lösung?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob PMCs eine Lösung für die im vorherigen Kapitel aufgezeigten Probleme darstellen können. Es wird untersucht, welche Vorteile der Einsatz von PMCs für Friedensmissionen bietet und welche Vorbehalte seitens der UNO bestehen. Dieser Teil bildet den Kern der Argumentation, indem er die potenziellen Vorteile von PMCs gegen die bestehenden Vorbehalte abwägt.
6. Alternativen?: Dieses Kapitel untersucht alternative Ansätze zur Verbesserung der Effektivität von UN-Friedensmissionen. Es wird auf relevante Berichte und Vorschläge eingegangen, die möglicherweise über den Einsatz von PMCs hinausgehen. Dieser Teil stellt alternative Perspektiven und Lösungsansätze dar.
Schlüsselwörter
Private Militär- und Sicherheitsfirmen (PMCs), UN-Friedensmissionen, internationales Konfliktmanagement, Gewaltmonopol, Somalia-Einsatz, nationale Interessen, peacekeeping, peace enforcement, Brahimi-Report, "In Larger Freedom".
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Private Militär- und Sicherheitsfirmen (PMCs) in UN-Friedensmissionen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Eignung von Privaten Militär- und Sicherheitsfirmen (PMCs) für zukünftige Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Sie analysiert die strukturellen Schwächen des UN-Systems bei internationalen Einsätzen und bewertet das Potenzial von PMCs als Lösungsansatz, wobei der Fokus auf der militärischen Dienstleistung von PMCs liegt.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schwächen des UN-Systems bei internationalen Einsätzen, das Potenzial von PMCs im Konfliktmanagement, die Vor- und Nachteile des Einsatzes von PMCs in Friedensmissionen, die Ressentiments der UNO gegenüber PMCs und alternative Ansätze zu PMCs im Kontext von UN-Friedenseinsätzen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Struktur und Vorgehensweise, Problematik internationaler Einsätze unter UN-Mandat, Das Desaster einer humanitären Intervention in Somalia (UNISOM I/UNITAF/UNISOM II), PMCs als Lösung?, Alternativen? und Conclusio und weiterführende Thesen. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, beginnend mit der Einführung in den Kontext und endend mit einer Schlussfolgerung und Ausblick.
Welche Probleme des UN-Systems bei internationalen Einsätzen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert das fehlende Gewaltmonopol der UN, unklare Mandate, träge Entscheidungsfindungsprozesse und die Abhängigkeit von den Nationalstaaten bezüglich Finanzierung, Truppenstellung und Kommandostrukturen als zentrale Herausforderungen bei UN-Einsätzen.
Wie wird der gescheiterte Somalia-Einsatz behandelt?
Der gescheiterte UN-Einsatz in Somalia (UNISOM I/UNITAF/UNISOM II) dient als Fallbeispiel, um die im vorherigen Kapitel dargestellten Probleme der UN-Einsätze zu veranschaulichen. Die Chronologie der Ereignisse und die aufgetretenen Probleme werden detailliert analysiert.
Welche Vor- und Nachteile des Einsatzes von PMCs werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht die potenziellen Vorteile des Einsatzes von PMCs für Friedensmissionen und wägt diese gegen die bestehenden Vorbehalte der UNO ab. Dies bildet den Kern der Argumentation.
Werden Alternativen zum Einsatz von PMCs vorgestellt?
Ja, die Arbeit untersucht alternative Ansätze zur Verbesserung der Effektivität von UN-Friedensmissionen, die über den Einsatz von PMCs hinausgehen und relevante Berichte und Vorschläge berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Private Militär- und Sicherheitsfirmen (PMCs), UN-Friedensmissionen, internationales Konfliktmanagement, Gewaltmonopol, Somalia-Einsatz, nationale Interessen, peacekeeping, peace enforcement, Brahimi-Report, "In Larger Freedom".
Welche Methode wird in der Seminararbeit angewendet?
Das Kapitel "Zur Struktur und Vorgehensweise" beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit und skizziert die Forschungsfragen, die sich mit den strukturellen Problemen des UN-Systems, der Rolle der Nationalstaaten und dem Scheitern des Somalia-Einsatzes befassen.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel", der eine kurze Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels bietet.
- Arbeit zitieren
- A. Fritsch (Autor:in), 2005, Outsourcing des Friedens - PMCs als Chance für künftige Friedensmissionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67485