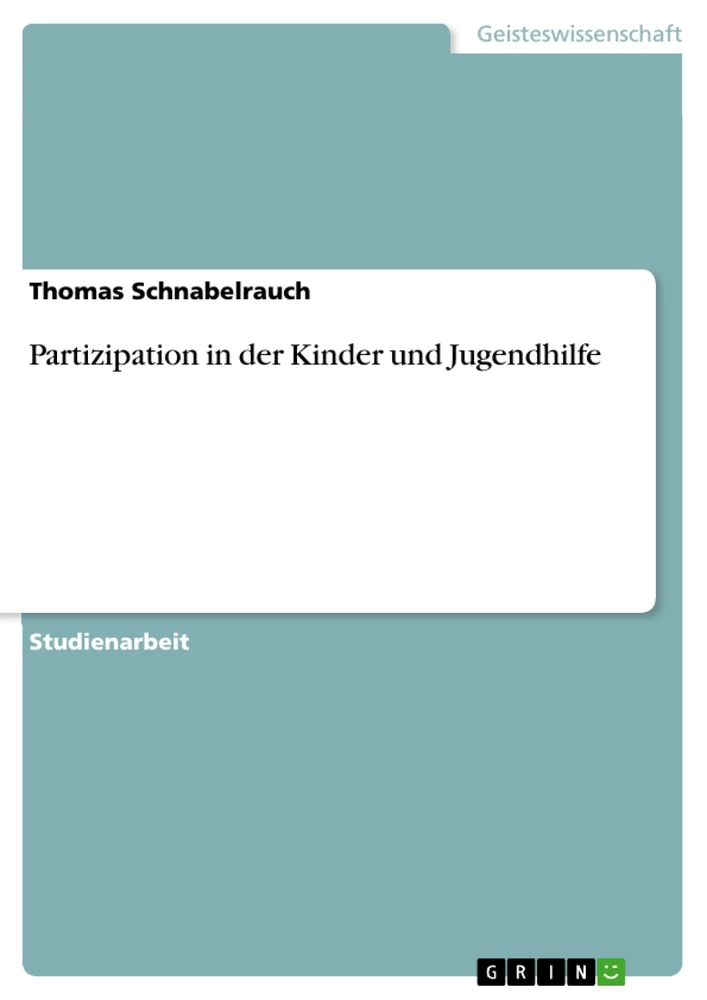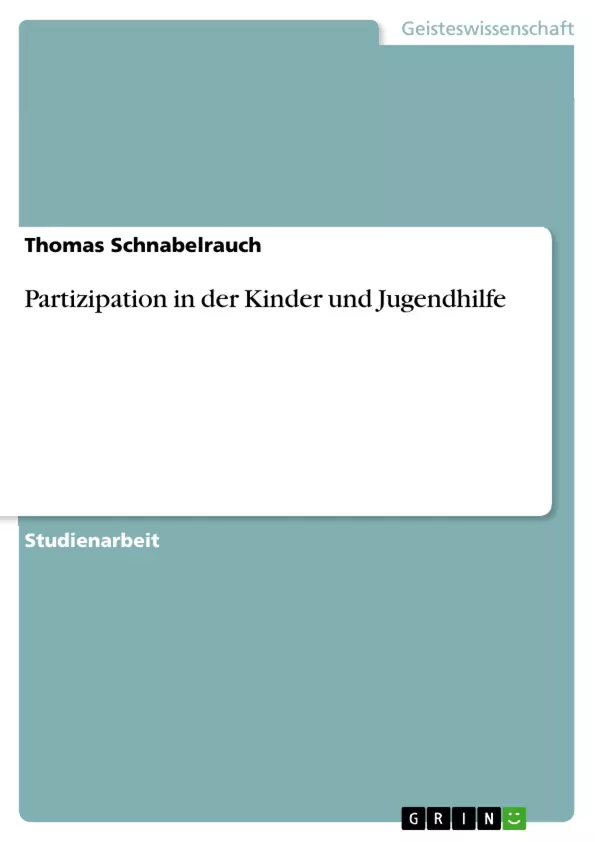Partizipation. Welche Ziele und Grundsätze besitzt hierzu die Jugendhilfe? Welche theoretischen Erklärungen gibt es hierzu? Wie und wo sind rechtliche Rahmenbedingungen geregelt? In welchen Bereichen der Jugendhilfe gibt es tatsächlich Beteiligungsmodelle für Kinder und Jugendliche? Auf diese Fragen geht der Autor konkret ein und zieht damit einen Grundriss um ein zentrales Element der "gelebten Demokratie".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Partizipation
- Begriff: Partizipation
- Ziele und Grundsätze in der Jugendhilfe
- Stufen der Partizipation
- Entwicklungspsychologische Aspekte und Sozialisationsprozess
- Rechtlicher Rahmen der Kinder- und Jugendpartizipation
- Beteiligungsmodelle in der Kinder- und Jugendhilfe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe. Ziel ist es, die Ziele und Grundsätze der Jugendhilfe sowie das Stufenmodell der Partizipation zu beschreiben und psychosoziale Aspekte von Beteiligungsformen, rechtliche Rahmenbedingungen und Beteiligungsmodelle der Jugendhilfe zu beleuchten.
- Bedeutung und Definition von Partizipation
- Ziele und Grundsätze der Partizipation in der Jugendhilfe
- Stufenmodell der Partizipation als Befähigungsprozess
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendpartizipation
- Beteiligungsmodelle in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Partizipation ein und erläutert dessen Relevanz im Kontext der Jugendhilfe. Das Zitat von Theodor Adorno verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Demokratie, Mündigkeit und Partizipation.
- Begriff: Partizipation: Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Partizipation in der soziologischen und sozialpädagogischen Bedeutung. Es wird hervorgehoben, dass Partizipation in der Jugendhilfe die Einbindung von Kindern und Jugendlichen in alle relevanten Prozesse und Entscheidungen bedeutet.
- Ziele und Grundsätze in der Jugendhilfe: Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) legt fest, dass Minderjährige nicht nur Objekte der Planung, sondern in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen sind. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen soll die Qualität der Angebote verbessern und eine Orientierung im Alltag der Jugendhilfe bieten.
- Stufen der Partizipation: Dieses Kapitel erklärt, wie und in welchem Maß Partizipation in der Praxis umgesetzt werden kann. Es wird ein Stufenmodell vorgestellt, welches die unterschiedlichen Stufen der Partizipation von Nicht-Beteiligung über Quasi-Beteiligung bis hin zur vollständigen Partizipation beschreibt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Partizipation, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendhilfegesetz (KJHG), Stufenmodell der Partizipation, Befähigungsprozess, Beteiligungsmodelle, psychosoziale Aspekte, rechtliche Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Thomas Schnabelrauch (Author), 2005, Partizipation in der Kinder und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67619