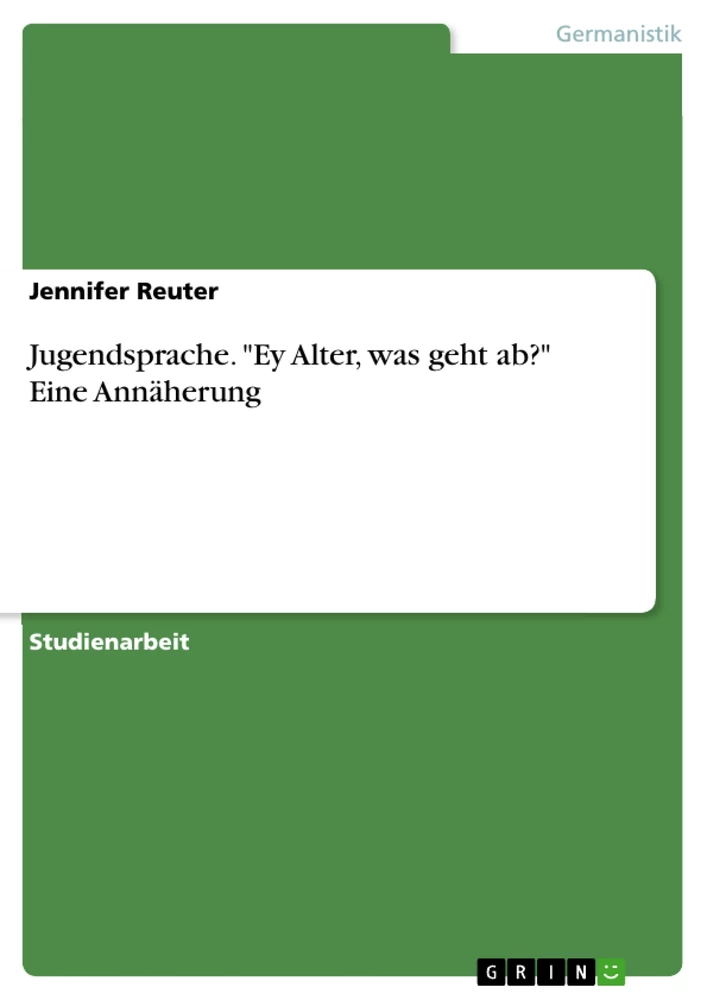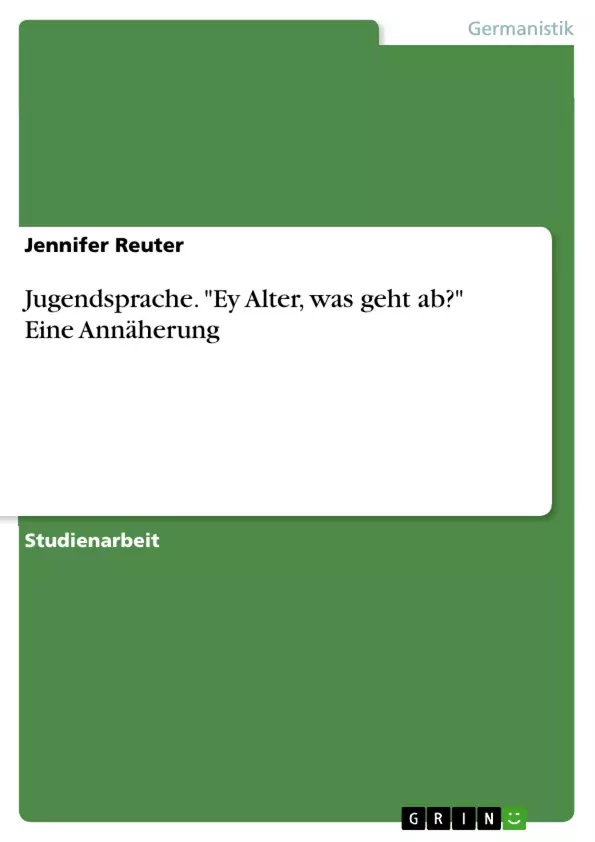Die vorliegende Arbeit versucht zunächst, die Frage zu beantworten, was Jugendsprache überhaupt ist und von wem diese Sprache gesprochen wird. So stellt sich zum Beispiel die Frage, ob die Jugend eine eigene Sprache spricht, wie die Bezeichnung „Jugendsprache“ vermuten lässt. Weiterhin gilt es zu klären, ob diese Sprache ausschließlich von Jugendlichen gesprochen wird und, ob alle Jugendlichen sich dieser Sprechweise bedienen.
In einem zweiten Schritt könnte man sich fragen, warum es überhaupt Jugendsprache gibt. Folglich wird in Punkt 2 versucht, verschiedene Gründe für die Existenz einer Jugendsprache zu liefern. Es ist in diesem Zusammenhang beispielsweise der Protestaspekt zu nennen, da mit der Jugendsprache eine Abgrenzung von der Erwachsenenwelt zum Ausdruck gebracht wird. Die gemeinsame Kreation sprachlicher Elemente schafft zudem eine gemeinsame Basis für die Schaffung eines Zusammengehörigkeitsgefühls.
Im Anschluss geht es darum, herauszufinden, woraus diese Jugendsprache besteht, also was die charakteristischen Merkmale sind, welche Jugendsprache auszeichnen. Aus der Fülle der Kennzeichen von Jugendsprache können im Rahmen dieser Arbeit nur einige Merkmale exemplarisch genannt und erläutert werden, zu denen u.a. die Verwendung von Wortneuschöpfungen sowie die gehäufte Benutzung von Anglizismen gehören.
Der Jugendsprache wird häufig der Vorwurf gemacht, dass es sich bei ihr um eine Sprachverhunzung handele. Auf der anderen Seite hat Jugendsprache auch den Ruf, „trendy“ zu sein, was dazu führt, dass sich viele eigentlich dem Jugendalter entwachsenen Personen dieser Sprache bedienen. Mit diesen und anderen Bewertungen von Jugendsprache setze ich mich im vierten Punkt auseinander, um im Anschluss die vorliegende Arbeit mit einigen Schlussbemerkungen zum Abschluss zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Versuch einer Klärung des Begriffs „Jugendsprache“
- 2. Gründe für eine Jugendsprache
- 3. Merkmale der Jugendsprache
- 4. Bewertung der Jugendsprache durch die Gesellschaft
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den vielschichtigen Begriff der „Jugendsprache“. Ziel ist es, die Definition, die Gründe für ihr Entstehen, ihre charakteristischen Merkmale und die gesellschaftliche Bewertung zu beleuchten. Die Arbeit vermeidet eine rein lexikalische Betrachtung und konzentriert sich stattdessen auf die soziolinguistischen Aspekte.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Jugendsprache“
- Soziokulturelle Ursachen für das Auftreten von Jugendsprache
- Linguistische Merkmale und Charakteristika der Jugendsprache
- Gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung von Jugendsprache
- Der Wandel der Jugendsprache im Zeitverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Jugendsprache ein und hebt die zahlreichen Publikationen und Wörterbücher hervor, die jedoch aufgrund des ständigen Wandels der Sprache schnell veralten. Sie betont die Notwendigkeit einer Begriffsklärung als Ausgangspunkt für die Analyse.
1. Versuch einer Klärung des Begriffs „Jugendsprache“: Dieses Kapitel befasst sich mit der schwierigen Definition von „Jugendsprache“. Es hinterfragt die Annahme einer klar von der Erwachsenensprache abgegrenzten Jugendsprache und diskutiert die verschiedenen Definitionen von „Jugend“ (juristisch, biologisch, soziologisch), wobei die Grenzen zwischen Jugend- und Erwachsenenalter als fließend dargestellt werden und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition betont werden. Die unterschiedlichen Altersdefinitionen werden mit entsprechenden Quellen belegt und ihre Relevanz für die Untersuchung der Jugendsprache herausgestellt. Die Problematik der Definition von „Jugend“ wird als zentraler Aspekt für das Verständnis von „Jugendsprache“ hervorgehoben.
2. Gründe für eine Jugendsprache: Dieses Kapitel (dessen Inhalt aus der Einleitung erschlossen wird) untersucht die Ursachen für die Existenz von Jugendsprache. Es wird der Aspekt des Protests gegen die Erwachsenenwelt und die Schaffung eines Gruppenidentitätsgefühls durch gemeinsame Sprachformen thematisiert. Die gemeinsame Kreation neuer sprachlicher Elemente dient der Abgrenzung von und dem Zusammenhalt innerhalb der Jugendgruppe. Die Bedeutung der Jugendsprache als Mittel der sozialen Identifikation und des Ausdrucks von Gegenkultur wird als zentraler Punkt hervorgehoben.
3. Merkmale der Jugendsprache: Dieses Kapitel (dessen Inhalt aus der Einleitung erschlossen wird) beschreibt die charakteristischen Merkmale der Jugendsprache. Es werden exemplarisch einige Kennzeichen genannt und erläutert, wie z.B. Wortneuschöpfungen und die häufige Verwendung von Anglizismen. Die Komplexität und Vielfalt der sprachlichen Merkmale werden angesprochen, wobei die Auswahl im Rahmen der Arbeit begrenzt bleiben muss. Die beschriebenen Merkmale werden als typische Beispiele für sprachliche Innovationen und den Einfluss externer sprachlicher Einflüsse auf die Jugendsprache dargestellt.
4. Bewertung der Jugendsprache durch die Gesellschaft: Dieses Kapitel (dessen Inhalt aus der Einleitung erschlossen wird) analysiert die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewertungen der Jugendsprache. Es wird der Widerspruch zwischen der Kritik an der Jugendsprache als „Sprachverhunzung“ und ihrer gleichzeitigen Popularität und dem „Trendfaktor“ herausgestellt. Die Arbeit untersucht, wie sich diese widersprüchlichen Auffassungen widerspiegeln und welche gesellschaftlichen Faktoren diese Bewertungen beeinflussen. Die Ambivalenz der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Jugendsprache bildet den zentralen Punkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Soziolinguistik, Sprachwandel, Jugendkultur, Identität, Abgrenzung, Anglizismen, Wortneuschöpfungen, gesellschaftliche Bewertung, Altersdefinition.
Häufig gestellte Fragen zur Jugendsprache
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zur Jugendsprache?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Jugendsprache. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf soziolinguistischen Aspekten und vermeidet eine rein lexikalische Betrachtung. Die Arbeit untersucht Definition, Entstehung, Merkmale und gesellschaftliche Bewertung von Jugendsprache.
Wie wird der Begriff „Jugendsprache“ definiert?
Die Arbeit betont die Schwierigkeit, „Jugendsprache“ eindeutig zu definieren. Sie hinterfragt die Annahme einer klaren Abgrenzung zur Erwachsenensprache und diskutiert die unterschiedlichen Definitionen von „Jugend“ (juristisch, biologisch, soziologisch). Die fließenden Grenzen zwischen Jugend und Erwachsenenalter und die damit verbundenen Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition werden hervorgehoben. Die Problematik der Altersdefinition wird als zentraler Aspekt für das Verständnis von Jugendsprache betrachtet.
Welche Gründe für das Auftreten von Jugendsprache werden genannt?
Die Arbeit thematisiert den Aspekt des Protests gegen die Erwachsenenwelt und die Schaffung eines Gruppenidentitätsgefühls durch gemeinsame Sprachformen. Die gemeinsame Kreation neuer sprachlicher Elemente dient der Abgrenzung von und dem Zusammenhalt innerhalb der Jugendgruppe. Die Bedeutung der Jugendsprache als Mittel der sozialen Identifikation und des Ausdrucks von Gegenkultur wird als zentraler Punkt hervorgehoben.
Welche Merkmale der Jugendsprache werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt charakteristische Merkmale der Jugendsprache, wie z.B. Wortneuschöpfungen und die häufige Verwendung von Anglizismen. Sie betont die Komplexität und Vielfalt der sprachlichen Merkmale, wobei die Auswahl im Rahmen der Arbeit begrenzt bleibt. Die beschriebenen Merkmale werden als typische Beispiele für sprachliche Innovationen und den Einfluss externer sprachlicher Einflüsse dargestellt.
Wie wird die gesellschaftliche Bewertung der Jugendsprache dargestellt?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewertungen der Jugendsprache und den Widerspruch zwischen Kritik an der Jugendsprache als „Sprachverhunzung“ und ihrer gleichzeitigen Popularität und dem „Trendfaktor“. Sie untersucht, wie sich diese widersprüchlichen Auffassungen widerspiegeln und welche gesellschaftlichen Faktoren diese Bewertungen beeinflussen. Die Ambivalenz der gesellschaftlichen Wahrnehmung bildet den zentralen Punkt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Jugendsprache, Soziolinguistik, Sprachwandel, Jugendkultur, Identität, Abgrenzung, Anglizismen, Wortneuschöpfungen, gesellschaftliche Bewertung, Altersdefinition.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Versuch einer Klärung des Begriffs „Jugendsprache“, Gründe für eine Jugendsprache, Merkmale der Jugendsprache, Bewertung der Jugendsprache durch die Gesellschaft und Schlussbemerkungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den vielschichtigen Begriff der „Jugendsprache“. Ziel ist es, die Definition, die Gründe für ihr Entstehen, ihre charakteristischen Merkmale und die gesellschaftliche Bewertung zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den soziolinguistischen Aspekten.
- Citar trabajo
- Jennifer Reuter (Autor), 2006, Jugendsprache. "Ey Alter, was geht ab?" Eine Annäherung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67754