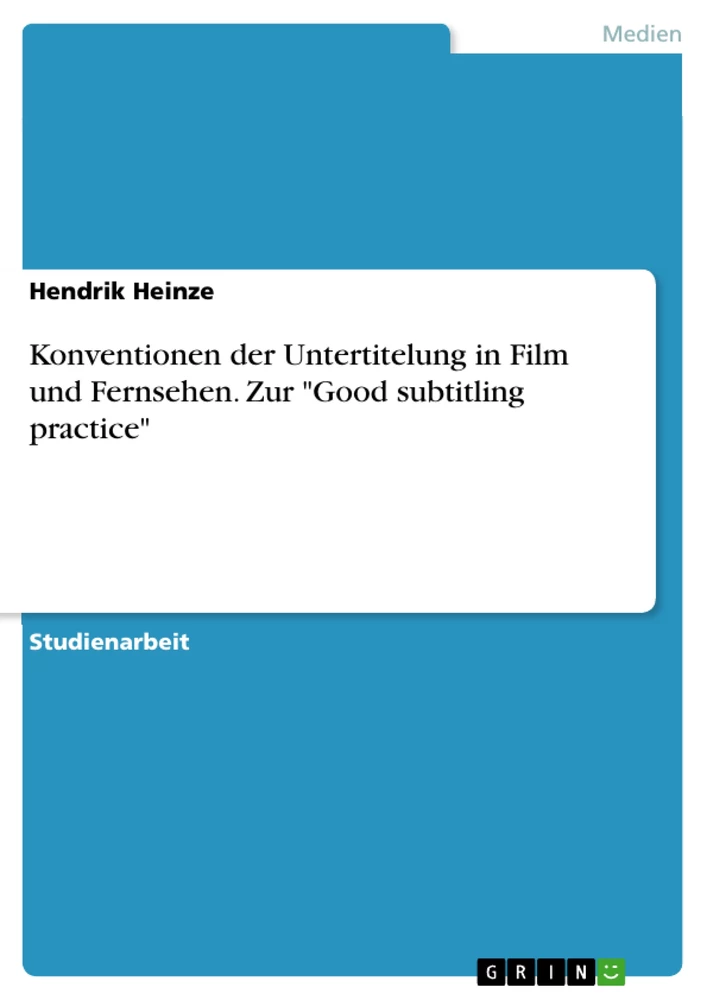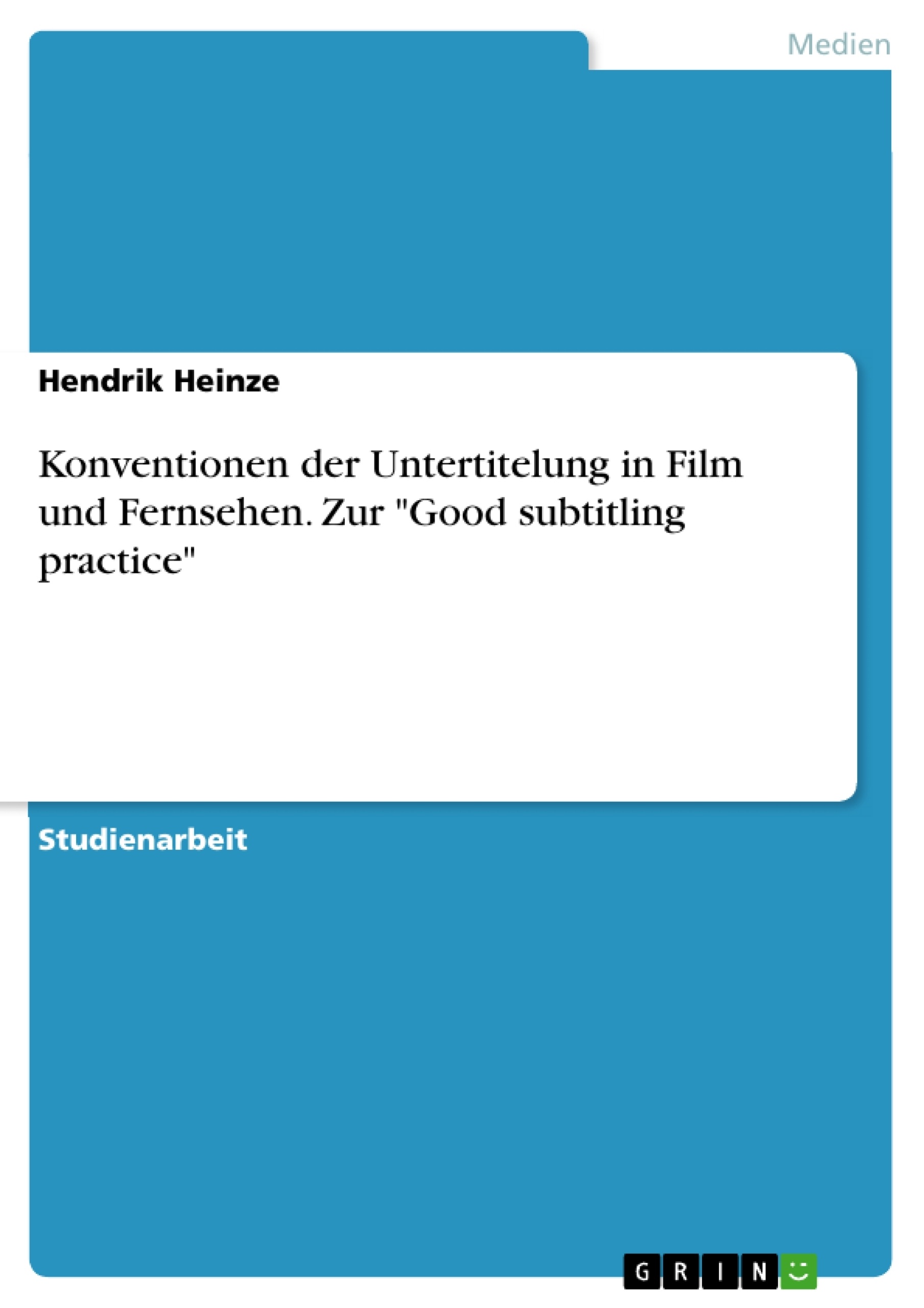Gutes Untertiteln ist eine hohe Kunst, wahrgenommen jedoch meist nur in ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten. „All of us have, at one time or another, left a movie theater wanting to kill the translator. Our motive: the movie’s murder by ‘incompetent’ subtitle”, schreibt der Filmkritiker Nornes (1999: 17). Dem Publikum ist oft nicht bewusst, welch große technische, sprachliche, stilistische und dramaturgische Herausforderungen mit der Übertragung einhergehen. Zusätzliche audiovisuelle Komponenten in einer polysemiotischen Umgebung, ein Wechsel vom gesprochenen zum geschriebenen Medium und eine beachtliche Textreduktion werden von Untertitlern als arbeitserschwerende Einschränkungen und von Translationswissenschaftlern als distinkte Merkmale einer “neuen” Art der Übersetzung gesehen.
Zur Vereinheitlichung und Erleichterung dieser anspruchsvollen Tätigkeit existieren verschiedene Konventionen. Diese Arbeit hat zum Ziel, die geltenden Standards der Untertitelung und deren wissenschaftliche Herleitung zu beleuchten. Zahlreiche Autoren haben Handreichungen und Überblicke zum guten Untertiteln verfasst, so z.B. Buhr (2003), Dries (1995), Ivarsson (1992) und Luyken et. al. (1991). Auch die wissenschaftliche Literatur zum Thema wächst stetig. Um die Einhaltung gewisser Standards sicherzustellen, hat die Gilde der europäischen Untertitler zahlreiche Festlegungen zum zeitgemäßen Untertiteln getroffen. Hier ist besonders der ‚Code of Good Subtitling Practice’ der ‚European Association for studies in screen translation’ (ESIST) zu nennen, den die erfahrenen Untertitler Jan Ivarsson und Mary Carroll zusammengestellt haben (Ivarsson/Carroll 1998). Eine genaue Auseinandersetzung mit den dortigen technischen und sprachlichen Maßgaben ist das Herzstück dieser Arbeit. Die so entstandene Vermischung normativer Handlungsanweisungen und deskriptiver Analysen ist ein bewusster Versuch der thematischen Anordnung.
Als umfängliche und kompetente Einschätzung des Untertitelns und seiner Herausforderungen richtet sich diese Arbeit an Sprach- und TranslationswissenschaftlerInnen sowie PraktikerInnen gleichermaßen. Die gelungene Verknüpfung von praxisnaher Darstellung und fundierter theoretischer Analyse, der klare und prägnante Stil sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis machen die Arbeit insbesondere für Studenten geistes- und kulturwissenschaftlicher Fächer interessant. Der Autor ist Diplom-Kulturwissenschaftler.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Möglichkeiten der sprachlichen Übertragung von Filmen
- 1.2 Standards und Konventionen
- 2 Definition
- 3 Eine kurze Geschichte des Untertitelns
- 4 Charakteristika der Untertitelung
- 4.1 Ist Untertitelung Übersetzung?
- 4.2 Die polysemiotische kommunikative Situation
- 4.2.1 Raum und Zeit
- 4.2.2 Rhythmus
- 4.2.3 Segmentierung
- 4.3 Reduktion: Linguistische Strategien
- 4.3.1 Totale Reduktion / Tilgung
- 4.3.2 Partielle Reduktion / Kondensation und Paraphrase
- 4.4 Adaption gesprochener Sprache
- 5 Zusammenfassung
- 6 Fremdsprachliche Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konventionen der Untertitelung in Film und Fernsehen. Sie beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten der sprachlichen Filmübertragung, fokussiert sich aber hauptsächlich auf die Untertitelung im Vergleich zur Synchronisation. Ein zentrales Anliegen ist die Klärung von Standards und Konventionen guter Untertitelungspraxis und die Analyse der damit verbundenen linguistischen Herausforderungen.
- Vergleich von Untertitelung und Synchronisation als Methoden der Filmübersetzung
- Analyse linguistischer Strategien in der Untertitelung (Reduktion, Adaption)
- Untersuchung der spezifischen Herausforderungen der polysemiotischen Kommunikation im Kontext der Untertitelung
- Definition und historische Entwicklung der Untertitelung
- Standards und Konventionen guter Untertitelungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Filmübertragung ein und stellt die Untertitelung im Kontext zu anderen Methoden wie Synchronisation und Voice-over dar. Sie veranschaulicht die wachsende Bedeutung von Untertiteln, besonders mit dem Aufkommen von DVDs und dem Internet, und hebt die unterschiedlichen Perspektiven und kulturellen Gepflogenheiten in Bezug auf die Akzeptanz von Untertiteln in verschiedenen Ländern hervor. Die Einleitung unterstreicht die ökonomischen Aspekte und die anhaltende Debatte über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Übersetzungsmethoden, wobei sie den Fokus auf die Bedeutung von Authentizität und Adaption legt.
2 Definition: [Es wird angenommen, dass Kapitel 2 eine Definition des Begriffs "Untertitelung" liefert. Da der Text diese Information nicht enthält, kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.]
3 Eine kurze Geschichte des Untertitelns: [Es wird angenommen, dass Kapitel 3 eine Geschichte der Untertitelung bietet. Da der Text diese Information nicht enthält, kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.]
4 Charakteristika der Untertitelung: Kapitel 4 analysiert die Eigenheiten der Untertitelung als Übersetzungsmethode. Es untersucht, inwiefern Untertitelung als Übersetzung betrachtet werden kann und befasst sich mit den komplexen Aspekten der polysemiotischen Kommunikation, die den Untertitelungsprozess kennzeichnen. Hierbei werden Raum und Zeit, Rhythmus und Segmentierung des Untertitels im Verhältnis zum Film analysiert. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf den linguistischen Reduktionsstrategien wie totale Reduktion (Tilgung) und partielle Reduktion (Kondensation und Paraphrase), sowie der Adaption gesprochener Sprache an die schriftliche Form. Das Kapitel beleuchtet also die spezifischen Herausforderungen und die dafür notwendigen Strategien, um einen verständlichen und kohärenten Untertitel zu erstellen.
Schlüsselwörter
Untertitelung, Synchronisation, Filmübersetzung, Sprachliche Übertragung, Polysemiotische Kommunikation, Reduktion, Adaption, Linguistische Strategien, Standards, Konventionen, DVD, Originalfassung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachliche Filmübertragung - Fokus Untertitelung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Konventionen der Untertitelung im Film und Fernsehen. Sie vergleicht die Untertitelung mit anderen Methoden der Filmübersetzung wie Synchronisation und beleuchtet die damit verbundenen linguistischen Herausforderungen und Standards guter Praxis.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich von Untertitelung und Synchronisation, eine Analyse linguistischer Strategien in der Untertitelung (Reduktion, Adaption), die Untersuchung der polysemiotischen Kommunikation im Kontext der Untertitelung, die Definition und historische Entwicklung der Untertitelung sowie die Standards und Konventionen guter Untertitelungspraxis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus mehreren Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema der sprachlichen Filmübertragung ein und stellt die Untertitelung im Kontext dar. Kapitel 2 (Definition) liefert eine Definition von Untertitelung (genaue Inhalte im bereitgestellten Text nicht vorhanden). Kapitel 3 (Geschichte des Untertitelns) bietet einen historischen Überblick über die Untertitelung (genaue Inhalte im bereitgestellten Text nicht vorhanden). Kapitel 4 (Charakteristika der Untertitelung) analysiert die Eigenheiten der Untertitelung als Übersetzungsmethode, einschließlich polysemiotischer Kommunikation, Reduktionsstrategien (totale und partielle Reduktion) und der Adaption gesprochener Sprache. Kapitel 5 und 6 beinhalten eine deutsche und eine fremdsprachige Zusammenfassung.
Welche linguistischen Strategien werden in der Untertitelung analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere Reduktionsstrategien (totale Reduktion/Tilgung und partielle Reduktion/Kondensation und Paraphrase) und die Adaption gesprochener Sprache an die schriftliche Form der Untertitel.
Was versteht man unter "polysemiotischer Kommunikation" im Kontext der Untertitelung?
Die Arbeit untersucht die komplexen Aspekte der polysemiotischen Kommunikation, die den Untertitelungsprozess kennzeichnen. Dabei werden Raum und Zeit, Rhythmus und Segmentierung des Untertitels im Verhältnis zum Film analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Untertitelung, Synchronisation, Filmübersetzung, Sprachliche Übertragung, Polysemiotische Kommunikation, Reduktion, Adaption, Linguistische Strategien, Standards, Konventionen, DVD, Originalfassung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Konventionen der Untertitelung zu untersuchen, die verschiedenen Möglichkeiten der sprachlichen Filmübertragung zu beleuchten, Standards und Konventionen guter Untertitelungspraxis zu klären und die damit verbundenen linguistischen Herausforderungen zu analysieren.
- Quote paper
- Diplom-Kulturwissenschaftler Hendrik Heinze (Author), 2005, Konventionen der Untertitelung in Film und Fernsehen. Zur "Good subtitling practice", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67760