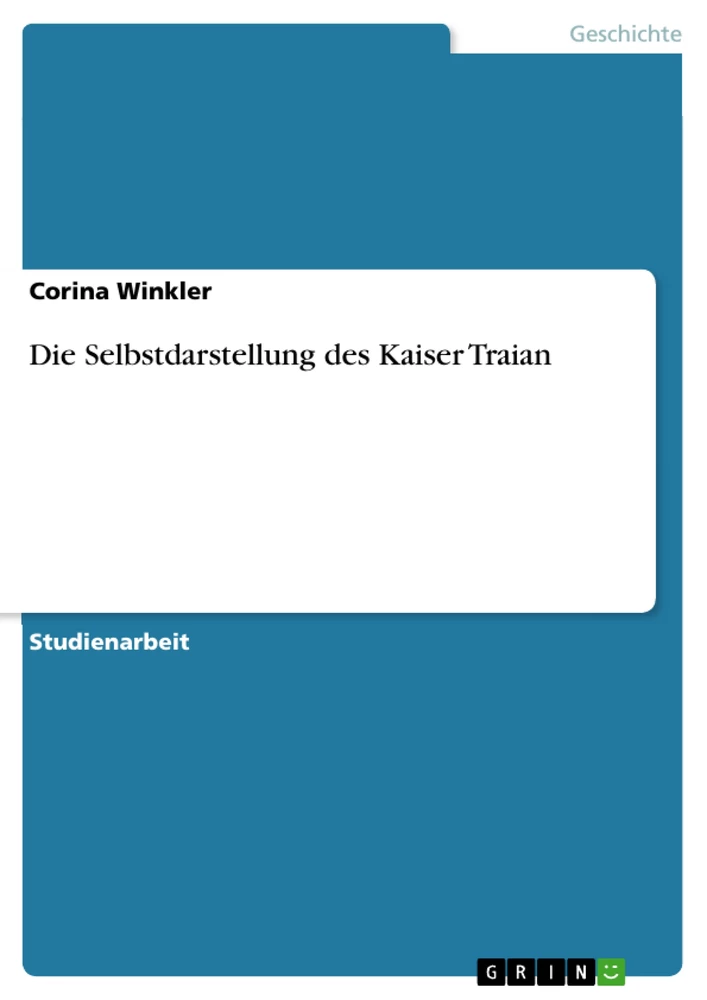Während seiner Regentschaft von 98 bis 117 n. Chr. konnte Kaiser Traian durch militärische Erfolge, allen voran den Sieg über das Dakerreich, das Imperium Romanum zu seiner größten Ausdehnung verhelfen. Gleichzeitig gelang es ihm, das Reich trotz seiner Größe im Inneren zusammen zu halten und seiner Regentschaft eine nicht selbstverständliche Stabilität zu geben. Diese Konstanz zu gewährleisten, bedeutete, sich nicht nur auf politischer sondern auch auf repräsentativer Ebene angemessen zu verhalten. Die kaiserliche Selbstdarstellung unterlag dabei einem Regelwerk, das im Grunde durch die zwitterhafte Stellung des princeps im Staat, vor allem aber in Rom, bestimmt wurde. Zum einen war der Kaiser dem Senat gegenüber zu Loyalität und Rechenschaftsablage verpflichtet, zum anderen war er auf das Heer gestützter Alleinherrscher. Dass in Politik und Umgangsformen die monarchischen Elemente seit der Einrichtung des Principats durch Augustus jedoch überwogen, war natürlich durchaus bekannt gewesen. Dennoch galt es, zumindest in den Repräsentationsformen den Schein zu wahren. Der Kaiser sprach, ausgenommen von Taten- beziehungsweise Rechenschaftsberichten, nie über sich selbst. Öffentliche Denkmäler wurden als Stiftungen des Senats oder anderen Institutionen proklamiert.
In dieser Arbeit sollen nun speziell die Aspekte der traianischen Selbstdarstellung dargelegt werden. Folgende Fragen sollen dabei wichtig sein: Inwieweit folgte Traian dem üblichen Kanon kaiserlicher Selbstdarstellung? Gibt es Unterschiede zu den Repräsentationsformen seiner Vorgänger? Traten neue Elemente hinzu? Gab es einen besonderen Adressatenkreis? Und welches Gesamtbild Traians ergibt sich aus seiner Selbstdarstellung?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Fragestellung
- Umfang und Bedeutung der Medien in der traianischen Selbstdarstellung
- Die Programmpunkte traianischer Selbstdarstellung
- Traian als Militärführer und Soldatenfreund
- Traian und die Aufwertung der Provinzen
- Traian und die Sorge um Rom und Italien
- Herrschaftslegitimierung
- Resümé
- Literatur- und Abkürzungsverzeichnis
- Quelleneditionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Selbstdarstellung des römischen Kaisers Traian (98-117 n. Chr.). Ziel ist es, die Besonderheiten seiner Selbstdarstellung im Vergleich zu seinen Vorgängern zu analysieren und den Adressatenkreis dieser Repräsentationsformen zu bestimmen.
- Die Medien der traianischen Selbstdarstellung (Münzen, Reliefs, Statuen)
- Traians Darstellung als erfolgreicher Militärführer und Friedensbringer
- Die Betonung der Bedeutung der Provinzen und des römischen Volkes
- Die Legitimation seiner Herrschaft durch Propaganda und Kunst
- Traians Selbstdarstellung im Kontext der römischen Kaiserzeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Fragestellung ein und stellt Traian als einen der erfolgreichsten römischen Kaiser vor. Es beleuchtet die Bedeutung der Selbstdarstellung für den römischen Kaiser und die besondere Rolle des Princeps im Staat. Kapitel zwei analysiert die Medien der traianischen Selbstdarstellung, vor allem Münzen und Reliefs, und stellt deren Bedeutung für die Verbreitung des Herrscherbildes heraus. Im dritten Kapitel werden die Programmpunkte der traianischen Selbstdarstellung im Detail untersucht. Hierbei werden Traians Darstellung als Militärführer, seine Bemühungen um die Provinzen und die Sorge um Rom und Italien sowie seine Legitimation als Herrscher beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Selbstdarstellung des römischen Kaisers Traian, seinen militärischen Erfolgen, seiner Politik gegenüber den Provinzen, den Medien der römischen Propaganda (Münzen, Reliefs, Statuen), der Legitimation seiner Herrschaft, und der Bedeutung der Selbstdarstellung im Kontext der römischen Kaiserzeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie stellte sich Kaiser Traian in der Öffentlichkeit dar?
Traian präsentierte sich vor allem als erfolgreicher Militärführer („Soldatenfreund“), aber auch als fürsorglicher Princeps, der sich um das Wohl Roms, Italiens und der Provinzen kümmerte.
Welche Medien nutzte Traian für seine Propaganda?
Zu den wichtigsten Medien gehörten Münzprägungen, öffentliche Denkmäler wie die Traianssäule, Reliefs und Statuen im gesamten römischen Reich.
Was war das Besondere an seiner Beziehung zum Senat?
Obwohl er Alleinherrscher war, wahrte Traian den Schein der Republik, indem er Denkmäler oft als Stiftungen des Senats proklamieren ließ und sich gegenüber dem Senat loyal zeigte.
Warum spielten die Provinzen eine so große Rolle?
Unter Traian erreichte das Römische Reich seine größte Ausdehnung. Die Aufwertung der Provinzen diente der Stabilität des riesigen Reiches und der Legitimation seiner Herrschaft nach außen.
Welchen Titel erhielt Traian für seine Verdienste?
Er wurde vom Senat mit dem Ehrentitel „Optimus Princeps“ (der beste Kaiser) ausgezeichnet, was den Kern seiner Selbstdarstellung widerspiegelt.
- Arbeit zitieren
- Corina Winkler (Autor:in), 2006, Die Selbstdarstellung des Kaiser Traian, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67791