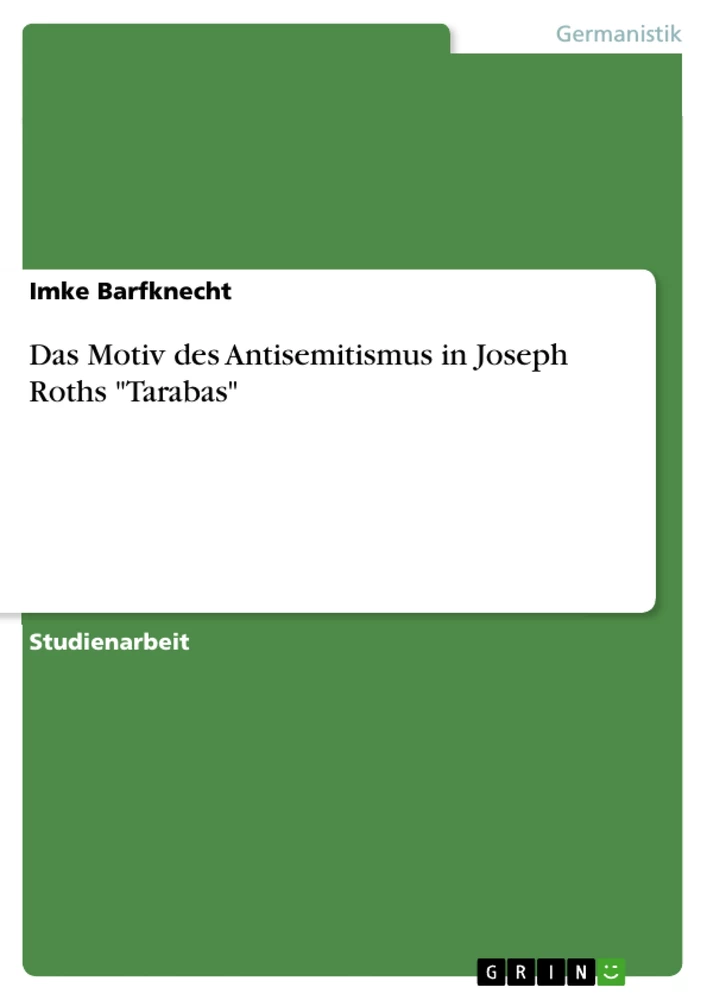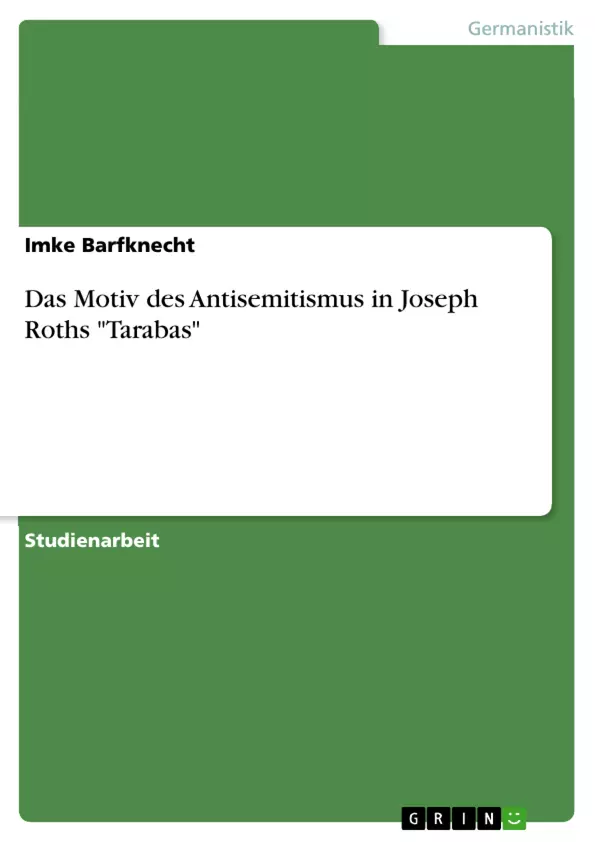Die Handlung des 1934 erstmals erschienenen Romans „Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde“ findet in den Jahren vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg, in einem nicht näher bezeichneten osteuropäischen Land statt. Erzählt wird die „Legende“ von der wunderbaren Läuterung des Sünders Nikolaus Tarabas. Dabei ist diese Legende keineswegs idealtypisch, vielmehr mischen sich hier Motive des Glaubens auch die des Aberglaubens. Zudem werden nicht nur christliche, sondern auch jüdische Positionen dargestellt. Der Grund liegt im Thema des Romans, denn hier setzt sich Roth mit dem Antisemitismus auseinander. Der Judenfeind Nikolaus Tarabas kann seinen Haß überwinden und zum christlichen Glauben zurückfinden. Formal wird sein Weg in der Zweiteilung des Romans dargestellt, deren Überschriften „Die Prüfung“ und „Die Erfüllung“ an das Grundmuster der Hagiographien anspielen, in denen das Leben des späteren Heiligen vor und während seines Dienstes für Gott geschildert wird.1
[...]
1 Vgl. Frank Joachim Eggers, „Ich bin ein Katholik mit jüdischem Gehirn“ – Modernitätskritik und Religion bei Joseph Roth und Franz Werfel. Untersuchungen zu den erzählerischen Werken (= Beiträge zur Literatur und Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts, Bd. 13, hrsg. v. Eberhard Mannack), Frankfurt a.M. u.a. 1996, S. 114f.; Celine Mathew, Ambivalence and Irony in the works of Joseph Roth, Frankfurt a.M. 1984, S. 159; Claudio Magris, Weit von Wo. Verlorene Welt des Ostjudentums, Wien 1974, S. 257.
Natürlich entspricht „Tarabas“ nicht im Detail dem christlichen Legendenverständnis. Keinem christlichen Theologen wird es beispielsweise gefallen, daß eine Wahrsagerin Tarabas’ Schicksal vorhersagt: „Ich lese in Ihrer Hand, daß Sie ein Mörder sind und ein Heiliger! [...] Sie werden sündigen und büßen – alles noch auf Erden.“ (Joseph Roth, Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde, Köln 2. Aufl. 1996, S. 12).
Charakteristisch für die ästhetisch-formale Gestaltung des „Tarabas“ ist ein Schwanken zwischen der Form eines Berichts und der einer Legende. Damit weist die Erzählweise sowohl schriftlich-säkulare Momente auf, als auch mündlich-religiöse. (vgl. Katharina Ochse, Joseph Roths Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus (= Epistemata, Bd. 273), Würzburg 1999, S. 158f.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der stets fremde Jude – Formen des Antisemitismus
- Das Pogrom in Koropta
- Ramsin Führer und Verführer
- Die wunderbare Marienerscheinung
- Das Pogrom
- Der Antisemitismus des Nikolaus Tarabas
- Schemarjah Korpus' Bart
- Die Wandlung des „schrecklichen“ Tarabas – Die Überwindung des Judenhasses
- Tarabas' Bußweg
- „Ein Gast auf dieser Erde“ – Die Grabinschrift
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Joseph Roths Roman „Tarabas“ im Hinblick auf die Darstellung und Überwindung von Antisemitismus. Der Fokus liegt auf der Analyse des Pogroms in Koropta als Beispiel für kollektiven Judenhass und auf der individuellen Entwicklung der Hauptfigur Nikolaus Tarabas. Die Arbeit beleuchtet Roths Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext seiner eigenen Erfahrungen im Exil und seines Kampfes gegen den Nationalsozialismus.
- Darstellung verschiedener Formen des Antisemitismus in „Tarabas“
- Analyse des Pogroms in Koropta als kollektive Manifestation von Judenhass
- Die individuelle Entwicklung von Nikolaus Tarabas und seine Überwindung des Antisemitismus
- Roths literarische Strategie und die ästhetisch-formale Gestaltung des Romans
- Der Kontext von Roths Exil und seinem Kampf gegen den Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Roman „Tarabas“ vor, beschreibt den historischen und literarischen Kontext seiner Entstehung im Exil während der NS-Zeit und betont Roths Auseinandersetzung mit Antisemitismus als zentrales Thema. Der Roman wird als „Legende“ von Tarabas' Läuterung beschrieben, wobei christliche und jüdische Perspektiven aufeinandertreffen. Der Bezug zu Roths persönlicher Situation und seinem Kampf gegen den Nationalsozialismus wird hervorgehoben, sowie die formale Zweiteilung des Romans, die an Hagiographien erinnert.
Der stets fremde Jude – Formen des Antisemitismus: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die historischen und gesellschaftlichen Ursachen des Antisemitismus. Es werden verschiedene Formen des Judenhasses – von religiös motiviertem Hass über Aberglauben und die Anschuldigung als Volksfeind bis hin zur Verschwörungstheorie der jüdischen Weltherrschaft – erläutert und mit historischen Beispielen belegt. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Vorurteilen, die auf Unwissenheit, Angst vor dem Fremden und religiöser Intoleranz beruhen. Das Kapitel dient als Grundlage zum Verständnis des Antisemitismus, der in „Tarabas“ thematisiert wird.
Das Pogrom in Koropta: Dieses Kapitel analysiert das Pogrom in Koropta als zentralen Punkt des Romans. Es werden die Ereignisse des Pogroms detailliert beschrieben und die verschiedenen Akteure und ihre Motivationen beleuchtet. Die Darstellung des kollektiven Judenhasses und seiner verheerenden Folgen wird untersucht und in Beziehung zu den verschiedenen Formen des Antisemitismus aus dem vorhergehenden Kapitel gesetzt. Die Auswirkungen des Pogroms auf die Individuen und die Gemeinschaft werden analysiert, um die Brutalität und Tragik des Ereignisses aufzuzeigen.
Der Antisemitismus des Nikolaus Tarabas: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Hauptfigur Nikolaus Tarabas und seine Entwicklung. Es wird die Entstehung und der Verlauf seines Antisemitismus detailliert beschrieben und die Ursachen dafür analysiert. Tarabas’ Weg der Umkehr und Buße wird im Detail nachgezeichnet, wobei die verschiedenen Etappen seiner Wandlung – vom Judenhass zur christlichen Nächstenliebe – erläutert werden. Die Bedeutung von Schlüsselereignissen für seine Entwicklung wird untersucht, und es wird die Frage beleuchtet, inwieweit Tarabas’ Geschichte ein exemplarisches Beispiel für die Überwindung von Vorurteilen darstellt.
Schlüsselwörter
Joseph Roth, Tarabas, Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Osteuropa, Exil, Nationalsozialismus, christlicher Glaube, Läuterung, Buße, kollektiver Antisemitismus, individueller Antisemitismus, religiöser Antisemitismus, Aberglaube.
Joseph Roth's "Tarabas": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Joseph Roths Roman "Tarabas" mit dem Schwerpunkt auf der Darstellung und Überwindung von Antisemitismus. Der Fokus liegt dabei auf dem Pogrom in Koropta als Beispiel für kollektiven Judenhass und der individuellen Entwicklung der Hauptfigur Nikolaus Tarabas.
Welche Themen werden im Roman "Tarabas" behandelt?
Der Roman behandelt verschiedene Formen des Antisemitismus, von religiös motiviertem Hass bis hin zu Verschwörungstheorien. Er zeigt das Pogrom in Koropta als grausames Beispiel für kollektiven Judenhass und verfolgt die Entwicklung von Nikolaus Tarabas, der seinen Antisemitismus überwinden muss. Die Arbeit beleuchtet auch den Kontext von Roths Exil und seinem Kampf gegen den Nationalsozialismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über verschiedene Formen des Antisemitismus, eine detaillierte Analyse des Pogroms in Koropta, ein Kapitel über die Entwicklung von Nikolaus Tarabas und seine Überwindung des Antisemitismus, und schließlich eine Schlussbetrachtung.
Wie wird das Pogrom in Koropta dargestellt?
Das Pogrom in Koropta wird als zentraler Punkt des Romans detailliert analysiert. Die Arbeit beschreibt die Ereignisse, beleuchtet die Motivationen der Akteure und untersucht die verheerenden Folgen des kollektiven Judenhasses. Die Auswirkungen auf Individuen und die Gemeinschaft werden analysiert, um die Brutalität und Tragik des Ereignisses aufzuzeigen.
Wie entwickelt sich Nikolaus Tarabas im Roman?
Das Kapitel über Nikolaus Tarabas konzentriert sich auf die Entstehung und den Verlauf seines Antisemitismus und analysiert dessen Ursachen. Es wird sein Weg der Umkehr und Buße detailliert nachgezeichnet, von Judenhass zur christlichen Nächstenliebe. Schlüsselereignisse und die Frage, ob Tarabas ein exemplarisches Beispiel für die Überwindung von Vorurteilen darstellt, werden untersucht.
Welche Rolle spielt der historische Kontext?
Der historische Kontext von Roths Exil und seinem Kampf gegen den Nationalsozialismus spielt eine wichtige Rolle bei der Interpretation des Romans. Die Arbeit betont Roths Auseinandersetzung mit Antisemitismus als zentrales Thema und die formale Zweiteilung des Romans, die an Hagiographien erinnert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Joseph Roth, Tarabas, Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Osteuropa, Exil, Nationalsozialismus, christlicher Glaube, Läuterung, Buße, kollektiver Antisemitismus, individueller Antisemitismus, religiöser Antisemitismus, Aberglaube.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht "Tarabas" im Hinblick auf die Darstellung und Überwindung von Antisemitismus. Sie analysiert den Roman im Kontext von Roths Biografie und dem historischen Hintergrund, um ein umfassendes Verständnis des Themas zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Imke Barfknecht (Autor:in), 2004, Das Motiv des Antisemitismus in Joseph Roths "Tarabas", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67814