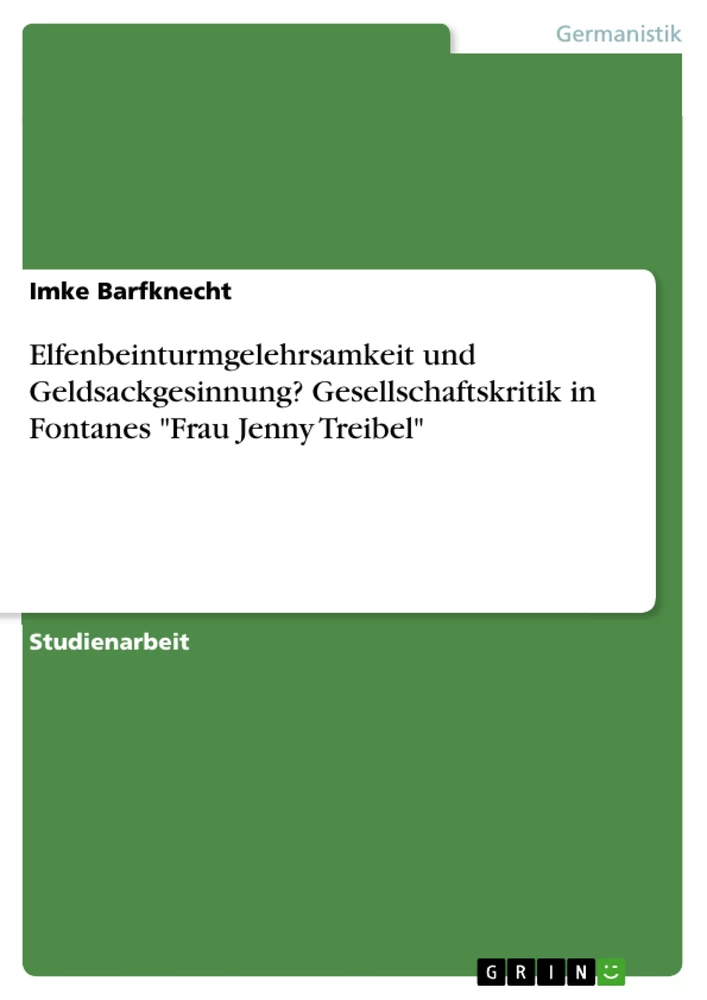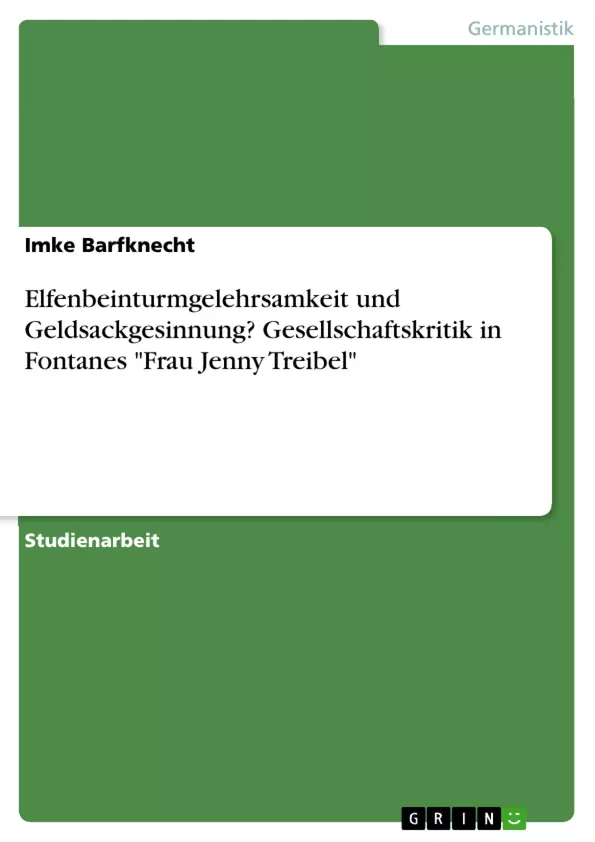In seinem 1892 erstmals erschienenen Roman „Frau Jenny Treibel oder ‚Wo sich Herz zum Herzen findt’“1 stellt Fontane die deutsche, im speziellen die Berliner, Gesellschaft vor dem Hintergrund der Veränderungen im Bewußtsein des Bürgertums und seiner Lebensart, als Folge der sozialen und wirtschaftlichen Einflüsse der Gründung des Deutschen Reiches, dar.
Innerhalb des Bürgertums kam es mit der fortschreitenden Industrialisierung zu einer Gewichtsverschiebung der verschiedenen Gruppierungen. War es vorher das Bildungsbürgertum, das das Bild des deutschen Bürgertums geprägt hatte, so waren es nun Wirtschaftbürger, die sowohl zahlenmäßig als auch bezüglich ihrer ökonomischen Macht an Bedeutung zunahmen.
Im Machtgefüge des neu vereinten Staates blieb das Bürgertum allerdings von der Teilnahme an politischen Entscheidungen ausgeschlossen. Während sich das Bildungsbürgertum von der Politik fernhielt2, sehnte sich das Wirtschaftsbürgertum nach politischer Macht und es versuchte dies zu erreichen, indem es sich verstärkt in seinen Denk- und Lebensformen dem Adel anpaßte. Durch diese „Aristokratisierung“ wollte man den neuen Führungsfunktionen, auf die man ja hoffte, gewachsen sein.3
[...]
1 Fontane, Theodor: Frau Jenny Treibel oder „Wo sich Herz zum Herzen findt“, in: ders.: Werke in fünf Bänden, Bd. 3, Berlin und Weimar 1977.
2 „Corinna, wenn ich nicht Professor wäre, so würd ich am Ende Sozialdemokrat.“ (Fontane, S. 342f.) Dieser Ausspruch Schmidts zeigt, daß er sich aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Bildungsbürgertum keiner politischen Partei anschließt, ganz so, als könne man nur eines sein: Professor oder Sozialdemokrat.
3 Die Folge diese Anpassung war, daß die Neureichen sich noch stolzer und standesbewußter aufführten als die adligen Familien. (Roch, Herbert: Fontane. Berlin und das 19. Jahrhundert, Düsseldorf 1985 [= Nachdruck der 1. Ausgabe von 1962], S. 256.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kommerzienrätin Jenny Treibel
- Herkunft und Erziehung
- Frau Kommerzienrätin vs. Jenny Bürstenbinder
- Die sentimentale Herzlose
- Kommerzienrat Treibel
- Der Dilettant
- Kritische Ironie ohne Konsequenz
- Professor Willibald Schmidt
- Der selbstironische Professor
- Kategorischer Imperativ ???
- Das Höhere
- Alles Unsinn?
- Corinna
- Des Vaters Tochter?
- Auf zu „fernen, glücklichen Küsten“
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In „Frau Jenny Treibel“ analysiert Fontane die deutsche Gesellschaft im Berlin der 1890er Jahre, insbesondere die Veränderungen im Bewusstsein des Bürgertums und seine Lebensart im Kontext der Industrialisierung und der Gründung des Deutschen Reiches.
- Der Gegensatz zwischen Besitzbürgertum und Bildungsbürgertum
- Die „Aristokratisierung“ des Wirtschaftsbürgertums und der Verlust der traditionellen bürgerlichen Ideale
- Die Rolle von Gefühl und Empfindung in der neuen Privatsphäre
- Die Kritik an der Verlogenheit und Oberflächlichkeit der bürgerlichen Lebensweise
- Die Frage nach dem Wert von Bildung und Tradition in einer sich verändernden Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die gesellschaftlichen Veränderungen im Berlin der 1890er Jahre vor und führt in das zentrale Thema des Romans ein: den Gegensatz zwischen Besitzbürgertum und Bildungsbürgertum. Die folgenden Kapitel analysieren die Hauptfiguren des Romans und deren unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft. So wird Jenny Treibel als Vertreterin des Besitzbürgertums vorgestellt, deren sentimentalen Gesten ihr eigentliches rücksichtsloses Wesen verschleiern. Der Kommerzienrat Treibel, Jennys Ehemann, wird als ein eher sympathischer Vertreter der Bourgeoisie dargestellt, der sich von Jennys Oberflächlichkeit und Heuchelei abhebt. Professor Willibald Schmidt, ein Vertreter des Bildungsbürgertums, steht im Gegensatz zu Jenny Treibel und verkörpert geistige Werte und eine kritische Distanz zur Oberflächlichkeit der Gesellschaft. Seine Tochter Corinna, die sich in Leopold Treibel, den Sohn des Kommerzienrats, verliebt, steht zwischen den beiden Welten von Bildung und Besitz. Die Schlußbetrachtung wird in dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt, da sie möglicherweise wichtige Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen des Romans enthüllen könnte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe, die in Fontanes „Frau Jenny Treibel“ erörtert werden, sind: Besitzbürgertum, Bildungsbürgertum, Industrialisierung, Gesellschaftskritik, Oberflächlichkeit, Sentimentalität, Verlogenheit, Bildung, Tradition, Familiäre, Privatsphäre, Zeitgeschichte, Berlin, 1890er Jahre.
Häufig gestellte Fragen
Welchen gesellschaftlichen Konflikt beschreibt Fontane in „Frau Jenny Treibel“?
Fontane thematisiert den Gegensatz zwischen dem aufstrebenden Wirtschaftsbürgertum (Besitzbürgertum) und dem traditionellen Bildungsbürgertum im Berlin der 1890er Jahre.
Was versteht man unter der „Aristokratisierung“ des Bürgertums?
Damit ist der Versuch des neureichen Wirtschaftsbürgertums gemeint, die Lebens- und Denkformen des Adels zu imitieren, um gesellschaftliches Ansehen und politische Macht zu erlangen.
Wer ist die Titelfigur Jenny Treibel?
Jenny Treibel ist eine Kommerzienrätin aus einfachen Verhältnissen, die ihre sentimentale Art als Maske für ihr eigentlich rücksichtsloses Streben nach Besitz und Status nutzt.
Welche Rolle spielt Professor Willibald Schmidt im Roman?
Schmidt vertritt das Bildungsbürgertum. Er verkörpert geistige Werte und begegnet der Oberflächlichkeit und Verlogenheit der Treibels mit kritischer Ironie und Distanz.
Warum ist Corinna Schmidt eine Schlüsselfigur?
Corinna steht zwischen den Welten. Als Tochter eines Professors strebt sie durch die Heirat mit Leopold Treibel nach materiellem Wohlstand, was den Konflikt zwischen Bildung und Besitz verdeutlicht.
- Quote paper
- Imke Barfknecht (Author), 2003, Elfenbeinturmgelehrsamkeit und Geldsackgesinnung? Gesellschaftskritik in Fontanes "Frau Jenny Treibel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67815