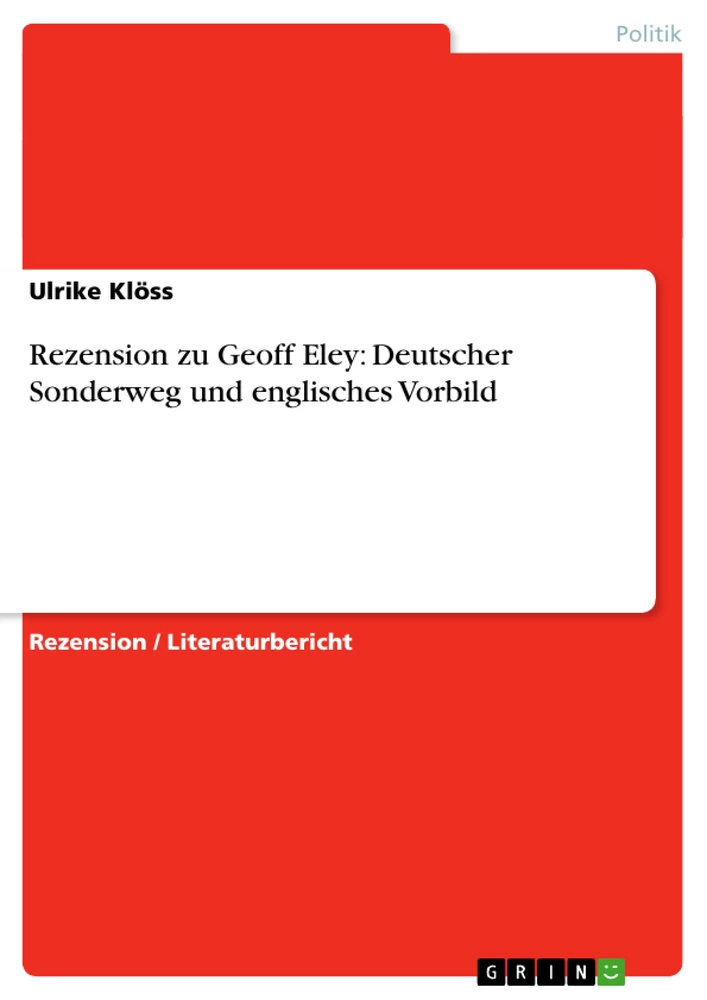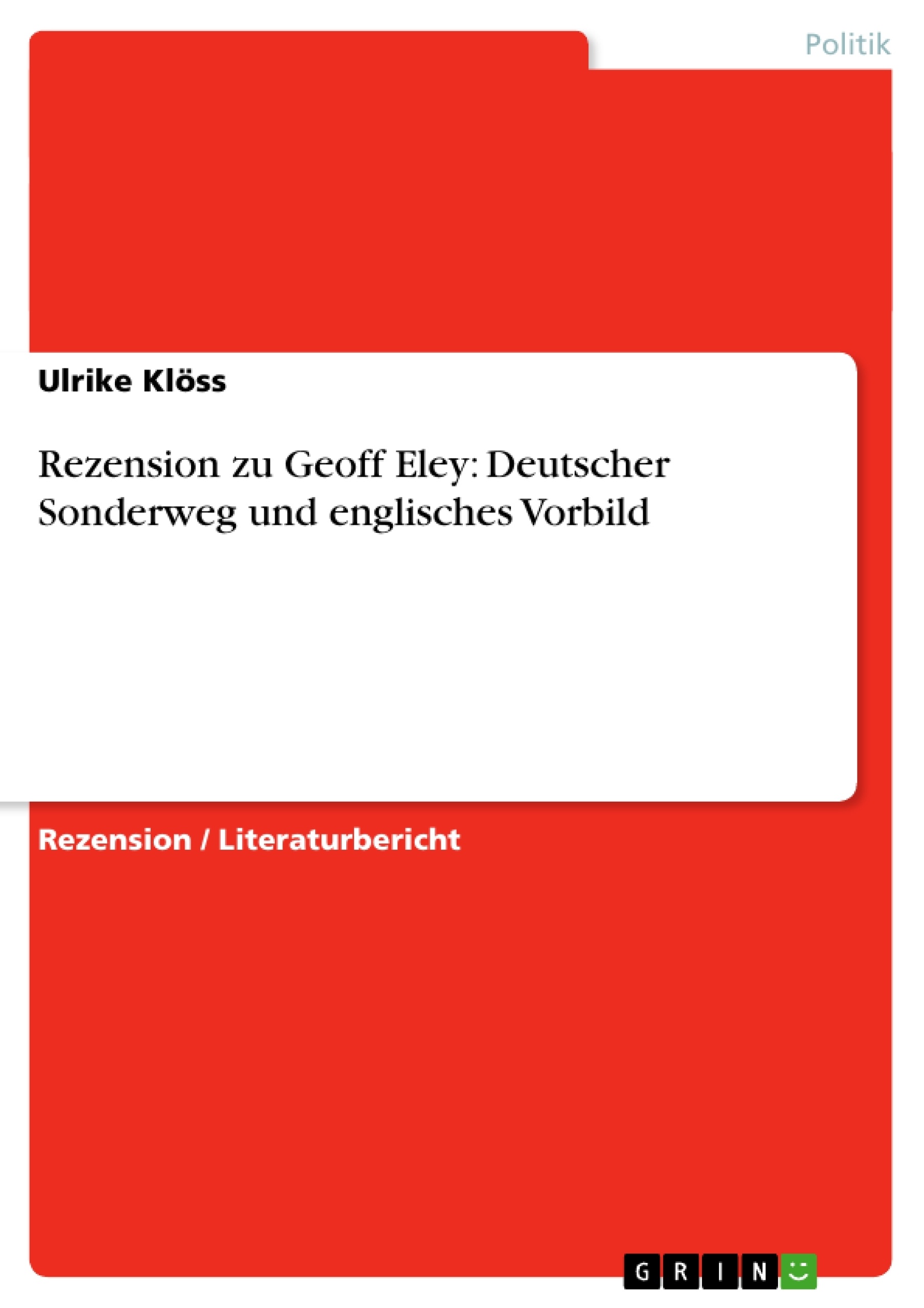Eleys stört sich an dem Begriff „ deutscher Sonderweg“, und was dieser beinhaltet. Er hinterfragt den Maßstab, an dem die Entwicklung Deutschlands ab 1848 gemessen und aufgrund dessen ihr die Färbung „falsch“ angehängt wird. Er möchte erklären, wie es dazu kam, dass dem Kaiserreich historisch nur eine bescheidene Zwischenrolle in der Entwicklung Deutschlands zugebilligt wird, und belegen, dass dem nicht so ist. 2. Geoff Eley: Deutscher Sonderweg und englisches Vorbild. Rezension. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Thema: Worum geht es?
- Geoff Eley: Deutscher Sonderweg und englisches Vorbild. Rezension
- Grundthese
- Entwicklung der Unterthesen
- Prüfung der Konsistenz der Argumentation
- Kritik
- Schlussbemerkung und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Geoff Eley hinterfragt in seinem Werk „Deutscher Sonderweg und englisches Vorbild“ die gängige Annahme, dass die deutsche Bourgeoise aufgrund ihrer Schwäche und mangelnden demokratischen Ambitionen für die autoritären Strukturen im Kaiserreich und den Aufstieg des Nationalsozialismus verantwortlich war. Er argumentiert, dass diese Interpretation auf einer falschen Geschichtsinterpretation basiert und die tatsächlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen der Zeit ausblendet.
- Widerlegung des Begriffs „deutscher Sonderweg“
- Bewertung der „bürgerlichen Revolution“ in Deutschland
- Rehabilitierung der deutschen Bourgeoise
- Kritik an der einseitigen Fokussierung auf liberale Ideale
- Analyse der Rolle von politischer und gesellschaftlicher Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Thema: Worum geht es?
Eley kritisiert den Begriff „deutscher Sonderweg“ und die damit verbundene Bewertung der deutschen Geschichte nach dem Maßstab der englischen Revolution. Er strebt danach zu erklären, warum dem Kaiserreich eine historisch untergeordnete Rolle zugewiesen wird und argumentiert, dass diese Einschätzung falsch ist.
Geoff Eley: Deutscher Sonderweg und englisches Vorbild. Rezension.
Grundthese
Eley widerspricht der verbreiteten Erklärung, dass die Schwäche der deutschen Bourgeoise die Festigung vorindustrieller Strukturen im Kaiserreich ermöglichte und so den Weg für den Nationalsozialismus ebnete. Er kritisiert die Annahme einer direkten Verbindung zwischen gesellschaftlichen Strukturen und dem politischen System und die Gleichsetzung von starkem Bürgertum mit liberalen Idealen. Er argumentiert, dass die deutsche Geschichte nicht allein an der Umsetzung liberaler Ideen durch das Bürgertum gemessen werden darf und die ökonomischen Bedingungen nicht außer Acht gelassen werden sollten.
Entwicklung der Unterthesen
Eley entwickelt seine Grundthese anhand von drei Unterthesen:
- Es gab eine erfolgreiche „bürgerliche Revolution“! Eley kritisiert die Annahme, dass eine erfolgreiche bürgerliche Revolution immer mit gewalttätigen Kämpfen und der vollständigen Demokratisierung einhergeht. Er definiert eine bürgerliche Revolution als Veränderung gesellschaftlicher und politischer Strukturen, die den Industriekapitalismus und die wirtschaftliche Expansion ermöglichen. Nach dieser Definition, darf man Deutschland seine Revolution nicht absprechen.
- Das deutsche Bürgertum war nicht schwach! Eley widerlegt die Vorstellung, dass die deutsche Bourgeoise aufgrund ihrer Schwäche die Demokratie nicht einführen konnte. Er argumentiert, dass die Bourgeoisie möglicherweise nicht den Bedarf sah, die politischen Verhältnisse radikal zu verändern, da sie ihre Interessen im bestehenden System vertreten konnte. Er kritisiert die Gleichsetzung von liberalen Gedanken mit einem starken Bürgertum und argumentiert, dass der Liberalismus von unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten getragen wurde. Er verweist auf den Vergleich mit England, um zu zeigen, dass auch dort eine starke Bourgeoise nicht automatisch zur Demokratie führte.
- Politische und gesellschaftliche Strukturen waren bewusst gewollt und kein Erbe „vorindustrieller“ Zeit. Eley hinterfragt die Frage, warum es im Kaiserreich nicht gelang, demokratisch-liberale Ansätze zu schaffen. Er stellt die Frage um, unter welchen Bedingungen eine bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft entstehen konnte und wie ein liberales politisches System geschaffen werden konnte. Er argumentiert, dass die politischen Strukturen im Kaiserreich gerechtfertigt waren, wenn man die damaligen wirtschaftlichen Bedingungen und die Entwicklung des Industriekapitalismus betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen im Werk „Deutscher Sonderweg und englisches Vorbild“ sind: Deutscher Sonderweg, bürgerliche Revolution, deutsche Bourgeoise, Liberalismus, Demokratie, Industriekapitalismus, politische und gesellschaftliche Strukturen, Kaiserreich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theorie des "deutschen Sonderwegs"?
Sie besagt, dass Deutschland einen "falschen" Weg in die Moderne einschlug, da das Bürgertum zu schwach war, um eine liberale Demokratie nach englischem oder französischem Vorbild zu erzwingen, was letztlich zum Nationalsozialismus führte.
Warum kritisiert Geoff Eley diesen Begriff?
Eley argumentiert, dass die deutsche Entwicklung nicht als "Abweichung" von einem idealisierten englischen Modell gesehen werden sollte. Er betont, dass das deutsche Bürgertum ökonomisch sehr wohl erfolgreich und einflussreich war.
Gab es laut Eley eine "bürgerliche Revolution" in Deutschland?
Ja, aber nicht im Sinne eines gewaltsamen Umsturzes. Für Eley fand eine Revolution der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen statt, die den Industriekapitalismus ermöglichte.
War das deutsche Bürgertum im Kaiserreich wirklich schwach?
Eley widerlegt dies. Er meint, die Bourgeoisie sah oft keine Notwendigkeit für eine radikale Demokratisierung, da ihre Interessen (Wirtschaftswachstum, Rechtssicherheit) auch im autoritären Kaiserreich gewahrt wurden.
Welchen Maßstab nutzt Eley für seine Analyse?
Er plädiert dafür, die Geschichte an den tatsächlichen ökonomischen und sozialen Bedingungen der Zeit zu messen, anstatt sie an einer nachträglich konstruierten "Normalentwicklung" anderer Länder zu spiegeln.
- Quote paper
- Ulrike Klöss (Author), 2005, Rezension zu Geoff Eley: Deutscher Sonderweg und englisches Vorbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68061