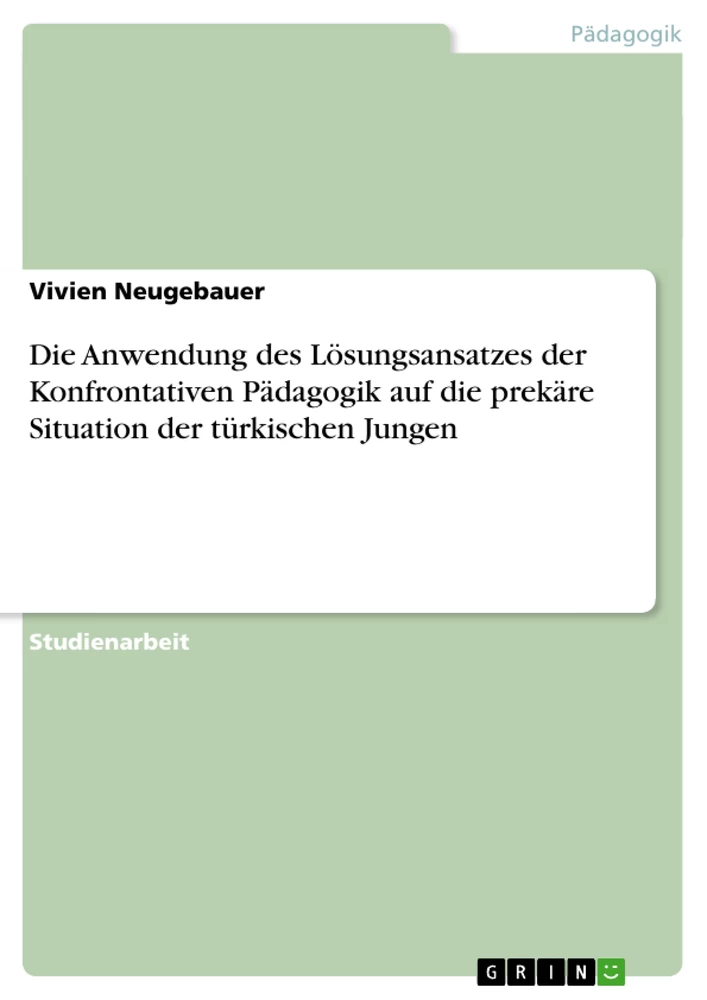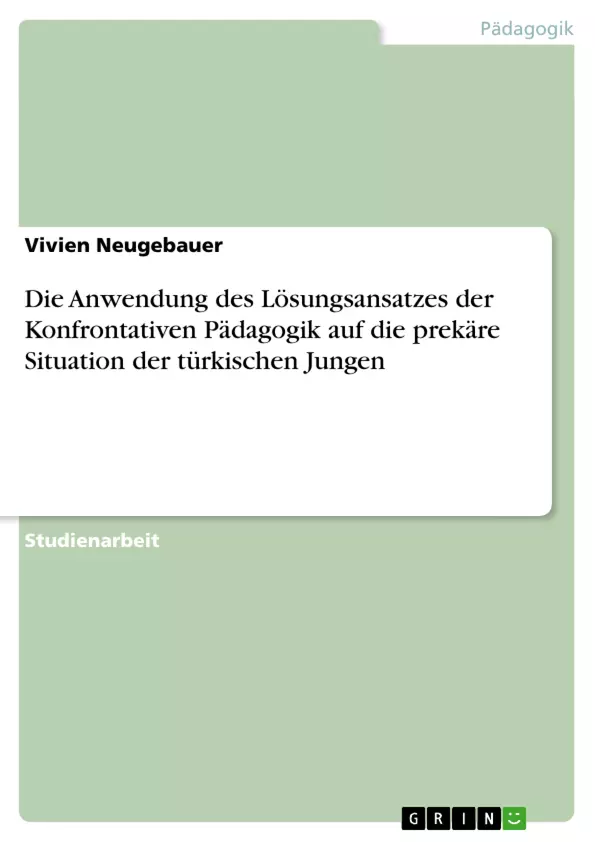Aktuelle Veröffentlichungen beweisen, dass das Interesse an „unseren“ Jungen in der Öffentlichkeit groß geworden ist. Autoren fragen, ob die „armen Jungen“ nun „die neuen Verlierer“ sind und stellen fest, dass die „kleinen Helden in Not“ sind.
Was aber passiert dann erst mit Jungen, deren Eltern ihre Heimat verlassen haben, um in Deutschland zu leben? Dies sind Jungen, die eine andere Sprache und im Fall der türkischen Migranten auch eine andere Religion mit bringen/besitzen.
Die PISA – Studien zeigen es ganz deutlich: Kinder, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind/wurden, schneiden signifikant schlechter ab als Kinder mit mindestens einem in Deutschland geborenen Elternteil.
Im Jahr 2000 wies die Förderschule in Deutschland mit 19,9% den höchsten Anteil an Ausländern auf. 10,3% der Hauptschule waren Kinder mit Migrationsgeschichte.
48% der ausländischen Schülerpopulation haben türkische Eltern, Großeltern oder stammen selbst aus der Türkei.
Da aus meiner Sicht die Kluft zwischen der deutschen und der türkischen Kultur im Vergleich zu den anderen in Deutschland vorherrschenden Migrantengruppen am größten ist und sie? den Großteil der gesamt ausländischen Bevölkerung ausmachen, soll in dieser Hausarbeit die Situation der türkischen Jungen in Deutschland thematisiert werden.
Dr. Ahmet Toprak, Diplom – Pädagoge und Referent für Gewaltprävention, spricht in der Einleitung zu seinem Buch „Jungen und Gewalt“ von einer Hilflosigkeit und Verunsicherung seitens der Pädagogen gegenüber den türkischen Jugendlichen. Mehrfachauffällige, auch gerade mit türkischer Herkunft, erscheinen erziehungsresistent. Für die Jugendlichen besteht keine primäre Veränderungsmotivation.
Es lässt vermuten, dass das Problem aus den unterschiedlichen Sprachen resultiert – jedoch sei es ebenso oder auch gerade das kulturelle Missverständnis, welches zu Konflikten führt. Worin liegt das Dilemma der türkischen Jungen wirklich?
Da unserer Gesellschaft das Dilemma der ausländischen Jugendlichen, insbesondere der türkischen Jungen, bewusst ist, soll in dieser Arbeit nicht allein die Schilderung der Situation sondern auch ein Lösungsansatz mit Hilfe der derzeit vieldiskutierte Konfrontative Pädagogik angeboten und hinterleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ausgangspunkt: Die Situation türkischer Jungen
- Die Erziehungsziele der türkischen Eltern
- Primäre Erziehungsziele
- Respekt vor Autoritäten
- Erziehung zur Ehrenhaftigkeit
- Erziehung zur Zusammengehörigkeit
- Erziehung zum Lernen und Leistungsstreben
- Sekundäre Erziehungsziele
- Erziehung zur türkischen Identität
- Erziehung zur religiösen Identität
- Tertiäre Erziehungsziele
- Primäre Erziehungsziele
- Konträre Werterziehung
- Gewaltfördernde Indikatoren
- Die Erziehungsziele der türkischen Eltern
- Die Konfrontative Pädagogik
- Das Konzept der Konfrontativen Pädagogik
- Die Anwendung der Konfrontativen Pädagogik bei türkischen Jugendlichen
- Die Konfrontative Gesprächsführung
- Die Konfliktlösung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Situation türkischer Jungen in Deutschland und analysiert die Herausforderungen, die aus der Diskrepanz zwischen den Erziehungszielen türkischer Eltern und den Werten der deutschen Gesellschaft entstehen können. Sie untersucht, wie diese Diskrepanz zu Gewaltfördernden Indikatoren führen kann und stellt die Konfrontative Pädagogik als einen möglichen Lösungsansatz vor.
- Die Erziehungsziele türkischer Eltern
- Die Herausforderungen der kulturellen Integration
- Konflikte zwischen familiären und gesellschaftlichen Werten
- Die Entstehung von Gewaltbereitschaft bei türkischen Jungen
- Die Konfrontative Pädagogik als Lösungsansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Situation türkischer Jungen in Deutschland, wobei die unterschiedlichen Erziehungsziele und Wertevorstellungen der türkischen Familien im Vordergrund stehen. Die Kapitel beleuchten die primären, sekundären und tertiären Erziehungsziele türkischer Eltern und untersuchen, wie diese zu Konflikten mit der deutschen Gesellschaft führen können. Darüber hinaus werden gewaltfördernde Indikatoren im Kontext der türkischen Jugendszene analysiert.
Im weiteren Verlauf stellt die Arbeit das Konzept der Konfrontativen Pädagogik vor und erörtert deren Anwendung im Umgang mit türkischen Jugendlichen. Das Kapitel beleuchtet die Konfrontative Gesprächsführung und Konfliktlösung als wichtige Elemente dieser pädagogischen Methode.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Hausarbeit sind die Herausforderungen der Integration türkischer Jungen in Deutschland, die Diskrepanz zwischen den Erziehungszielen türkischer Familien und den Werten der deutschen Gesellschaft, die Entstehung von Gewaltbereitschaft bei türkischen Jugendlichen und die Konfrontative Pädagogik als Lösungsansatz. Weitere wichtige Begriffe sind kulturelle Unterschiede, Identitätsentwicklung, Interkulturelle Kommunikation und Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen
Welche spezifischen Probleme haben türkische Jungen im deutschen Bildungssystem?
Statistiken wie die PISA-Studien zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund oft schlechter abschneiden. Türkische Jungen sind überproportional häufig an Förderschulen vertreten.
Was sind die primären Erziehungsziele türkischer Eltern?
Zu den zentralen Werten gehören der Respekt vor Autoritäten, die Erziehung zur Ehrenhaftigkeit, der familiäre Zusammenhalt sowie das Streben nach Leistung.
Wie entsteht eine "konträre Werterziehung"?
Sie entsteht durch die Diskrepanz zwischen den traditionellen Werten des Elternhauses und den individualistischen, oft liberaleren Werten der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Was ist Konfrontative Pädagogik?
Es ist ein Lösungsansatz für aggressives Verhalten, bei dem Regelverletzungen unmittelbar und klar gespiegelt werden, um eine Verhaltensänderung bei "erziehungsresistenten" Jugendlichen zu bewirken.
Warum ist die konfrontative Gesprächsführung bei türkischen Jugendlichen effektiv?
Sie durchbricht kulturelle Missverständnisse und Hilflosigkeit aufseiten der Pädagogen, indem sie klare Grenzen setzt und die Jugendlichen direkt mit ihrem Handeln konfrontiert.
Welche Rolle spielt die "Ehre" in diesem Kontext?
Die Erziehung zur Ehrenhaftigkeit ist ein zentrales Motiv, das bei Missverständnissen oder Verletzungen oft zu Konflikten oder Gewaltbereitschaft führen kann.
- Quote paper
- Vivien Neugebauer (Author), 2006, Die Anwendung des Lösungsansatzes der Konfrontativen Pädagogik auf die prekäre Situation der türkischen Jungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68190