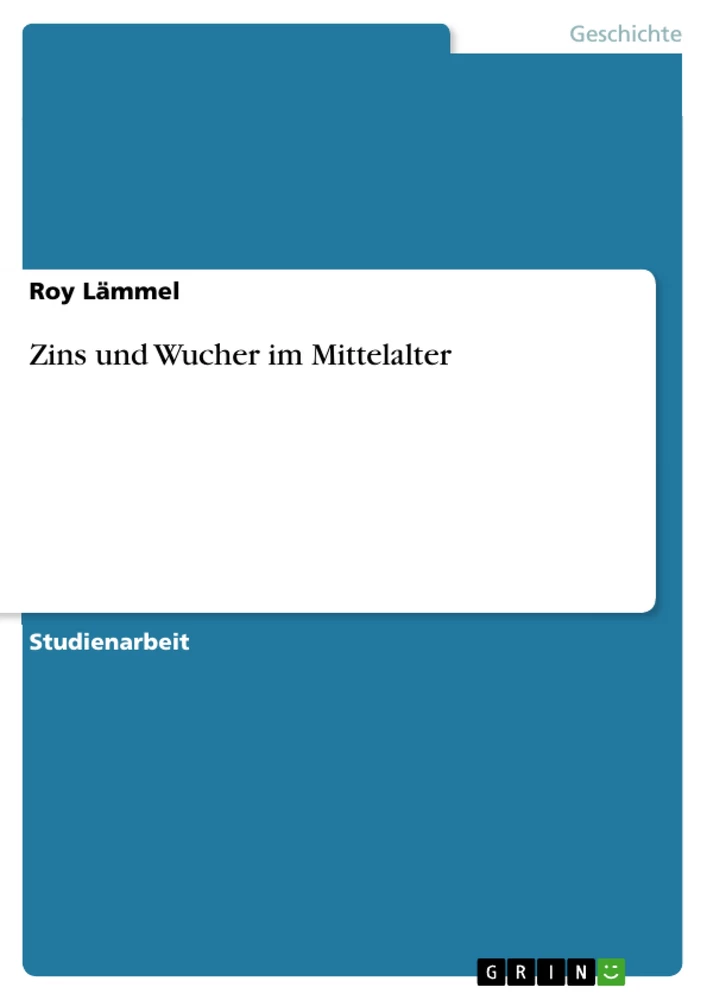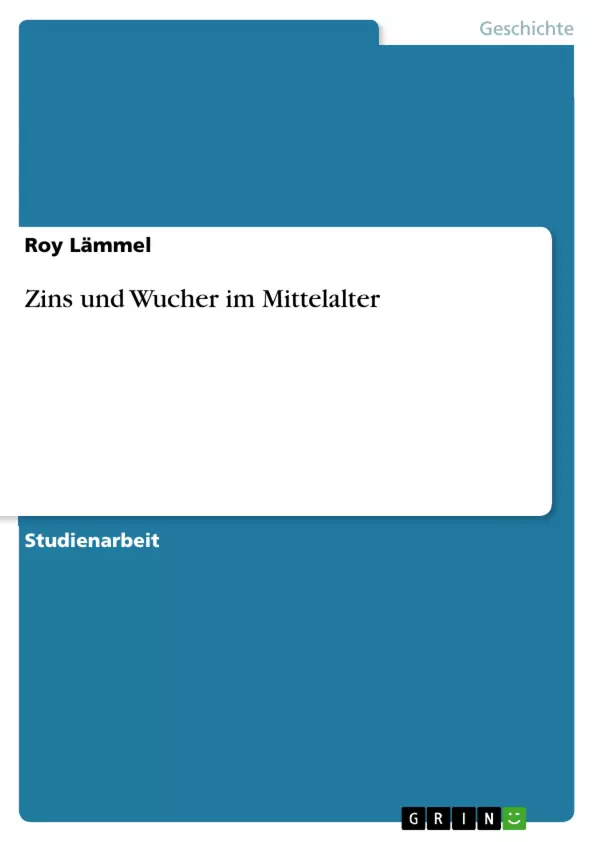Die vorliegende Arbeit über ein zentrales Thema mittelalterlicher Wirtschaftsgeschichte entstand im Rahmen eines Hauptseminars am Historischen Seminar der Universität Leipzig. Auch wenn auf den ersten Blick nur die Wirtschaftsgeschichte im Mittelpunkt zu stehen scheint, werden doch hierbei auch verschiedenste Spezialbereiche der Geschichtswissenschaft berührt. Nicht nur die ökonomische Entwicklung wird aufgezeigt, sondern auch Fragestellungen der Theologie, Mentalitäts- und Dogmengeschichte, natürlich nur in sehr eingeschränkter, themenbezogener Weise. In einem knappen Abriß werden zunächst die historische Entwicklung und sodann ausgewählte Fragestellungen, die für die Beurteilung der Thematik bedeutsam sind, erörtert werden. Daß dabei nicht alle Aspekte dieser facettenreichen Thematik erfaßt werden können, ergibt sich allein schon aus Art und Umfang dieser Arbeit. Trotz der für die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte recht hohen Bedeutung stellt sich doch die Literaturlage ein im wesentlichen als mager, insbesondere im Hinblick auf aktuelle deutschsprachige Literatur, dar. Es kann jedoch auf recht umfangreiche ältere Erkenntnisse zurückgegriffen werden, die in ihrer Mehrzahl noch immer dem heutigen Kenntnisstand entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Begriffsbestimmung
- Antike Vorbilder
- Wuchergesetzgebung in karolingischer Zeit
- Ökonomischer Aufschwung und Zinspolitik ab 11./12. Jahrhundert
- Die Zinstheorie des Thomas von Aquin
- Umgehungsstrategien
- Juden und Wucher
- Bedeutung der Wuchergesetze in der Praxis
- Legalisierung von Zins- und Kreditgeschäften
- Wirtschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Kreditwesens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung von Zins und Wucher im Mittelalter. Sie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen ökonomischen Gegebenheiten, theologischen Dogmen und rechtlichen Regelungen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Kreditwesens und der Auseinandersetzung mit dem Wucherverbot.
- Begriffliche Abgrenzung von Zins und Wucher im Mittelalter
- Einfluss antiker und theologischer Vorstellungen auf die Zinspolitik
- Entwicklung der Wuchergesetzgebung und ihre praktische Anwendung
- Ökonomische Auswirkungen der Zins- und Kreditgeschäfte
- Umgehungsstrategien des Wucherverbots
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen: Diese Einleitung erläutert den Kontext der Arbeit, die sich mit dem komplexen Thema von Zins und Wucher im Mittelalter auseinandersetzt. Sie betont die Überschneidung verschiedener Disziplinen, wie Wirtschaftsgeschichte, Theologie und Rechtsgeschichte, und verweist auf den begrenzten Umfang und die verfügbare Literatur. Die Arbeit beabsichtigt, einen knappen Überblick über die historische Entwicklung und ausgewählte Fragestellungen zu geben.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel klärt die Begriffe „Zins“ und „Wucher“ im mittelalterlichen Kontext. Es zeigt die unterschiedliche Verwendung des Begriffs „Zins“ für verschiedene Abgaben und die Entwicklung von „usura“ als Fachterminus für den verbotenen Zins. Die Arbeit hebt die Ambivalenz der Begriffe hervor, die durch die Nähe der Wuchergesetzgebung zu Bestimmungen gegen Betrug im Handel und die Preisregulierung entstanden ist. Die Vermeidung dieser Begriffe in Kaufmannssprache und die unterschiedliche Bezeichnung in Verträgen werden ebenfalls betrachtet.
Antike Vorbilder: Das Kapitel beschreibt die antiken Wurzeln der mittelalterlichen Wucherlehre. Die biblische Ablehnung der Kreditverzinsung als Ausbeutung Bedürftiger wird dargestellt, ebenso wie die aristotelische Sichtweise auf Geld als reines Tauschmittel. Der Text von Ambrosius, der "Alles, was über das Kapital hinaus gefordert wird, ist Wucher" definiert, wird vorgestellt. Die Kapitel beschreibt auch die antike Bekämpfung des Preiswuchers und dessen Verbindung zum Mißtrauen gegen den Handel.
Schlüsselwörter
Zins, Wucher, Mittelalter, Wirtschaftsgeschichte, Theologie, Recht, Kreditwesen, Wuchergesetzgebung, Ökonomie, Antike, Juden, Kreditgeschäfte, Preiswucher.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Zins- und Wucherproblematik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung von Zins und Wucher im Mittelalter. Sie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen ökonomischen Gegebenheiten, theologischen Dogmen und rechtlichen Regelungen und konzentriert sich auf die Bedeutung des Kreditwesens und die Auseinandersetzung mit dem Wucherverbot.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die begriffliche Abgrenzung von Zins und Wucher im Mittelalter, den Einfluss antiker und theologischer Vorstellungen auf die Zinspolitik, die Entwicklung der Wuchergesetzgebung und ihre praktische Anwendung, die ökonomischen Auswirkungen der Zins- und Kreditgeschäfte sowie Umgehungsstrategien des Wucherverbots.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Vorbemerkungen (Einführung und Kontext), Begriffsbestimmung (Klärung der Begriffe Zins und Wucher im Mittelalter), Antike Vorbilder (Einfluss antiker und biblischer Vorstellungen), Wuchergesetzgebung in karolingischer Zeit, Ökonomischer Aufschwung und Zinspolitik ab 11./12. Jahrhundert, Die Zinstheorie des Thomas von Aquin, Umgehungsstrategien, Juden und Wucher, Bedeutung der Wuchergesetze in der Praxis, Legalisierung von Zins- und Kreditgeschäften, Wirtschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Kreditwesens und Fazit.
Wie werden die Begriffe "Zins" und "Wucher" definiert?
Das Kapitel "Begriffsbestimmung" klärt die unterschiedliche Verwendung des Begriffs "Zins" für verschiedene Abgaben und die Entwicklung von "usura" als Fachterminus für den verbotenen Zins. Die Ambivalenz der Begriffe aufgrund der Nähe zu Bestimmungen gegen Betrug und Preisregulierung wird hervorgehoben. Die Vermeidung dieser Begriffe in Kaufmannssprache und unterschiedliche Bezeichnungen in Verträgen werden ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielten antike und theologische Vorstellungen?
Das Kapitel "Antike Vorbilder" beschreibt die biblische Ablehnung der Kreditverzinsung als Ausbeutung und die aristotelische Sichtweise auf Geld. Der Text von Ambrosius, der "Alles, was über das Kapital hinaus gefordert wird, ist Wucher" definiert, wird vorgestellt. Die antike Bekämpfung des Preiswuchers und dessen Verbindung zum Mißtrauen gegen den Handel werden ebenfalls behandelt.
Wie wurde das Wucherverbot in der Praxis umgesetzt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Wuchergesetzgebung und ihre praktische Anwendung, einschließlich der Umgehungsstrategien des Verbots und der Rolle der Juden im Kontext von Wuchergeschäften. Die wirtschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Kreditwesens und die schrittweise Legalisierung von Zins- und Kreditgeschäften werden ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zins, Wucher, Mittelalter, Wirtschaftsgeschichte, Theologie, Recht, Kreditwesen, Wuchergesetzgebung, Ökonomie, Antike, Juden, Kreditgeschäfte, Preiswucher.
- Quote paper
- M.A. Roy Lämmel (Author), 2004, Zins und Wucher im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68194