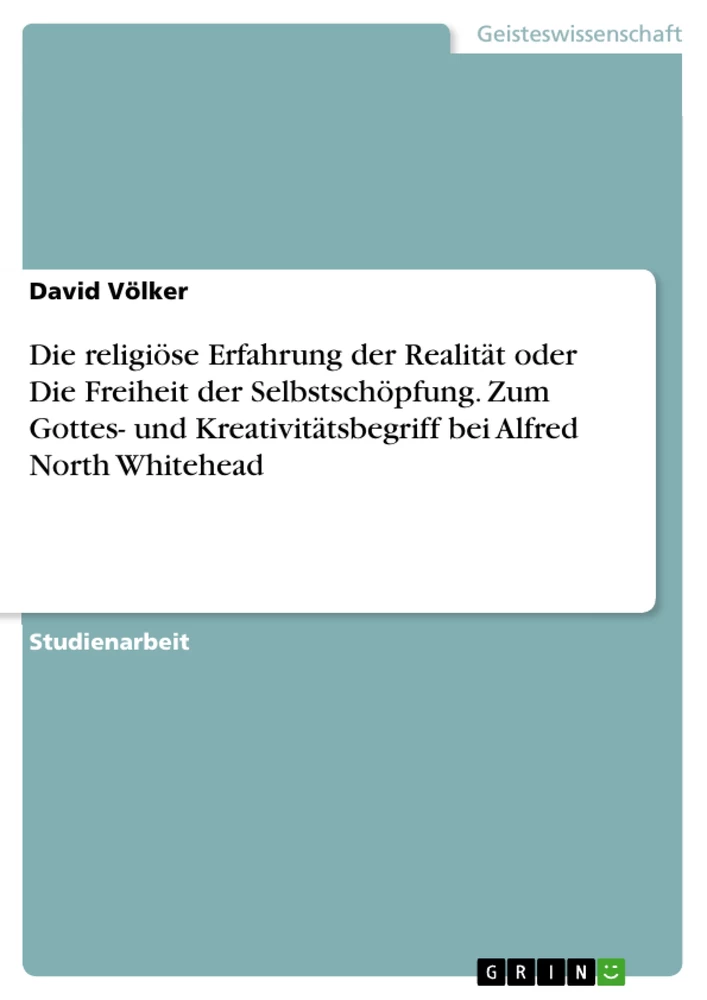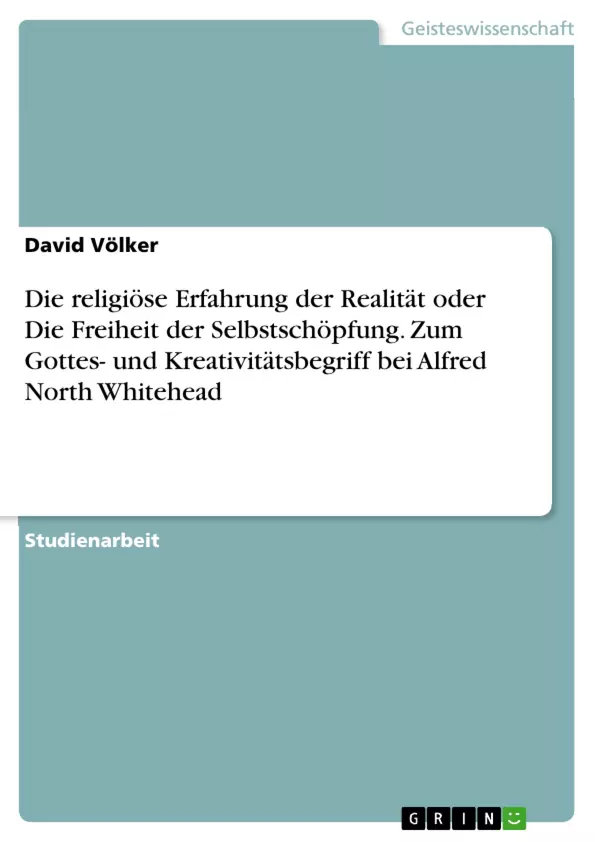In Abenteuer der Ideen kritisiert Whitehead an Platon dessen Umgang mit dem Problem, „die Beziehung zwischen Gott und der Welt und zwischen den Ideen, die Gott in seiner Kontemplation betrachtet, und der Welt zu charakterisieren.“ Dafür greift Platon auf das Bild einer schaustellerischen Nachahmung zurück. Wenn er sich nach der Betrachtung Gottes, der den Ideen durch Aufnahme in sein Wesen Leben und Bewegung gibt, der Welt zuwendet, kann er in ihr nur zweitklassige Imitationen finden, aber niemals Originale. Sogar gibt es bei Platon einen zweitklassigen, abgeleiteten Gott der Welt, der nichts weiter als ein Scheinbild (eikon) ist, wie die Ideen dieser Welt nichts weiter als Nachahmungen sind. Whitehead betont, dass die Welt für Platon nicht mehr als ein Nachbild Gottes und seiner Ideen, aber niemals Gott und die Ideen selber enthält.
Whitehead meint, dass Platon bestimmte Gründe hat, zwischen der vergänglichen Welt und dem ewigen Wesen Gottes diese Kluft zu lassen. Damit umgeht er jedoch gewisse Probleme:
1) Der Nachweis, wie die Vielheit der Individuen mit der Einheit des Universums verträglich ist.
2) Der Nachweis, warum für die Welt die Einheit mit Gott und für Gott die Einheit mit der Welt
notwendig ist.
3) Die Erklärung dafür, wie die Ideen, die im Wesen Gottes enthalten sind, eben auf Grund dieser ihrer
Beschaffenheit zu überredenden Elementen im schöpferischen Fortschritt werden.
Während Platon das abgeleitete Sein auf dem Willen Gottes beruhen lässt, muss es nach Whitehead ein Postulat der Metaphysik sein, dass die Beziehungen zwischen Gott und der Welt frei von aller Willkür und durch Wesensnotwendigkeiten Gottes und der Welt zu begründen sind. Whitehead konstatiert, dass es Platon nicht gelungen ist, die in den späten Dialogen Sophistes und Timaios entwickelte Überzeugung, dass das göttliche Element in der Welt als eine überredende, nicht aber als eine Zwang ausübende Macht zu betrachten ist, in einen systematischen Zusammenhang mit seiner übrigen Metaphysik zu bringen. Dennoch spricht Whitehead dieser Lehre Platons den Rang einer der größten intellektuellen Entdeckungen in der Geschichte der Religion zu. Whitehead versucht, diesen systematischen Zusammenhang in seiner Kosmologie mit Hilfe der Kategorie der Kreativität herzustellen. Sie stellt für ihn das überredende Element im schöpferischen Fortschritt dar, deren „wichtigste Verkörperung“ Gott ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der bipolare Gott und seine Wechselwirkung mit der Welt
- Gottes Urnatur
- Gottes Folgenatur
- Gott als wirkliches Einzelwesen
- Objektive Unsterblichkeit als Vollendung des universalen Prozesses
- Die Eigenschaft des Immerwährenden
- Religiöse Erfahrung ist das Verständnis der Wirklichkeit im Prozess mit Gott.
- Kreativität als Prinzip des Neuen
- Die innere Erfahrung der Kreativität
- Selbstschöpferisch sein bedeutet frei sein.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Alfred North Whiteheads Gottes- und Kreativitätsbegriff im Kontext seiner Philosophie. Sie untersucht, wie Whitehead die Problematik der Beziehung zwischen Gott und der Welt löst, indem er die Kategorie der Kreativität einführt. Der Fokus liegt darauf, wie Whitehead Platons Thesen weiterentwickelt und einen neuen Weg zu einer kosmologischen Perspektive aufzeigt.
- Whiteheads Kritik an Platons Gottes- und Weltbild
- Die bipolare Natur Gottes: Ur- und Folgenatur
- Die Rolle der Kreativität im schöpferischen Fortschritt
- Die Bedeutung der religiösen Erfahrung für Whiteheads Philosophie
- Die Verbindung von Kreativität und Religiosität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit Whiteheads Kritik an Platons Gottes- und Weltbild. Sie beleuchtet die Probleme, die aus Platons Unterscheidung zwischen der ewigen Welt der Ideen und der vergänglichen Welt entstehen. Whitehead argumentiert, dass Platon eine Kluft zwischen Gott und der Welt schafft, die zu weiteren Problemen führt, wie dem Nachweis der Einheit des Universums und der Vermittlung der Ideen in die Welt. Er betont, dass die Beziehung zwischen Gott und der Welt frei von Willkür sein muss und auf Wesensnotwendigkeiten beruhen sollte.
Der bipolare Gott und seine Wechselwirkung mit der Welt
Dieses Kapitel stellt Whiteheads bipolaren Gottesbegriff vor, der sich aus Ur- und Folgenatur zusammensetzt. Die Urnatur Gottes beschreibt seine Rolle als Ordnungsprinzip der zeitlosen Gegenstände, die die platonische Welt der Ideen ausmachen. Die Folgenatur hingegen beschreibt Gottes Partizipation an der Welt als wirkliches Einzelwesen. Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Aspekten von Gottes Ur- und Folgenatur, sowie mit der Bedeutung von Gottes Selbstkonstituierung.
Objektive Unsterblichkeit als Vollendung des universalen Prozesses
Dieses Kapitel untersucht die Konzepte der objektiven Unsterblichkeit und der Eigenschaft des Immerwährenden. Es wird erläutert, wie die objektive Unsterblichkeit die Vollendung des universalen Prozesses darstellt. Die religiöse Erfahrung wird als das Verständnis der Wirklichkeit im Prozess mit Gott beschrieben.
Kreativität als Prinzip des Neuen
Dieses Kapitel widmet sich dem Konzept der Kreativität als Prinzip des Neuen. Die innere Erfahrung der Kreativität und die Bedeutung der Selbstschöpfung werden im Zusammenhang mit der Freiheit des Einzelnen diskutiert. Das Kapitel argumentiert, dass Selbstschöpfung und Kreativität in einer engen Beziehung stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die zentralen Konzepte von Alfred North Whiteheads Philosophie, insbesondere die bipolare Natur Gottes, die Rolle der Kreativität im schöpferischen Fortschritt und die Verbindung von Religiosität und Kreativität. Weitere Schlüsselbegriffe sind die objektive Unsterblichkeit, die Eigenschaft des Immerwährenden und die religiöse Erfahrung.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Alfred North Whitehead die Beziehung zwischen Gott und der Welt?
Whitehead sieht eine wechselseitige Notwendigkeit: Die Welt braucht Gott als Ordnungsprinzip, und Gott braucht die Welt zur Realisierung seiner Folgenatur.
Was ist der Unterschied zwischen Gottes Urnatur und Folgenatur?
Die Urnatur ist Gottes zeitloses Ordnungsprinzip der Ideen. Die Folgenatur ist Gottes Partizipation am zeitlichen Prozess der Welt als wirkliches Einzelwesen.
Welche Rolle spielt die Kreativität bei Whitehead?
Kreativität ist das Prinzip des Neuen und das „überredende Element“ im schöpferischen Fortschritt, dessen wichtigste Verkörperung Gott selbst ist.
Wie kritisiert Whitehead Platons Metaphysik?
Er kritisiert die Kluft, die Platon zwischen der ewigen Welt der Ideen und der vergänglichen Welt lässt, wodurch die Welt nur als zweitklassige Imitation Gottes erscheint.
Was bedeutet „objektive Unsterblichkeit“?
Es beschreibt die Vollendung des universalen Prozesses, in dem vergangene Ereignisse im Wesen Gottes bewahrt werden und so unvergänglich werden.
- Quote paper
- David Völker (Author), 2004, Die religiöse Erfahrung der Realität oder Die Freiheit der Selbstschöpfung. Zum Gottes- und Kreativitätsbegriff bei Alfred North Whitehead, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68212