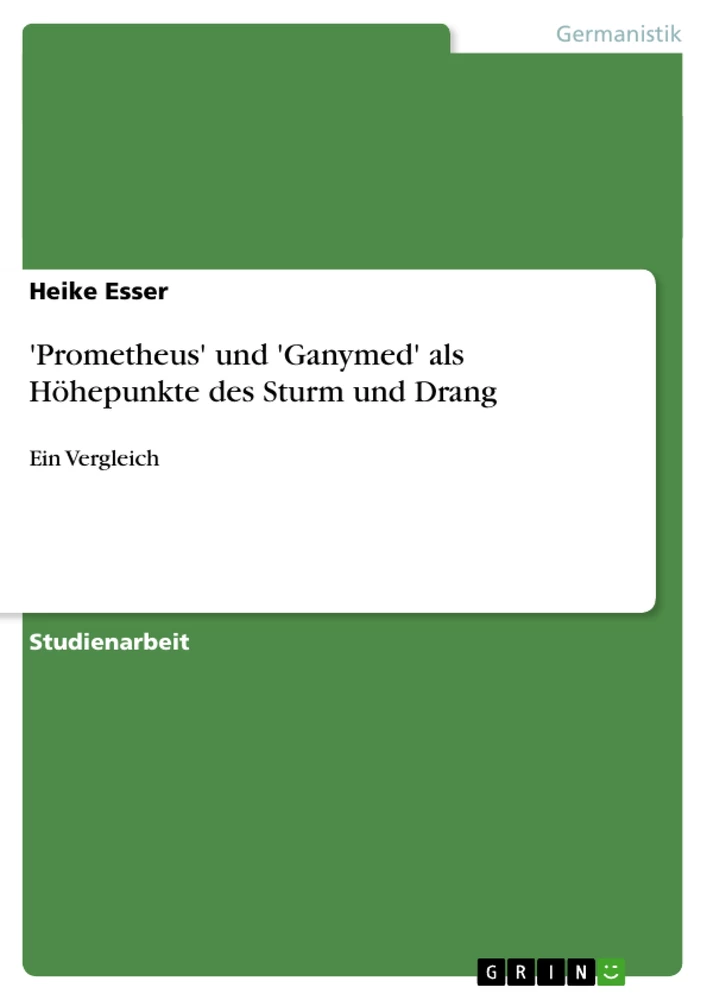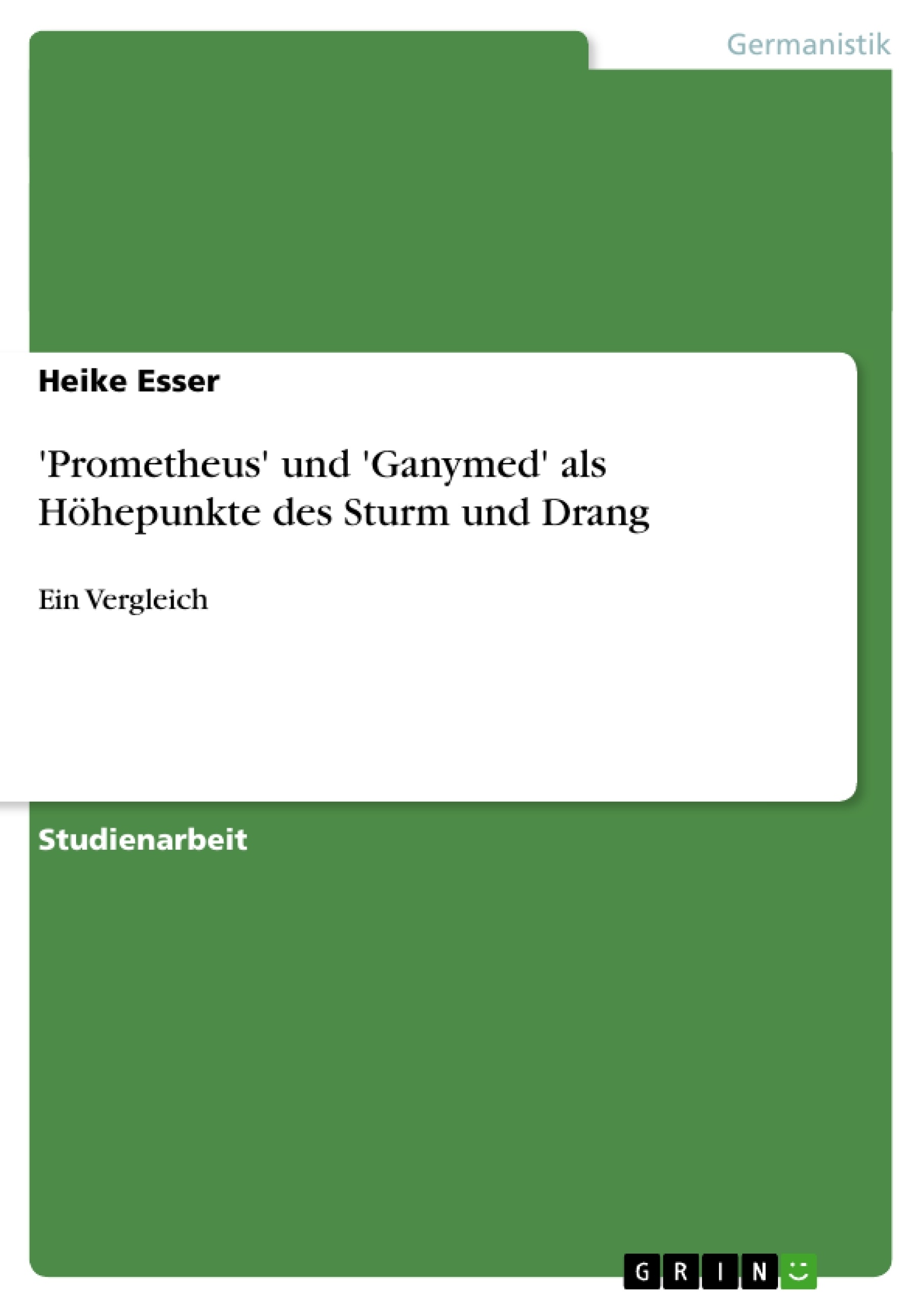Diese Arbeit setzt sich mit Goethes Hymnen "Prometheus" und "Ganymed" auseinander, die als lyrische Höhepunkte des Sturm und Drang gelten und programmatisch die Selbstermächtigung des Subjekts, die Selbstvergöttlichung des Genies, das sich von veralteten Autoritäten lossagt, ein neues Selbstbewusstsein und eine lebensbejahende Menschheit fordern. Auf den ersten Blick erscheinen die beiden Gedichte als vollkommene Gegensätze von Gottesverachtung und Hingabe an Gott, denn "Prometheus" steht als "Kulturstifter" für das aufklärerische Bestreben ein, sich gegen die angestammten "Vater-Autoritäten" die Freiheit zum Selberdenken, Selberhandeln und Selberdichten zu erstreiten. In "Ganymed" äußert sich die Erkenntnis, dass der Mensch in einer vollkommenen Einheit mit der Natur und dem Göttlichen existiert. Dieses Bewusstsein von Geborgenheit, dem Aufgehobensein in der Einheit mit Gott und der Natur, treibt die schon in "Prometheus" geforderte neue Lebensbejahung auf die Spitze und verwirklicht sie.
Diese Arbeit liefert eine ausführliche Interpretation beider Hymnen, die neben dem Inhalt, der Form und der Sprache auch auf die Entstehung und den zugrunde liegenden Mythos eingeht und sich in einem abschließenden Vergleich die Gedichte auf das Programm der Stürmer und Dränger bezieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interpretation von „Prometheus“ und „Ganymed“
- 2.1 Prometheus
- 2.1.1 Entstehung und Mythos
- 2.1.2 Interpretation
- 2.1.3 Die Autonomie-Erklärung auf der politischen und persönlichen Ebene
- 2.2 „Ganymed“
- 2.2.1 Entstehung und Struktur
- 2.2.2 Interpretation
- 2.2.3 Der Mythos und Goethes Lebensgefühl
- 2.1 Prometheus
- 3. Resümee und Vergleich der Hymnen als Zeugnisse des Sturm und Drang
- 3.1 Die Gottesvorstellung und der Genie-Gedanke
- 3.2 Prometheus und Ganymed als Sturm und Drang-Lyrik unter dem Aspekt von Form und Sprache
- 3.3 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes Hymnen „Prometheus“ und „Ganymed“ im Kontext des Sturm und Drang. Die Zielsetzung besteht darin, das Verhältnis der beiden Gedichte zueinander zu analysieren und deren Bedeutung als Höhepunkte der Sturm und Drang-Periode zu belegen. Die Arbeit geht über eine reine Rezeption von Goethes eigenen Interpretationen hinaus.
- Die Selbstvergöttlichung des Genies im Sturm und Drang
- Der Aufruf zur Selbstbestimmung und die Loslösung von traditionellen Autoritäten
- Der Gegensatz und die komplementäre Beziehung zwischen Gottesverachtung und Hingabe an Gott
- Die poetische Autonomie-Erklärung in der Form der Hymne
- Form und Sprache als Ausdruck des Sturm und Drang
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden Hymnen „Prometheus“ und „Ganymed“ als programmatische Höhepunkte des Sturm und Drang vor, die die Selbstermächtigung des Subjekts und die Selbstvergöttlichung des Genies repräsentieren. Sie hebt den scheinbaren Gegensatz zwischen Gottesverachtung (Prometheus) und Hingabe an Gott (Ganymed) hervor, betont aber gleichzeitig die komplementäre Beziehung zwischen beiden Gedichten, wie Goethe selbst sie in „Dichtung und Wahrheit“ beschreibt. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz: separate Interpretationen der Hymnen, gefolgt von einem vergleichenden Teil, der sich auf den Gottesbegriff und die Merkmale der Sturm und Drang-Lyrik konzentriert.
2. Interpretation von „Prometheus“ und „Ganymed“: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Interpretation von Goethes „Prometheus“ und „Ganymed“. Es beginnt mit der Entstehung und dem Mythos von Prometheus, untersucht die poetische Umsetzung des Mythos durch Goethe und analysiert die Rebellion des lyrischen Ichs gegen den Herrschergott Zeus als Ausdruck einer umfassenden Loslösung von Autoritäten (religiösen, politischen, persönlichen und poetischen). Die Hymnenform wird als poetische Autonomieerklärung interpretiert, die traditionelle Elemente umkehrt. Im zweiten Teil wird die Interpretation von „Ganymed“ folgen, einschließlich seiner Entstehung, Struktur, sowie der Einbettung des Mythos in Goethes Lebensgefühl.
Schlüsselwörter
Sturm und Drang, Goethe, Prometheus, Ganymed, Hymne, Genie, Selbstvergöttlichung, Selbstbestimmung, Gottesvorstellung, Autonomie, Rebellion, Autorität, Form, Sprache.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Prometheus" und "Ganymed"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Hymnen "Prometheus" und "Ganymed" im Kontext des Sturm und Drang. Sie untersucht das Verhältnis der beiden Gedichte zueinander und belegt deren Bedeutung als Höhepunkte dieser literarischen Epoche. Die Analyse geht über reine Rezeptionen von Goethes eigenen Interpretationen hinaus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Selbstvergöttlichung des Genies im Sturm und Drang, dem Aufruf zur Selbstbestimmung und der Loslösung von traditionellen Autoritäten, dem Gegensatz und der komplementären Beziehung zwischen Gottesverachtung und Hingabe an Gott, der poetischen Autonomie-Erklärung in der Form der Hymne sowie Form und Sprache als Ausdruck des Sturm und Drang.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Interpretation von "Prometheus" und "Ganymed", und ein Resümee mit Vergleich der Hymnen. Die Einleitung stellt die Hymnen als programmatische Höhepunkte des Sturm und Drang vor und skizziert den methodischen Ansatz. Das Hauptkapitel bietet detaillierte Interpretationen beider Gedichte, inklusive Entstehungsgeschichte und mythologischem Hintergrund. Das Resümee vergleicht die Gedichte hinsichtlich Gottesvorstellung und Merkmalen der Sturm und Drang-Lyrik.
Wie werden "Prometheus" und "Ganymed" interpretiert?
Die Interpretation von "Prometheus" analysiert die Rebellion des lyrischen Ichs gegen Zeus als Ausdruck der Loslösung von Autoritäten. Die Hymnenform wird als poetische Autonomieerklärung interpretiert. Die Interpretation von "Ganymed" untersucht die Einbettung des Mythos in Goethes Lebensgefühl und seine Struktur.
Welchen Stellenwert haben Form und Sprache in der Analyse?
Form und Sprache der Gedichte werden als Ausdruck des Sturm und Drang untersucht und analysiert, um die poetische Autonomie und die Selbstvergöttlichung des Genies zu belegen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sturm und Drang, Goethe, Prometheus, Ganymed, Hymne, Genie, Selbstvergöttlichung, Selbstbestimmung, Gottesvorstellung, Autonomie, Rebellion, Autorität, Form, Sprache.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die komplementäre Beziehung zwischen "Prometheus" und "Ganymed" auf, trotz des scheinbaren Gegenteils zwischen Gottesverachtung und Hingabe an Gott. Beide Gedichte repräsentieren die Selbstermächtigung des Subjekts und die Selbstvergöttlichung des Genies im Sturm und Drang.
- Quote paper
- Heike Esser (Author), 2004, 'Prometheus' und 'Ganymed' als Höhepunkte des Sturm und Drang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68250