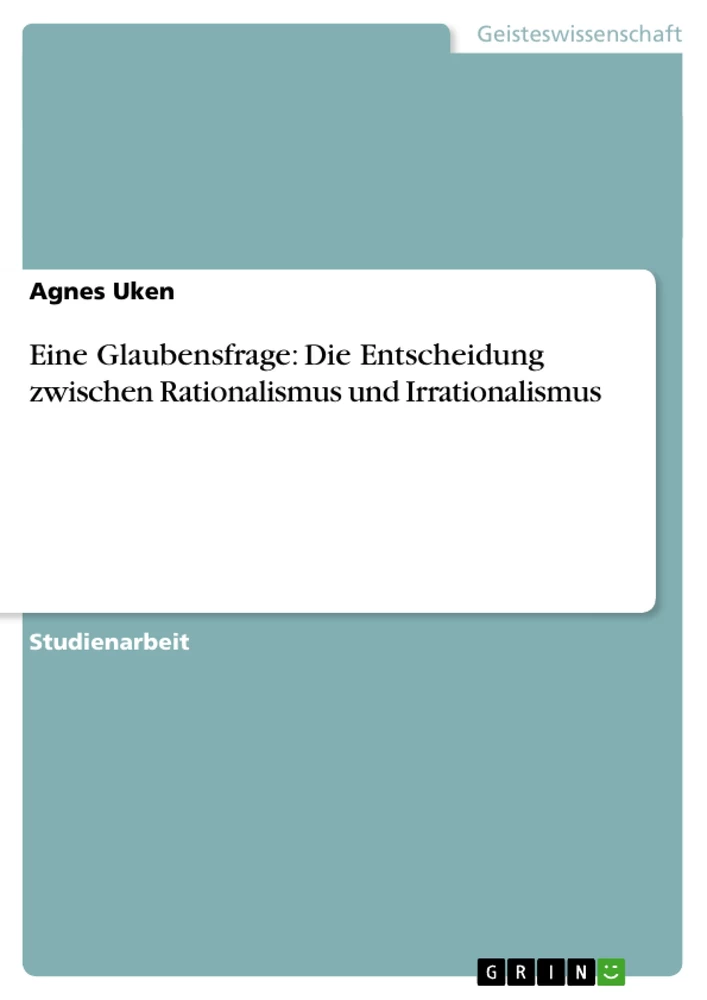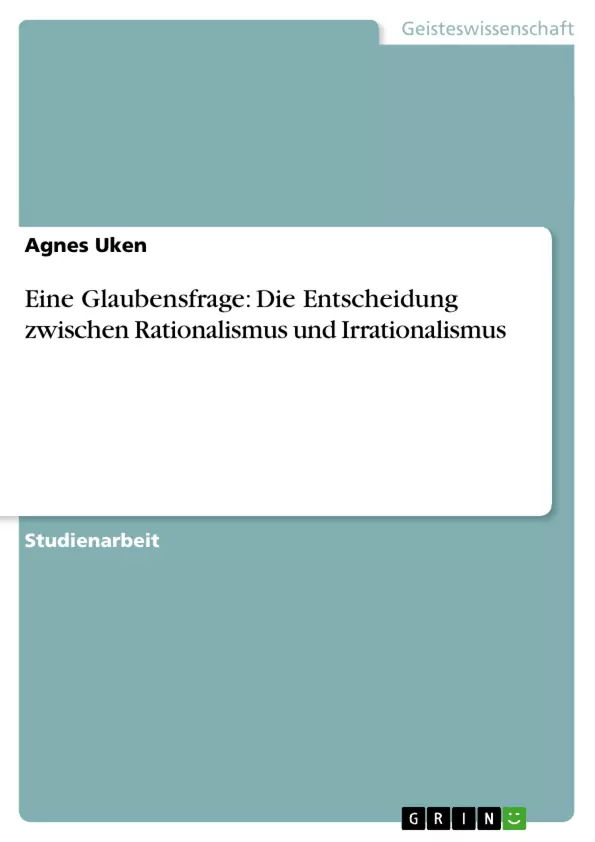Karl Popper geht im Kapitel 24 seines Buches „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ davon aus, dass der traditionelle Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion überwunden sei. Die Frage der Wahl zwischen Wissen und Glauben stelle sich somit nicht mehr, sondern es gäbe lediglich noch eine Wahl zwischen zwei Glaubensarten. Zum einen den kritischen Rationalismus mit dem Glauben an die Vernunft und zum anderen den Irrationalismus mit dem Glauben an mystische, d.h. rational nicht erklärbare Fähigkeiten und an Gefühle. Warum es sich bei der Wahl zwischen diesen beiden Glaubensarten für Popper um eine moralische Frage handelt, soll im ersten Teil der Arbeit verdeutlicht werden.
Die Frage der Möglichkeit der Synthese von Vernunft und Glaube in einer von wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägten Welt ist für Popper in der bisherigen Weise nicht mehr relevant, da für ihn auch der Entscheidung für Vernunft und Wissenschaft ein Glaube zu Grunde liegt. Um den Glauben kommen wir nach Popper nicht herum, so dass sich nun die Frage erhebt, welche Art von Glaube der moralisch richtige ist. Popper bekennt sich zu einem Glauben an die menschliche Vernunft als Grundlage für die Einheit der Menschheit und als Garant für Frieden und Gleichheit aller Menschen. Diesen Glauben an die Vernunft sieht Popper durch historische Prophezeiungen und irrationalistische Auffassungen angegriffen. Daraus entwickelt Popper die These, der Konflikt zwischen dem Rationalismus und dem Irrationalismus sei der wichtigste intellektuelle und moralische Konflikt unserer Zeit.
Der Position Poppers wird im zweiten Teil der Arbeit die Auffassung Papst Johannes Pauls II gegenüber gestellt, der nach Popper als ein typischer Vertreter des Irrationalismus angesehen werden kann. Eine Zwischenposition wird William James mit seinem Essay „The will to believe“ einnehmen, da er sich zwar wie Papst Johannes Paul II auf andere Erkenntnisformen neben der Vernunft beruft, aber eine Wahrheitsauffassung vertritt, die der Poppers vergleichbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Irrationalismus versus Rationalismus
- Konsequenzen der Wahl der Glaubensart
- Zwei Erkenntnisvermögen: Glaube und Vernunft
- Die Suche nach der Wahrheit – ein unlösbares Rätsel?
- Eine Rechtfertigung des Glaubens
- Der Glaube - eine echte Option
- Empiristischer und absolutistischer Wahrheitsbegriff
- Die religiöse Hypothese
- Existentielle Entscheidungen
- Religion als Kontingenzbewältigung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, den Konflikt zwischen Rationalismus und Irrationalismus im Kontext von Wissenschaft und Religion zu untersuchen. Sie analysiert die Positionen von Karl Popper, Johannes Paul II. und William James, um die verschiedenen Perspektiven auf die Wahl zwischen Vernunft und Glaube zu beleuchten.
- Die Natur und Bedeutung des Rationalismus und Irrationalismus
- Die moralischen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Wahl zwischen Vernunft und Glaube
- Die Rolle von Erfahrung und Argumentation im Erkenntnisprozess
- Die unterschiedlichen Wahrheitsauffassungen im Kontext von Wissenschaft und Religion
- Die Bedeutung von Glaubensentscheidungen für die menschliche Existenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den historischen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion dar und führt den Leser in die zentrale Fragestellung der Hausarbeit ein: Die Wahl zwischen Rationalismus und Irrationalismus.
- Das Kapitel „Irrationalismus versus Rationalismus“ definiert die beiden Konzepte und untersucht die Position von Karl Popper, der einen kritischen Rationalismus befürwortet. Der Autor analysiert die Argumente für und gegen einen selbstkritischen Ansatz zur Vernunft.
- Im Kapitel „Konsequenzen der Wahl der Glaubensart“ werden die Auswirkungen der Entscheidung für Rationalismus oder Irrationalismus auf das menschliche Zusammenleben und die soziale Ordnung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Rationalismus, Irrationalismus, Wissenschaft, Religion, Vernunft, Glaube, Erkenntnis, Wahrheit, Moral, Gesellschaft, Popper, Johannes Paul II., William James, kritische Rationalismus, Erfahrung, Argumentation, Falsifizierbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Karl Popper unter "kritischem Rationalismus"?
Es ist der Glaube an die menschliche Vernunft als Grundlage für die Einheit der Menschheit und ein Instrument zur Sicherung von Frieden und Gleichheit.
Warum ist die Wahl zwischen Rationalismus und Irrationalismus laut Popper eine moralische Frage?
Weil die Entscheidung für oder gegen die Vernunft weitreichende Konsequenzen für das gesellschaftliche Zusammenleben und die soziale Ordnung hat.
Welche Position vertritt Papst Johannes Paul II. in diesem Konflikt?
Er wird als Vertreter einer Position gesehen, die neben der Vernunft auch andere Erkenntnisformen (Glauben, Offenbarung) als wesentlich für die Wahrheitsfindung betrachtet.
Wie vermittelt William James zwischen Glaube und Vernunft?
In seinem Essay „The will to believe“ argumentiert er, dass Glaube eine berechtigte Option sein kann, wenn die Vernunft allein keine endgültige Antwort auf existenzielle Fragen geben kann.
Ist der Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion laut Popper überwunden?
Popper meint ja, da es sich heute eher um eine Wahl zwischen zwei Arten des Glaubens handelt: dem Glauben an die Vernunft oder dem Glauben an das Mystische.
- Arbeit zitieren
- Agnes Uken (Autor:in), 2001, Eine Glaubensfrage: Die Entscheidung zwischen Rationalismus und Irrationalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68272