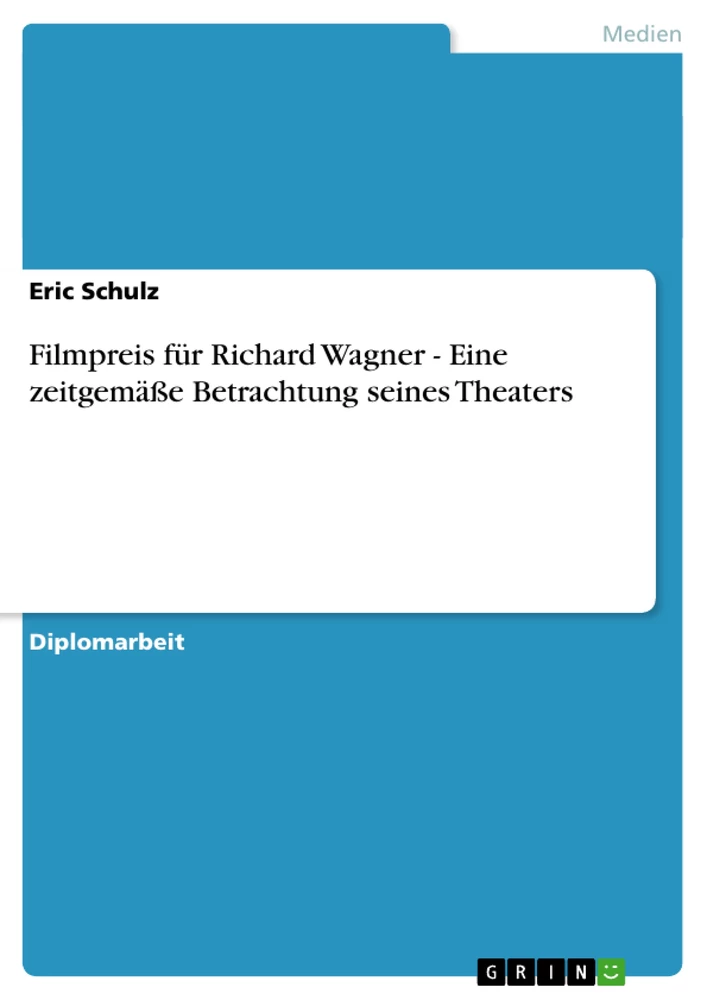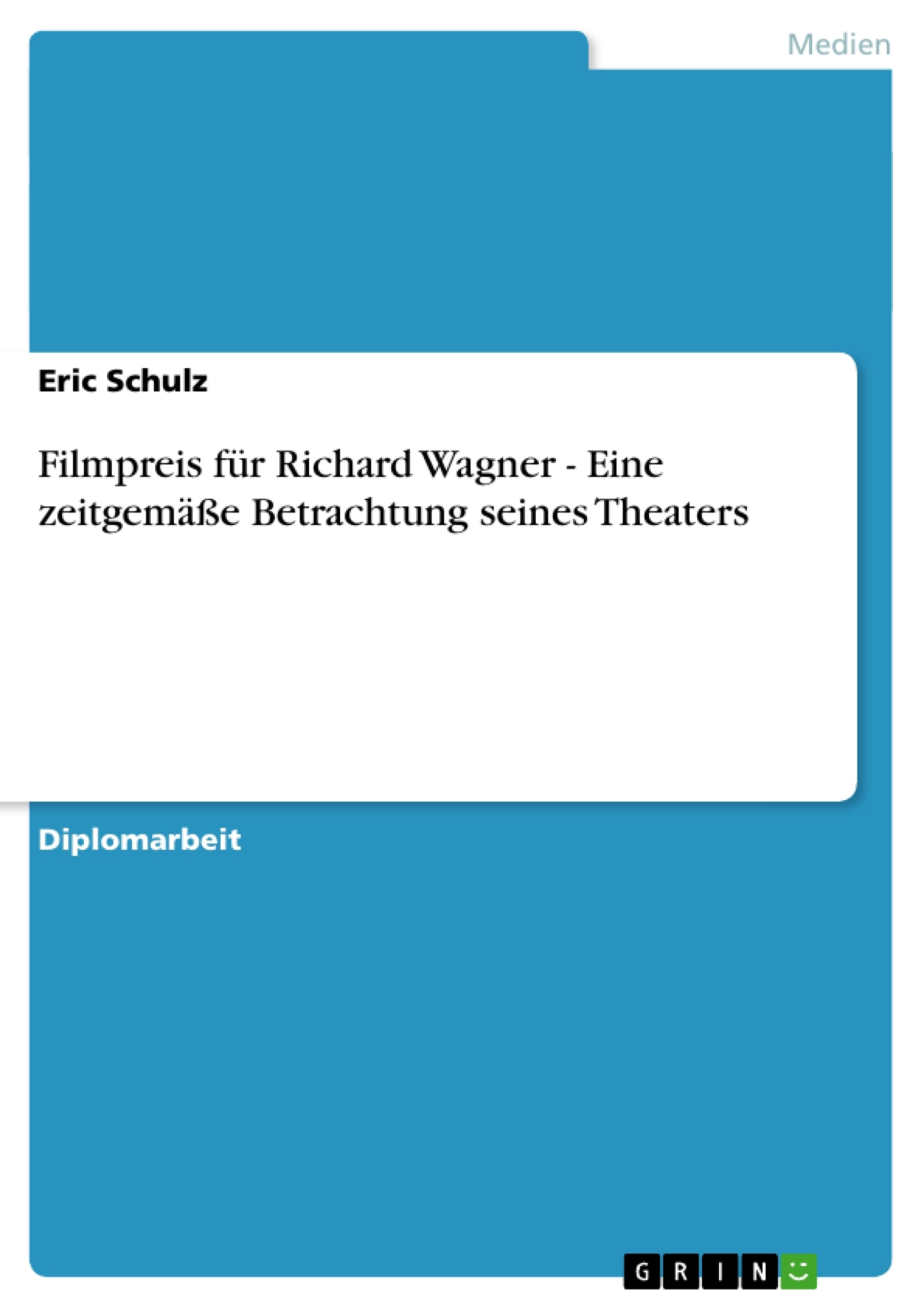Am liebsten wäre Richard Wagner „unsinnig alt“ geworden und dann gemeinsam mit seiner Frau Cosima „in seinem Stübchen“ auf einem eigens dafür eingerichteten Sofa „an der Euthanasie“ gestorben. Dazu kam es jedoch nicht. Auch seinen mehrfach geäußerten Vorsatz „94 Jahre alt zu werden“ konnte er nicht einlösen, noch brachte er seine Familie in seiner „Todesstunde zum Lachen“, wie er es sich einmal im Scherz triumphierend vorgestellt hatte.
Keine zwei Monate vor seinem plötzlichen, aber nicht ganz unerwarteten Tod im Alter von 69 Jahren hatte sich der schon länger von regelmäßigen Herzanfällen heimgesuchte Wagner „noch etwa zehn rüstige Lebensjahre“ gegeben, welche er, wie schon das vergangene Jahrzehnt, darauf verwenden wollte, seinem „Kunstwerk der Zukunft“ die nächste und zugleich fernere Zukunft zu sichern. Als Wagner schließlich im Januar 1883 seinen Tod in Venedig fand, hatte er zwar auf dem Papier sein Lebenswerk vollendet, darüber hinaus war es jedoch lange noch nicht abgeschlossen. Auch ein paar weitere Jahre hätten ihn allerdings nicht aus dem Dilemma zwischen Wunsch und Wirklichkeit befreien können, in das ihn sein künstlerischer Anspruch geführt hatte. Er hätte tatsächlich „unsinnig alt“ werden müssen, um auch nur einen Schritt auf dem Weg zu einem Ziel weiterzukommen, welches außerhalb der Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts lag. Schon früh war sich Wagner darüber im klaren gewesen, dass das bisherige Theater innerhalb des gegebenen Rahmens am Ende seiner Entwicklung angelangt war. Mit prophetischen Gaben hatte das weniger zu tun als mit der typischen Affinität des genialischen Künstlers zum Konjunktiv: die Phantasie kennt immer eine bessere Wirklichkeit und an Einbildungskraft mangelte es Wagner wahrlich nicht. Mehr noch, er verfügte über die Fähigkeit und Energie, um das Wünschenswerte innerhalb der Mittel seiner Zeit auch möglich zu machen. Wie wir heute wissen, fand das, was Wagner unter dem Begriff „Gesamtkunstwerk“ zusammengefasst und ein halbes Leben lang wortreich gepredigt hatte, durch das Kino schließlich seine Erfüllung. Tatsächlich entspricht der Film in einigen wesentlichen Eigenschaften dem von Wagner beschworenen neuen Theater.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Illusionen
- Grenzen des Live-Theaters
- Sehen und Hören
- Rausch der Sinne
- Filmische Dramaturgie
- Plastische Musik
- Ein Filmfestspiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Nähe von Richard Wagners Theater zur Filmkunst und analysiert, wie seine Visionen eines "Gesamtkunstwerks" durch die filmische Ästhetik des 21. Jahrhunderts realisiert werden könnten. Sie beleuchtet die filmischen Elemente in Wagners Werken und argumentiert, dass die Zukunft des Films und des Theaters durch eine Integration beider Künste revolutioniert werden könnte.
- Die Verbindung von Wagner's „Gesamtkunstwerk“ mit den Möglichkeiten des Films
- Die Entwicklung der Filmtechnologie und ihre Auswirkungen auf die künstlerische Gestaltung
- Eine Neubewertung von Wagners Theater im Kontext des Films
- Die Bedeutung von Wagners Ideen für eine mögliche Renaissance des "singenden Menschen" im Film
- Wagners Vision von einer Zukunft, in der Film und Theater verschmelzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt Richard Wagners Vision von einem "Kunstwerk der Zukunft" vor und skizziert die Unterschiede zwischen seinem Ideal und dem tatsächlichen Theater seiner Zeit. Es wird darauf hingewiesen, dass Wagners Vision in der Filmkunst ihre Erfüllung gefunden hat.
- Illusionen: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung von Illusionen im Theater und im Film. Es untersucht, wie Wagner die Illusionen des Theaters nutzte, um seine Musikdramatik zu intensivieren.
- Grenzen des Live-Theaters: Hier werden die Grenzen des traditionellen Theaters aufgezeigt, die Wagners Vision von einem „Gesamtkunstwerk“ einschränkten. Es werden die technischen und ästhetischen Schwierigkeiten beleuchtet, denen Wagner in seiner Zeit begegnete.
- Sehen und Hören: Das Kapitel beleuchtet die Wechselwirkung von Sehen und Hören im Theater und im Film. Es untersucht, wie Wagner die Sinne seiner Zuschauer ansprach und wie er seine Musik mit der visuellen Gestaltung seiner Opern verband.
- Rausch der Sinne: Hier geht es um die Frage, wie Wagner durch die Inszenierung und Musik seine Opern zu einem Gesamtkunstwerk gestaltete, das die Sinne der Zuschauer in ihren Bann zog.
- Filmische Dramaturgie: Dieses Kapitel analysiert die filmischen Elemente in Wagners Musikdramatik. Es untersucht, wie er dramatische Spannungen aufbaute und wie er mit filmischen Mitteln die Aufmerksamkeit des Publikums lenkte.
- Plastische Musik: Hier wird die Bedeutung von Musik im Film und in Wagners Opern behandelt. Es wird die visuelle Kraft von Musik in der Oper untersucht und wie diese im Film eingesetzt werden kann.
- Ein Filmfestspiel: Das Kapitel präsentiert die Idee, dass Wagners Opern in Form von Filmfestspielen neu interpretiert werden können. Es erläutert, wie die Filmwelt Wagners Vision eines "Gesamtkunstwerks" verwirklichen könnte.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Themen wie Gesamtkunstwerk, Richard Wagner, Theater, Film, Filmische Dramaturgie, Musikdramatik, 3D-Film, Sinnesrausch, Illusionen, Bühnenbild, Oper, Filmfestspiel und das Zusammenspiel von Sehen und Hören im Film und Theater.
Häufig gestellte Fragen
Was verstand Richard Wagner unter einem „Gesamtkunstwerk“?
Ein Gesamtkunstwerk ist die Vereinigung verschiedener Künste wie Musik, Dichtung, Tanz und Malerei zu einem einheitlichen dramatischen Werk, das alle Sinne anspricht.
Warum wird Wagners Theater heute oft mit dem Film verglichen?
Wagner strebte nach perfekter Illusion und einem „Rausch der Sinne“, Ziele, die mit den technischen Mitteln des 19. Jahrhunderts nur schwer erreichbar waren, im modernen Kino (z.B. durch 3D-Technik) jedoch Realität geworden sind.
Was sind „filmische Elemente“ in Wagners Opern?
Dazu gehören die plastische Musik, die wie ein Soundtrack die Handlung untermalt, sowie eine Dramaturgie, die stark mit Licht, Atmosphäre und visuellen Effekten arbeitet.
Welche Grenzen hatte das Live-Theater zu Wagners Zeit?
Das traditionelle Theater stieß bei der Umsetzung von Wagners Visionen an technische und ästhetische Grenzen, etwa bei der Darstellung übernatürlicher Szenen oder der nahtlosen Verbindung von Bild und Ton.
Könnten Wagners Opern als Filme neu interpretiert werden?
Ja, die Arbeit diskutiert die Idee von „Filmfestspielen“, bei denen Wagners Musikdramatik durch die Möglichkeiten der modernen Filmwelt ihre vollkommene visuelle Erfüllung finden könnte.
- Quote paper
- Diplom-Musiktheaterregisseur Eric Schulz (Author), 2005, Filmpreis für Richard Wagner - Eine zeitgemäße Betrachtung seines Theaters, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68301