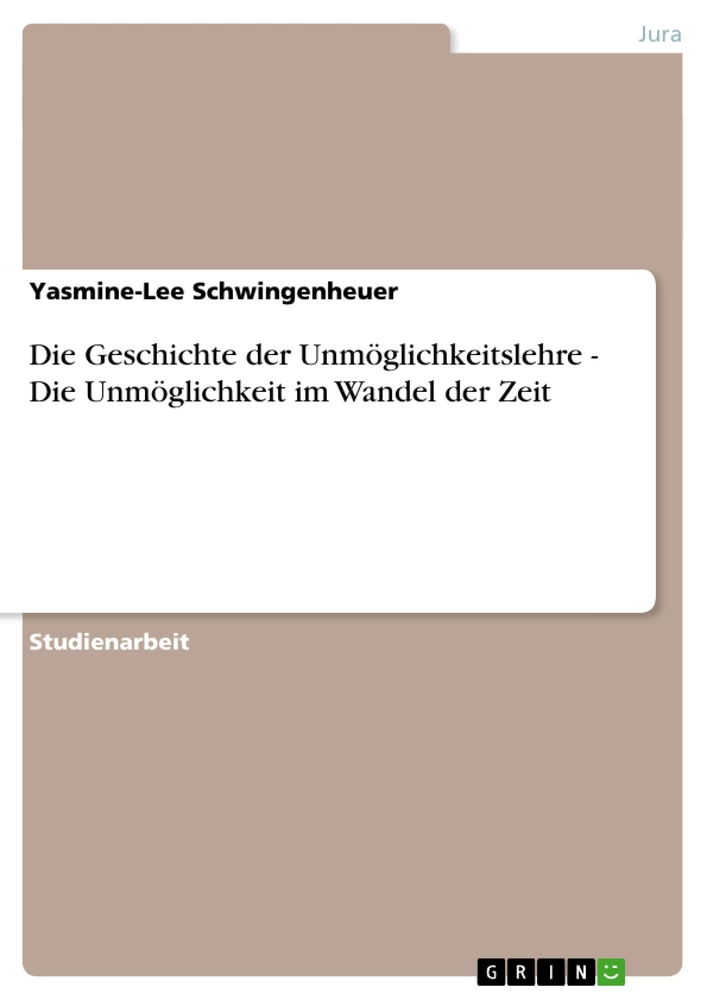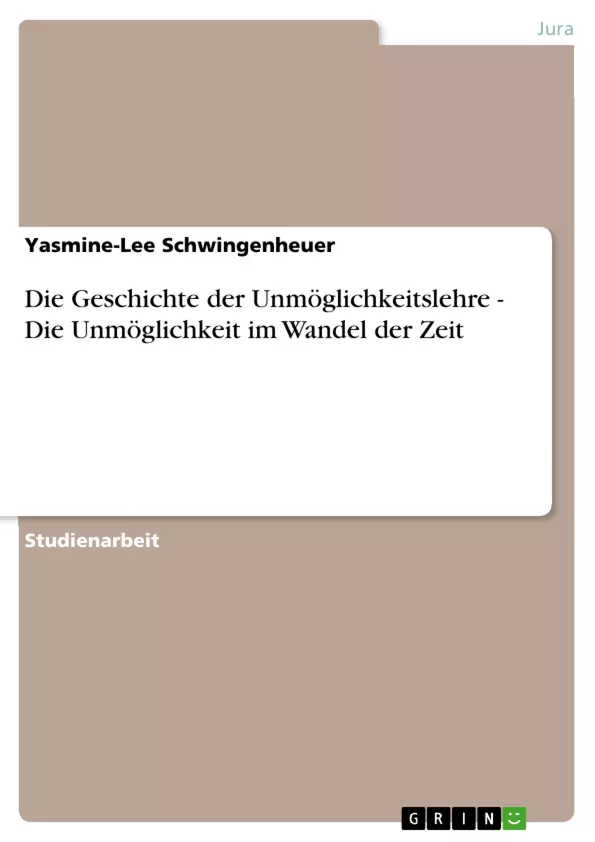Vielfach hat der fast vollständige Verzicht des BGB auf Kasuistik und der damit verbundene hohe Abstraktionsgrad Kritik hervorgerufen. Auch den Regelungen bezüglich der „Unmöglichkeit der Leistung“ wurde, insbesondere vor dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz aus dem Jahre 2001, vielerorts ein Mangel an Allgemeinverständlichkeit und Anschaulichkeit vorgeworfen. So äußerte u.a. Wollschläger, dass das deutsche Recht der Leistungsstörungen von einem „unanschaulichen und schwer zu beherrschenden Begriff“ bestimmt würde: der „Unmöglichkeit der Leistung“.
Die Ungefügigkeit, die viele diesem Begriff zuschrieben war vor allem darauf zurückzuführen, dass es sich bei der Unmöglichkeit der Leistung - anders als beim Verzug - nicht um ein einheitliches Rechtsinstitut handelte; der Unmöglichkeit der Leistung lag kein einheitlicher Tatbestand mit einheitlichen Rechtsfolgen zugrunde. Die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen betrafen vielmehr drei völlig verschiedene Regelungsprobleme, die im Grunde nichts miteinander zu tun hatten: Lag die Unmöglichkeit vor, bevor der Vertrag geschlossen wurde, ließ § 306 BGB a.F. kein gültiges Rechtsgeschäft entstehen. Trat der gleiche Sachverhalt nach Vertragsabschluss ein, haftete der Schuldner nach §§ 280, 325 BGB a.F. auf den Nichterfüllungsschaden, sofern er die Unmöglichkeit zu vertreten hatte; andernfalls wurde er von seiner Leistungsverpflichtung gem. § 275 BGB a.F. frei, verlor aber auch den Anspruch auf die Gegenleistung (§ 323 BGB a.F.).
Selbst dem Sprachgebrauch des Gesetzes in Bezug auf den Begriff der „Unmöglichkeit der Leistung“ wurde - so von Wieacker - eine „latente Doppeldeutigkeit“ und damit auch eine gewisse Widersprüchlichkeit zugeschrieben. Dies führte dazu, dass eine völlige Neuregelung dieses Bereichs der Leistungsstörungen, zeitweilig sogar die gänzliche Abschaffung des Begriffs der Unmöglichkeit gefordert wurde. Diese Forderungen haben letztendlich dazu geführt, dass im Rahmen des Schuldrechtmodernisierungsgesetzes die Lehre der Unmöglichkeit eine ganz neue Wendung erfuhr.
Dabei spielte der Blick auf die Geschichte derselben keine unerhebliche Rolle: Warum wurde der Begriff der Unmöglichkeit überhaupt in das BGB eingeführt? Lagen diesen Bestimmungen nachvollziehbare rechtspolitische Entscheidungen zugrunde? Welche Sachverhalte hatte der Gesetzgeber im Auge, als er sich für den Begriff der Unmöglichkeit entschied und welche Rolle sollte diesem Tatbestand im System der Rechtsfolgen zukommen?
Inhaltsverzeichnis
- Teil 2 Die historische Entwicklung der Unmöglichkeit
- A. Die Wurzeln der Unmöglichkeitslehre in den Epochen vor der Kodifikation des BGB
- I. Das römische Recht
- 1. Die anfängliche Unmöglichkeit
- 2. Die nachträgliche Unmöglichkeit
- 3. Die Maxime impossibilium nulla obligatio est
- II. Die Unmöglichkeitslehre der großen territorialen Kodifikationen am Beispiel des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794 (ALR)
- 1. Die anfängliche Unmöglichkeit
- 2. Die nachträgliche Unmöglichkeit
- III. Die Unmöglichkeitslehre im 19. Jahrhundert – Mommsen und die Pandektenwissenschaft
- 1. Die anfängliche und nachträgliche Unmöglichkeit
- 2. Die objektive und subjektive Unmöglichkeit
- 3. Die dauernde und vorübergehende Unmöglichkeit
- 4. Teilweise Unmöglichkeit
- 5. Die wahre Unmöglichkeit und die Rechtsfolgen
- B. Die Entstehungsgeschichte der Unmöglichkeit im BGB
- I. Von den (Nr. 22) §§ 9 – 13 des Teilentwurfs zum Obligationenrecht von 1882 zu den §§ 275, 279 des BGB
- II. Von den (Nr. 22) §§ 1, 2, 3, 17 des Teilentwurfs zum Obligationenrecht zu dem § 280 des BGB
- III. Von den (Nr. 11) §§ 1 – 4 des Teilentwurfs zum Obligationenrecht von 1882 zu den §§ 306, 307, 308 des BGB
- IV. Von den (Nr. 22) §§ 9 – 12, 33 des Teilentwurfs zum Obligationenrecht von 1882 zu den §§ 323, 324 des BGB
- V. Von den (Nr. 22) §§ 3-7, 18, 28 des Teilentwurfs zum Obligationenrecht von 1882 zu den § 325 des BGB
- Teil 3 Die zukünftige Entwicklung der Unmöglichkeitslehre - Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz
- A. Neufassung des § 275 BGB als zentraler Vorschrift des Leistungsstörungsrechts
- I. Rechtsnatur und Arten der Unmöglichkeit
- II. Ausschluss des primären Leistungsanspruchs für Fälle nicht zu vertretender und zu vertretender Unmöglichkeit
- III. Gleichstellung von nachträglicher und anfänglicher Unmöglichkeit
- IV. Gleichstellung von subjektiver und objektiver Unmöglichkeit
- V. Einbeziehung der zeitweiligen Unmöglichkeit
- B. Pflichtverletzung als zentraler Begriff des Leistungsstörungsrechts
- C. Unterschiedslose Schadensersatzregelung in § 280 n.F. BGB
- D. Vereinheitlichung der Rücktritts voraussetzungen
- E. Beseitigung der Alternativität von Rücktritt und Schadensersatz
- F. Die Gegenleistung beim Ausschluss der Leistungspflicht
- II. Der Anspruch auf die Gegenleistung bleibt erhalten – § 326 Abs. 2 n.F. BGB - (Insbesondere: von beiden Teilen zu vertretende Unmöglichkeit)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung der Unmöglichkeitslehre im deutschen Recht darzustellen und die zentralen Veränderungen durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz zu beleuchten. Es analysiert die Lehre von der Unmöglichkeit von ihren römischen Wurzeln bis hin zur aktuellen Rechtslage.
- Entwicklung der Unmöglichkeitslehre im römischen Recht
- Einfluss großer territorialer Kodifikationen (z.B. Preußisches Allgemeines Landrecht)
- Die Unmöglichkeitslehre im 19. Jahrhundert (Pandektenwissenschaft)
- Entstehungsgeschichte der Unmöglichkeitslehre im BGB
- Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 2 Die historische Entwicklung der Unmöglichkeit: Dieser Teil beleuchtet die Entwicklung der Unmöglichkeitslehre vom römischen Recht über die großen territorialen Kodifikationen bis hin zur Pandektenwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Es werden die verschiedenen Auffassungen zur anfänglichen und nachträglichen Unmöglichkeit, zur objektiven und subjektiven Unmöglichkeit sowie zur dauernden und vorübergehenden Unmöglichkeit analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Maxime "impossibilium nulla obligatio est" und ihrer Auslegung in den verschiedenen Epochen gewidmet. Der Teil bietet einen umfassenden Überblick über die Rechtsprechung und die wissenschaftliche Diskussion zur Unmöglichkeit vor der Kodifikation des BGB.
Teil 3 Die zukünftige Entwicklung der Unmöglichkeitslehre - Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz: Dieser Teil konzentriert sich auf die Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes auf die Unmöglichkeitslehre. Im Mittelpunkt steht die Neufassung des § 275 BGB und die damit verbundenen Veränderungen im Leistungsstörungsrecht. Der Text analysiert die Gleichstellung von anfänglicher und nachträglicher sowie objektiver und subjektiver Unmöglichkeit, die Einbeziehung der zeitweiligen Unmöglichkeit und die neue, unterschiedslose Schadensersatzregelung. Die Vereinheitlichung der Rücktrittsvoraussetzungen und die Beseitigung der Alternativität von Rücktritt und Schadensersatz werden ebenfalls detailliert erörtert. Schließlich wird der Anspruch auf die Gegenleistung bei Ausschluss der Leistungspflicht im Kontext der von beiden Teilen zu vertretenden Unmöglichkeit behandelt.
Schlüsselwörter
Unmöglichkeitslehre, römisches Recht, Preußisches Allgemeines Landrecht, Pandektenwissenschaft, BGB, Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, anfängliche Unmöglichkeit, nachträgliche Unmöglichkeit, objektive Unmöglichkeit, subjektive Unmöglichkeit, Leistungsstörung, Schadensersatz, Rücktritt, Gegenleistung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur historischen Entwicklung und zukünftigen Ausgestaltung der Unmöglichkeitslehre im deutschen Recht
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der Unmöglichkeitslehre im deutschen Recht, beginnend mit dem römischen Recht bis hin zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. Er analysiert die verschiedenen Rechtsauffassungen zu anfänglicher und nachträglicher, objektiver und subjektiver Unmöglichkeit und beleuchtet die Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes auf die aktuelle Rechtslage.
Welche Epochen und Rechtsquellen werden behandelt?
Der Text behandelt die Unmöglichkeitslehre im römischen Recht, im Preußischen Allgemeinen Landrecht (ALR) von 1794, in der Pandektenwissenschaft des 19. Jahrhunderts und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), einschließlich der Änderungen durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz. Es werden verschiedene Teilentwürfe zum Obligationenrecht analysiert, um die Entstehung der heutigen Rechtslage nachzuvollziehen.
Welche zentralen Themen werden im Text behandelt?
Zentrale Themen sind die Entwicklung der Unterscheidung zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit, objektiver und subjektiver Unmöglichkeit sowie dauernder und vorübergehender Unmöglichkeit. Der Einfluss der Maxime "impossibilium nulla obligatio est" wird ebenso beleuchtet wie die Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes auf § 275 BGB und die damit verbundenen Änderungen im Leistungsstörungsrecht (Schadensersatz, Rücktritt, Gegenleistung).
Wie wird die historische Entwicklung der Unmöglichkeitslehre dargestellt?
Die historische Entwicklung wird chronologisch dargestellt, beginnend mit den römischen Rechtsgrundlagen, über die großen territorialen Kodifikationen bis hin zur Pandektenwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Der Text beschreibt die verschiedenen Auffassungen und die Entwicklung der Rechtsprechung zur Unmöglichkeit vor der Kodifikation des BGB.
Welche Auswirkungen hat das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz auf die Unmöglichkeitslehre?
Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat die Unmöglichkeitslehre im BGB erheblich verändert. Der Text analysiert die Neufassung von § 275 BGB und die damit verbundene Gleichstellung von anfänglicher und nachträglicher sowie objektiver und subjektiver Unmöglichkeit. Die Einbeziehung der zeitweiligen Unmöglichkeit und die neue, einheitliche Schadensersatzregelung werden ebenso detailliert erörtert wie die Vereinheitlichung der Rücktrittsvoraussetzungen und die Beseitigung der Alternativität von Rücktritt und Schadensersatz.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit der Unmöglichkeitslehre relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Unmöglichkeitslehre, römisches Recht, Preußisches Allgemeines Landrecht, Pandektenwissenschaft, BGB, Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, anfängliche Unmöglichkeit, nachträgliche Unmöglichkeit, objektive Unmöglichkeit, subjektive Unmöglichkeit, Leistungsstörung, Schadensersatz, Rücktritt, Gegenleistung, impossibilium nulla obligatio est.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in zwei Hauptteile: Teil 2 behandelt die historische Entwicklung der Unmöglichkeitslehre, während Teil 3 die Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes auf die zukünftige Entwicklung beleuchtet. Jeder Teil ist weiter in Unterkapitel unterteilt, die jeweils spezifische Aspekte der Unmöglichkeitslehre behandeln.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich mit der Unmöglichkeitslehre im deutschen Recht auseinandersetzen möchten, insbesondere Juristen, Jurastudenten und Wissenschaftler. Die klare Struktur und die umfassende Darstellung machen ihn sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.
- Arbeit zitieren
- Yasmine-Lee Schwingenheuer (Autor:in), 2001, Die Geschichte der Unmöglichkeitslehre - Die Unmöglichkeit im Wandel der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68487