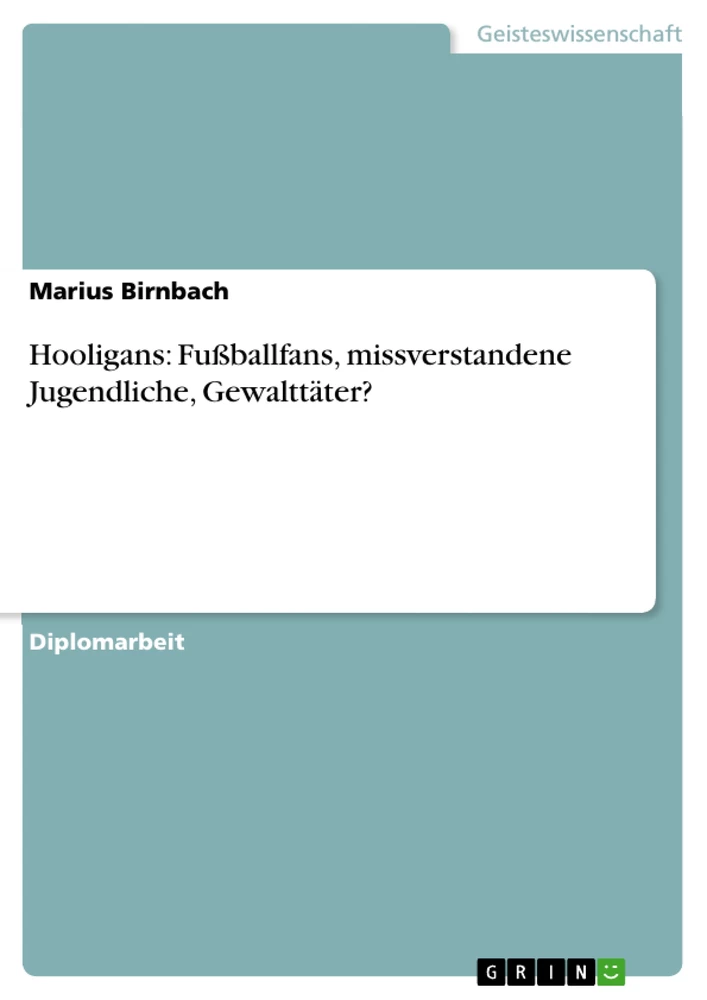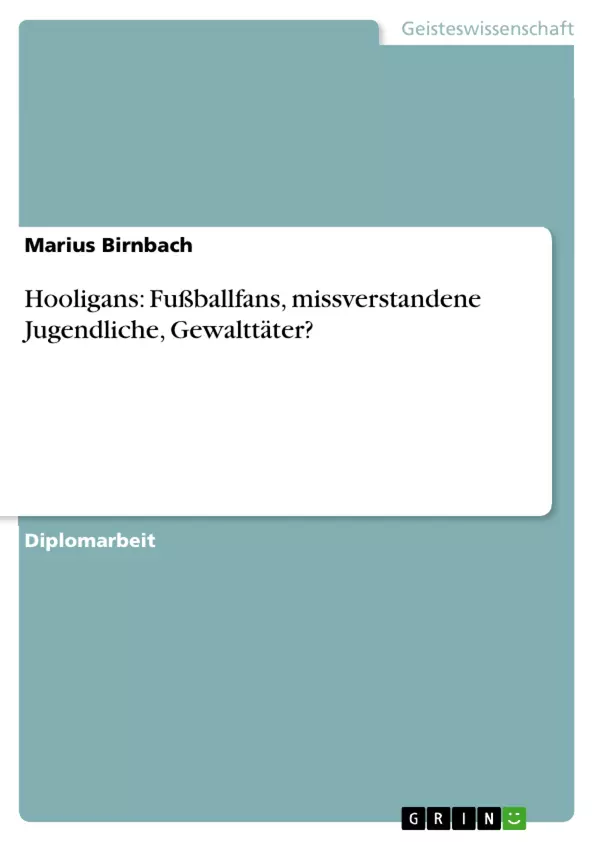„Geil auf Gewalt“, der Titel des gleichnamigen Buches von Bill Buford, ist Programm. Zumindest für die allzeit bereiten jugendlichen Gewalttäter, die seit den 90er Jahren im Umfeld von Fußballspielen (...) Fußballstadien und öffentliche Plätze gleichermaßen zu Schlachtfeldern mutieren lassen, (...) an Fußball nicht interessiert sind und sich (.) Hooligans nennen. Die Liste derartiger (Vor-)Urteile (...) [zeigt] die weit verbreitete Vorstellung der deutschen Medien und Bevölkerung von einer „Kultur“, deren Herkunft vielen ebenso verborgen bleibt, wie Intentionen und (Hinter-)Gründe.
Das Thema der Diplomarbeit orientiert sich an diesem „Gewalttäterpostulat“, an der Frage, ob es sich bei Hooligans um Fußballfans, missverstandene Jugendliche oder Gewalttäter handelt. Ausgehend von der Idee, dass es nicht festlegbar ist, was das Abstraktum „Gewalttäter“ ausmacht und dass es so etwas wie den, universell und seine gesamte Persönlichkeit umfassenden „Gewalttäter“ nicht gibt, geht die vorliegende Diplomarbeit den Ursachenbeziehungen des Hooliganismus nach, die Hooligans und jugendliche Fußballfans dennoch als Gewalttäter erscheinen lassen.
Tatsächlich zeigt sich, dass der Hooliganismus kein Phänomen der 90er Jahre darstellt. Gewalttätige Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Fußballspielen sind im Gegenteil so alt wie der moderne Fußball selbst. Der erste Teil der Diplomarbeit beschäftigt sich mit dieser Entstehungsgeschichte des Fußballs und stellt Verknüpfungen zwischen dem Fußball und dem Auftreten von Ausschreitungen bzw. der Genese des Hooliganismus dar. Eine phänomenologische Beschreibung der Kultur des Hooliganismus verdeutlicht erste Gewaltzusammenhänge. Diese werden im zweiten Teil vertieft und auf die Frage bezogen, inwieweit es sich bei den Anhängern des Hooliganismus um „missverstandene Jugendliche“ handelt. Anhand einiger Theorien werden hierzu die Lebensbedingungen Jugendlicher auf Ursachen für das gewalttätige Verhalten jugendlicher Fußballfans und Hooligans untersucht. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Rezeptionsebene der Gesellschaft. Über die Wechselwirkung aus Fan- bzw. Hooliganverhalten mit Maßnahmen der Polizei bzw. der Darstellung durch Massenmedien und der Aufnahme dieses Bildes durch die Öffentlichkeit wird das Bild vom „Gewalttäter“ Hooligan einer Prüfung unterzogen. Zusätzlich werden Wechselwirkungen zwischen Kontrollinstanzen, den Medien und gewalttätigem Verhalten jugendlicher Fußballfans und Hooligans näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Hooliganismus und seine Entstehung
- 1.1 Vom Zuschauer zum Hooligan: die Entwicklung eines Phänomens bei Sportveranstaltungen
- 1.1.1 Fußball und seine Fans – die Geschichte einer „gewaltigen“ Zweierbeziehung
- 1.1.2 Herkunft und Bedeutung des Begriffs „Hooligans“
- 1.1.3 „Die Geburt der Hooligans“
- 1.2 Stadionbesucher heute
- 1.3 Zusammensetzung und Strukturierung von Hooliganmobs
- 1.4 Das äußere Erscheinungsbild der Hooligans
- 1.5 Werte- und Normenstruktur des Hooliganismus
- 1.6 Hooligangewalt
- 1.7 Ausgewählte Verhaltens- und Mentalitätsmuster
- 1.1 Vom Zuschauer zum Hooligan: die Entwicklung eines Phänomens bei Sportveranstaltungen
- 2. Hooliganismus – ein Jugendproblem?
- 3. Fußballfans und Kriminalisierung
- 4. Hooligans: Fußballfans, missverstandene Jugendliche, Gewalttäter?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Ursachen des Hooliganismus und hinterfragt das gängige Bild des Hooligans als reinen Gewalttäter. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Phänomens, analysiert den Zusammenhang zwischen Jugend, Identität und Gewalt sowie den Einfluss von Medien und Polizei auf die Wahrnehmung und das Auftreten von Hooligangewalt.
- Die historische Entwicklung des Hooliganismus und seine Verknüpfung mit der Geschichte des Fußballs.
- Der Einfluss von Jugendkultur und -subkulturen auf das Hooliganverhalten.
- Die Rolle der Medien und der Polizei in der Konstruktion und Verstärkung des Bildes des gewalttätigen Hooligans.
- Analyse verschiedener Verhaltens- und Mentalitätsmuster von Hooligans.
- Hinterfragen des Stereotyps des Hooligans als reinen Gewalttäters.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Hooliganismus und seine Entstehung: Dieses Kapitel widerlegt die verbreitete Annahme, Hooliganismus sei ein rein modernes Phänomen. Es zeigt anhand der Geschichte des Fußballs, dass Gewalt im Umfeld von Fußballspielen seit dessen Anfängen besteht und sich im Laufe der Zeit gewandelt hat. Die Entwicklung vom Zuschauer zum Hooligan wird nachgezeichnet, verschiedene Gruppen von Fußballfans (Normalos, Kutten, Ultras, Hools) werden vorgestellt und ihre Besonderheiten beschrieben. Der Fokus liegt auf der Entstehung der Hooligankultur, ihrer Werte und Normen, der Ausprägung von Gewalt sowie auf dem Zusammenhang zwischen Hooliganismus, Alkohol- und Drogenkonsum und politischen Orientierungen. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis des Hooliganismus als komplexes soziales Phänomen, das nicht allein auf Jugendlichkeit oder pure Gewalt reduziert werden kann.
2. Hooliganismus – ein Jugendproblem?: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Jugend, Lebensbedingungen und Hooligangewalt. Es analysiert die Bedingungen der Jugendphase im Kontext der Individualisierung und hinterfragt, ob Hooligans als „entwertete Jugend“ oder Akteure einer „misslungenen Zivilisation“ betrachtet werden können. Der Einfluss von „hegemonialer Männlichkeit“ auf das Hooliganverhalten wird beleuchtet. Zusätzlich werden Theorien zu Jugendsubkulturen herangezogen, um den Hooliganismus als Jugend(sub)kultur einzuordnen und die jugend(sub)kulturelle Gewalt zu analysieren. Das Kapitel zielt darauf ab, die Ursachen für gewalttätiges Verhalten jugendlicher Fußballfans und Hooligans in den gesellschaftlichen und individuellen Kontext einzubetten.
3. Fußballfans und Kriminalisierung: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Medien und Polizei in der Konstruktion des Bildes des gewalttätigen Hooligans. Es analysiert die mediale Darstellung von Fußballfans und Fangewalt und deren Auswirkungen. Die Wechselwirkungen zwischen ordnungspolitischen Maßnahmen der Polizei und Fangewalt werden beleuchtet, ebenso wie die Kriminalisierung von Fußballfans durch polizeiliches Eingreifen. Weiterhin wird die Rolle von Vereinen und Verbänden betrachtet und das Phänomen der besonderen Illegitimität jugendlicher Gewalt erörtert. Das Kapitel verdeutlicht, wie soziale Institutionen und die öffentliche Wahrnehmung zum Bild des Hooligans beitragen und ihn – mitunter ungerechtfertigt – kriminalisieren.
Schlüsselwörter
Hooliganismus, Fußballgewalt, Jugendkultur, Jugendsubkultur, Medienrezeption, Polizeiarbeit, Kriminalisierung, Gewalt, Identität, Männlichkeit, Sozialisation, Identifikation, Gruppendynamik, Postmoderne.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Hooliganismus
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Ursachen des Hooliganismus und hinterfragt das gängige Bild des Hooligans als reinen Gewalttäter. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Phänomens, analysiert den Zusammenhang zwischen Jugend, Identität und Gewalt sowie den Einfluss von Medien und Polizei auf die Wahrnehmung und das Auftreten von Hooligangewalt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Hooliganismus im Kontext der Fußballgeschichte, den Einfluss von Jugendkultur und -subkulturen, die Rolle der Medien und Polizei bei der Konstruktion des Bildes des gewalttätigen Hooligans, verschiedene Verhaltens- und Mentalitätsmuster von Hooligans und hinterfragt den Stereotyp des Hooligans als reinen Gewalttäter.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Kapitel 1 behandelt die Entstehung des Hooliganismus und seine Entwicklung, Kapitel 2 untersucht den Zusammenhang zwischen Jugend und Hooligangewalt, Kapitel 3 analysiert die Rolle von Medien und Polizei in der Kriminalisierung von Fußballfans, und Kapitel 4 bietet eine umfassende Betrachtung des Hooliganismus, indem es verschiedene Perspektiven und Aspekte beleuchtet.
Was sind die Kernaussagen von Kapitel 1: "Der Hooliganismus und seine Entstehung"?
Kapitel 1 widerlegt die Annahme, Hooliganismus sei ein rein modernes Phänomen. Es zeigt die historische Entwicklung von Gewalt im Fußballumfeld, die Entwicklung vom Zuschauer zum Hooligan, unterschiedliche Gruppen von Fußballfans (Normalos, Kutten, Ultras, Hools) und deren Besonderheiten, die Entstehung der Hooligankultur, deren Werte und Normen, und den Zusammenhang zwischen Hooliganismus, Alkohol-/Drogenkonsum und politischen Orientierungen. Es stellt den Hooliganismus als komplexes soziales Phänomen dar.
Was sind die Kernaussagen von Kapitel 2: "Hooliganismus – ein Jugendproblem?"
Kapitel 2 untersucht den Zusammenhang zwischen Jugend, Lebensbedingungen und Hooligangewalt. Es analysiert die Jugendphase im Kontext der Individualisierung, hinterfragt die Betrachtung von Hooligans als „entwertete Jugend“ oder Akteure einer „misslungenen Zivilisation“ und beleuchtet den Einfluss von „hegemonialer Männlichkeit“. Es ordnet den Hooliganismus als Jugend(sub)kultur ein und analysiert jugend(sub)kulturelle Gewalt im gesellschaftlichen und individuellen Kontext.
Was sind die Kernaussagen von Kapitel 3: "Fußballfans und Kriminalisierung"?
Kapitel 3 analysiert die Rolle von Medien und Polizei in der Konstruktion des Bildes des gewalttätigen Hooligans. Es untersucht die mediale Darstellung von Fußballfans und Fangewalt, die Wechselwirkungen zwischen ordnungspolitischen Maßnahmen der Polizei und Fangewalt, die Kriminalisierung von Fußballfans und die Rolle von Vereinen und Verbänden. Es verdeutlicht, wie soziale Institutionen und öffentliche Wahrnehmung zum Bild des Hooligans beitragen und ihn – mitunter ungerechtfertigt – kriminalisieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Hooliganismus, Fußballgewalt, Jugendkultur, Jugendsubkultur, Medienrezeption, Polizeiarbeit, Kriminalisierung, Gewalt, Identität, Männlichkeit, Sozialisation, Identifikation, Gruppendynamik, Postmoderne.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen im Bereich des Hooliganismus auf strukturierte und professionelle Weise.
- Quote paper
- Marius Birnbach (Author), 2006, Hooligans: Fußballfans, missverstandene Jugendliche, Gewalttäter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68511