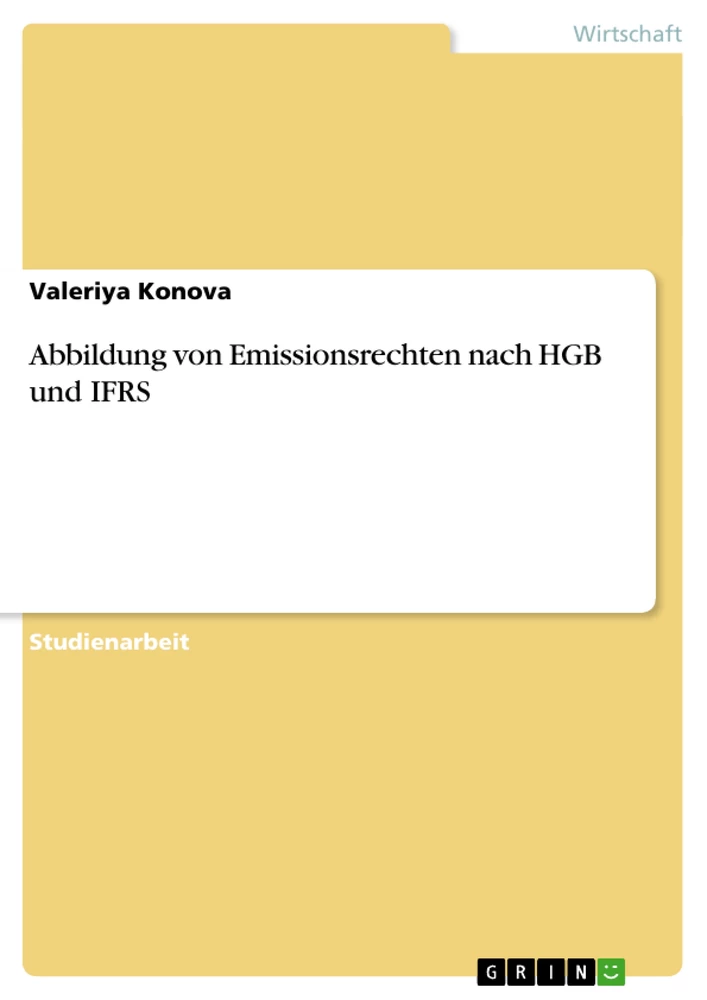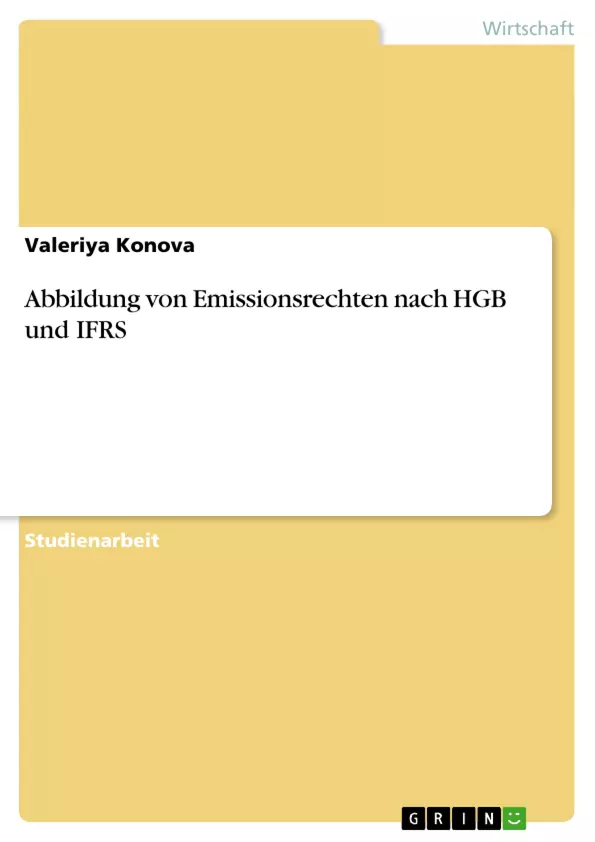Ab dem 01.01.2005 wurde offiziell der Handel mit Emissionszertifikaten EUweit in Gang gebracht. Die rechtliche Grundlage dafür ist die EU-Richtlinie 2003/87/EG vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Emissionszertifikaten. Das Handelsmodell orientiert sich an dem in Kyoto-Protokoll festgelegten umweltpolitischen Ziel zur weltweiten Reduktion von anthropogenen Treibhausgasemissionen.
Die EU verpflichtet sich, ihre Emissionen für den Zeitraum 2008-2012 gegenüber dem Stand von 1990 um mindestens 5 % zu senken, wobei die einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Reduktionsziele haben. So sieht die Bundesrepublik Deutschland eine Verminderung des Schadstoffausstoßes von 21% gegenüber den Emissionen im Jahr 1990 vor.
Durch das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) und das für die erste Zuteilungsperiode 2005-2007 geltende Zuteilungsgesetz 2007 (ZuG 2007) wurde die EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt und so wurden die Grundlagen für den Handel mit Kohlendioxid-Berechtigungen (CO2-Berechtigungen) in Deutschland geschaffen. Den Emittenten von Verschmutzungsgasen, Unternehmen der Energiewirtschaft und Industrie, werden Emissionsechte für den CO2-Ausstoß von der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) laut Nationaler Allokationsplan (NAP) zugeteilt. Liegt der Ausstoß über der zugeteilten Menge von Emissionsrechten, muss das Unternehmen das Plus durch den Kauf von Zertifikaten ausgleichen. Wer seine Emissionsrechte nicht ausschöpft, kann vermiedene CO2-Tonnen verkaufen. Der Handel mit Europäischen Emissionsrechten hat am 09.03.2005 erfolgreich an der Leipziger Energiebörse (EEX) gestartet. Ein EU-Emissionsrecht berechtigt zur Emission von einer Tonne Kohlendioxid. Für die vom Emissionshandel betroffenen Unternehmen, ca. 1400 in Deutsch-land mit über 2400 Anlagen, stellt sich nun die Frage der bilanziellen Behandlung von Verschmutzungsrechten und der Erstellung richtiger Jahresabschlüsse. Diese Arbeit soll die Bilanzierung von kostenlos zugeteilten und gehandelten Emissionszertifikaten nach dem deutschen Handelsrecht und nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) analysieren. Zunächst werden die Emissionsrechte bilanziell identifiziert und die Ansatz- und Bewertungsvorschriften nach beiden Rechnungslegungssystemen dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bilanzierungsfähigkeit und Ansatzkriterien
- 2.1. Emissionsrechte als immaterielle Vermögensgegenstände nach HGB
- 2.2. Emissionsrechte als „intagible assets“ nach IFRS
- 2.3. Nationale Regelungen im Vergleich mit IFRS
- 3. Zugangs- und Folgebewertung der Emissionsrechte
- 3.1. Zugangs- und Folgebewertung nach HGB
- 3.1.1. Zugangsbewertung
- 3.1.2. Folgebewertung
- 3.2. Zugangs- und Folgebewertung nach IFRS
- 3.2.1. Zugangsbewertung
- 3.2.2. Folgebewertung
- 3.3. Vergleichende Darstellung
- 4. Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungsbildung
- 4.1. Ansatz und Bewertung nach HGB
- 4.1.1. Ausweis eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens
- 4.1.2. Rückstellung für Emissionen und Strafzahlungen
- 4.2. Ansatz und Bewertung nach IFRS
- 4.2.1. Bilanzierung von „Government Grants“
- 4.2.2. ,,Provision“ für Emissionen und Strafzahlungen
- 4.3. Vergleich
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bilanzierung von kostenlos zugeteilten und gehandelten Emissionszertifikaten nach dem deutschen Handelsrecht und nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Dabei werden die Emissionsrechte zunächst bilanziell identifiziert und die Ansatz- und Bewertungsrichtlinien nach beiden Rechnungslegungssystemen dargestellt. Im vierten Abschnitt werden bilanzierungspflichtige Posten erläutert, die mit dem Ansatz der Zertifikate korrespondieren und für den in dieser Arbeit im Vordergrund stehenden Einzelabschluss von Bedeutung sind.
- Bilanzielle Behandlung von Emissionszertifikaten nach HGB und IFRS
- Ansatz- und Bewertungsrichtlinien für Emissionsrechte
- Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen im Zusammenhang mit Emissionsrechten
- Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen HGB und IFRS bei der Bilanzierung von Emissionsrechten
- Bedeutung der Emissionsrechte für den Einzelabschluss
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Bilanzierungsfähigkeit und Ansatzkriterien
- Kapitel 3: Zugangs- und Folgebewertung der Emissionsrechte
- Kapitel 4: Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungsbildung
Dieses Kapitel führt in das Thema Emissionshandel ein und beschreibt den rechtlichen Hintergrund des Handels mit Emissionszertifikaten in der EU. Es stellt die Ziele des Emissionshandels sowie die rechtlichen Grundlagen in Deutschland dar.
Kapitel 2 beleuchtet die Bilanzierungsfähigkeit von Emissionsrechten unter dem deutschen Handelsrecht (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Es werden die Kriterien für die Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen nach beiden Rechnungslegungssystemen vorgestellt und auf die Emissionsrechte angewendet.
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Emissionsrechten. Es werden die Vorschriften zur Erstbewertung und zur Folgebewertung von Emissionsrechten nach HGB und IFRS dargestellt und gegenübergestellt. Dabei werden die Besonderheiten der Bewertung von kostenlos zugeteilten und gehandelten Emissionszertifikaten hervorgehoben.
In Kapitel 4 werden die bilanzierungspflichtigen Posten untersucht, die mit dem Ansatz von Emissionsrechten korrespondieren. Es wird die Behandlung von Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen im Zusammenhang mit Emissionsrechten sowohl nach HGB als auch nach IFRS erläutert.
Schlüsselwörter
Emissionsrechte, Bilanzierung, HGB, IFRS, immaterielle Vermögensgegenstände, Ansatzkriterien, Bewertung, Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, Emissionshandel, CO2-Zertifikate, Treibhausgase.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Emissionsrechte nach HGB bilanziert?
Nach HGB werden Emissionsrechte in der Regel als immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens eingestuft, wobei Anschaffungskosten als Basis dienen.
Gibt es Unterschiede bei der Bilanzierung nach IFRS?
Ja, unter IFRS werden Emissionsrechte als „intangible assets“ (IAS 38) behandelt, wobei auch die Bilanzierung von staatlichen Zuwendungen („Government Grants“) eine wichtige Rolle spielt.
Wie erfolgt die Folgebewertung von Emissionszertifikaten?
Nach HGB gilt das strenge Niederstwertprinzip für das Umlaufvermögen. IFRS erlaubt unter bestimmten Umständen auch eine Neubewertung zum beizulegenden Zeitwert.
Müssen Rückstellungen für CO2-Emissionen gebildet werden?
Ja, Unternehmen müssen Rückstellungen für die Verpflichtung zur Abgabe von Zertifikaten bilden, wenn der tatsächliche Ausstoß die Menge der gehaltenen Rechte übersteigt.
Was ist die rechtliche Grundlage für den Emissionshandel in Deutschland?
Die Basis bilden das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) und der Nationale Allokationsplan (NAP), die auf EU-Richtlinien basieren.
- Quote paper
- Valeriya Konova (Author), 2005, Abbildung von Emissionsrechten nach HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68564