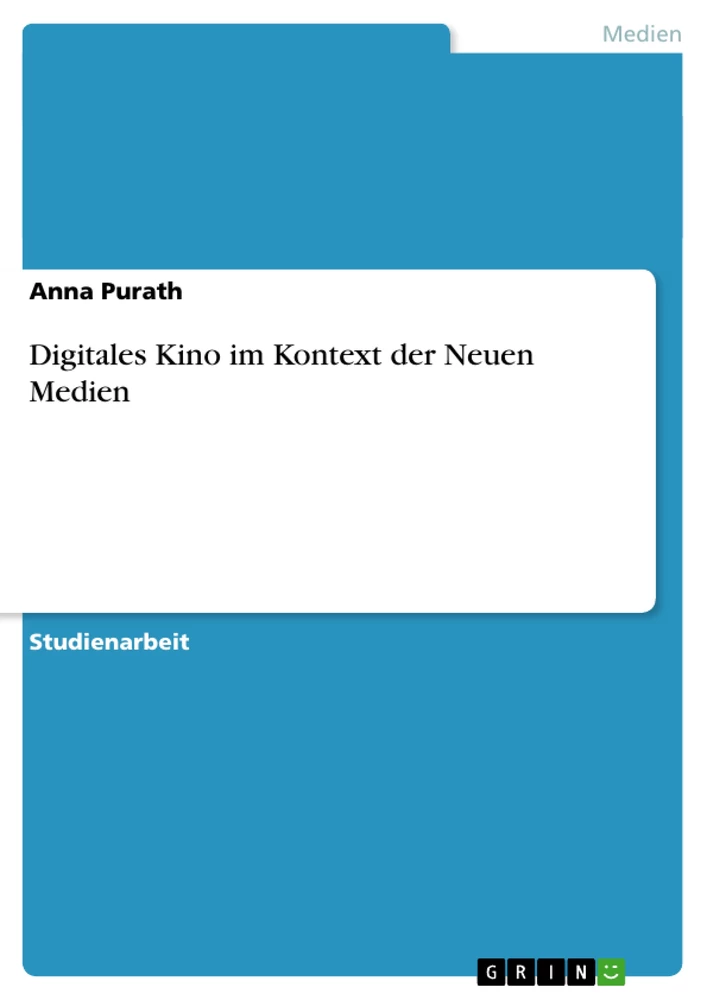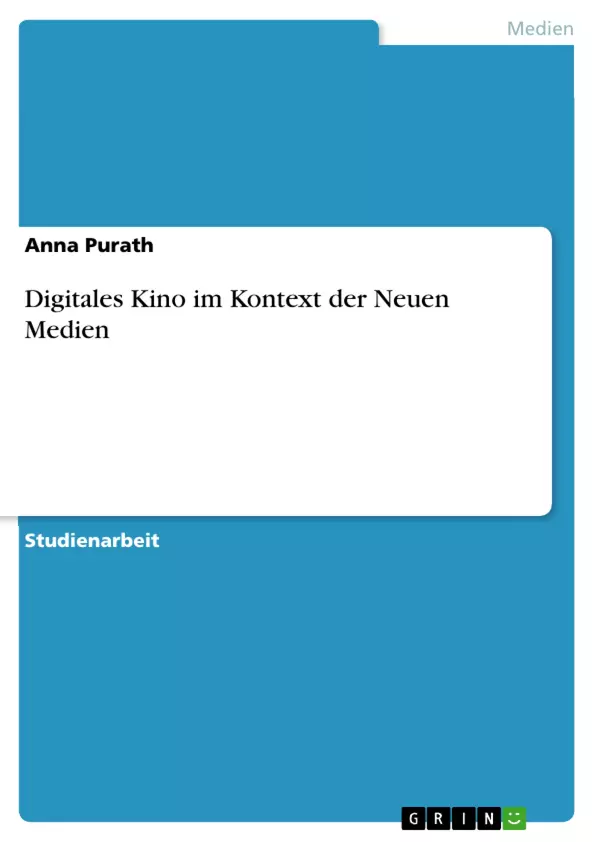Etwa Mitte der 80er Jahre hat der Computer seinen Einzug in die Kinoproduktion gehalten. Mittlerweile können fast alle Bereiche der Filmherstellung auf computergestützte Systeme zugreifen, sei es in der Bildbearbeitung, im Schnitt, in der Synchronisation oder Kamerasteuerung, um nur einige zu nennen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Computeranimation und ihrer Verbindung mit Realfilmaufnahmen. Die Fortschritte, die in diesem Bereich seit dem Beginn der 90er Jahre gemacht wurden, sind gewaltig, und das Tempo dieser Entwicklung scheint immer noch weiter anzusteigen.
Die neue Technologie gewinnt aber nicht nur für das Kino an Bedeutung: Die ‚Neuen’ – digitalen – Medien dringen zunehmend in alle Lebensbereiche vor und sind Zeichen einer globalen Entwicklung zur Informationsgesellschaft und des damit einhergehenden fortschreitenden Abstraktionsprozesses der Kommunikation. In starker Wechselwirkung mit einer massiven Expansion des Wirtschaftsfaktors leitet die zunehmende elektronische Durchdringung der Gesellschaft neue Strukturen im Herstellungs- und Distributionsverfahren ein und wirkt sich nachhaltig in einer spezifisch technischen Ästhetik und einer entsprechend technisch orientierten Wahrnehmung aus.
Dieser Trend löst auf der einen Seite eine Welle der Euphorie aus, die im Technokult v.a. junger Leute aber auch in den hoffnungsvollen Wirtschaftsprognosen des Medienbereichs ihren Ausdruck findet. Auf der anderen Seite beobachten Kritiker mit Sorge und Mißtrauen die unaufhaltsamen Veränderungsprozesse, die der Computer in Kultur und Gesellschaft herbeiführt: Veränderungen des Weltbildes, zunehmende Schnelllebigkeit, Erfahrungsverlust des Körpers zugunsten einer Immaterialisierung von Arbeitsmitteln und -prozessen, was Buckminster Fuller das „Ephemerwerden der Arbeit“ nannte. An der Schnittstelle der Extreme führt die Auseinandersetzung mit der neu enstehenden Medienumwelt, zu der auch das digitale Kino gehört, zu einer Fülle von ethischen, anthropologischen und kulturellen Konflikten.
Die notwendige Interdisziplinarität, die sich bei der wissenschaftlichen Betrachtung der Neuen Medien zwangsweise ergibt, bringt eine Komplexität mit sich, die zugleich die steigende Unübersichtlichkeit und Ungreifbarkeit dieser neuen Medienwelt reflektiert.
Ziel der folgenden Arbeit ist es, einige der zentralen wissenschaftlichen Thesen aus bereits vorliegenden Publikationen aufzugreifen und einander gegenüberzustellen, sowie [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Evolution der Technologie: Merkmale des digitalen Bildes
- Die Virtualität digitaler Existenz
- Der Computer als inneres Auge
- Ästhetik und Wahrnehmung der digitalen Medien
- Der Doppelcharakter der elektronischen Medien
- Die Verschmelzung der Medien
- Soundtrack
- Digitale Medien im gesellschaftlich-kulturellen Kontext
- Industrialisierung der Kultur
- Das Paradox des technologischen Fortschritts
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem digitalen Kino als integralem Bestandteil der neuen Medienlandschaft. Ihr Ziel ist es, zentrale wissenschaftliche Thesen aus bereits vorliegenden Publikationen zusammenzutragen, zu vergleichen und neue Forschungsfelder zu erschließen. Dabei soll das digitale Kino nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Motor und zugleich Reflektor des gesamten medialen Funktionskomplexes.
- Die Natur des Digitalen und die Neuheit des Computers gegenüber herkömmlichen (Ab-)Bildungsverfahren
- Auswirkungen der technischen Besonderheit digitaler Artefakte auf Ästhetik und Wahrnehmung
- Bewertung der digitalen Medien im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext, insbesondere die Frage nach der Produktivität des Zuschauers
- Die Rolle des digitalen Kinos in der Entwicklung der Informationsgesellschaft und des damit verbundenen Abstraktionsprozesses der Kommunikation
- Die Auswirkungen der digitalen Medien auf Kultur und Gesellschaft, insbesondere die Herausforderungen durch die Schnelllebigkeit, den Erfahrungsverlust und die Immaterialisierung von Arbeitsmitteln.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die Natur des Digitalen und die Rolle des Computers in der Kinoproduktion. Es wird die Frage gestellt, inwiefern der Computer im Medienbereich tatsächlich etwas Neues darstellt. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Ästhetik und Wahrnehmung digitaler Medien. Es werden die Auswirkungen der technischen Besonderheit digitaler Artefakte auf die Wahrnehmung durch den Zuschauer beleuchtet. Das dritte Kapitel betrachtet die digitalen Medien im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext. Dabei steht die Frage nach der Produktivität des Zuschauers im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Digitales Kino, Neue Medien, Computer, Virtualität, Ästhetik, Wahrnehmung, Kultur, Gesellschaft, Informationsgesellschaft, Abstraktion, Produktivität des Zuschauers, Technokultur, Industrialisierung, Paradox des technologischen Fortschritts, Immaterialisierung, Arbeit, Medienumwelt, Interdisziplinarität, Komplexität.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann wird der Computer massiv in der Kinoproduktion eingesetzt?
Der Einzug des Computers in die Kinoproduktion begann etwa Mitte der 80er Jahre und hat seit den 90er Jahren in Bereichen wie Bildbearbeitung und Animation massiv an Bedeutung gewonnen.
Was unterscheidet das digitale Bild von herkömmlichen Verfahren?
Das digitale Bild zeichnet sich durch Virtualität und einen hohen Abstraktionsgrad aus, wobei der Computer als "inneres Auge" fungiert und neue ästhetische Möglichkeiten eröffnet.
Welche kulturellen Sorgen löst die Digitalisierung des Kinos aus?
Kritiker befürchten eine zunehmende Schnelllebigkeit, den Verlust körperlicher Erfahrung und eine Immaterialisierung von Arbeitsprozessen ("Ephemerwerden der Arbeit").
Was ist das Paradox des technologischen Fortschritts im Medienbereich?
Das Paradox beschreibt das Spannungsfeld zwischen der Euphorie über neue technologische Möglichkeiten und den gleichzeitigen ethischen sowie anthropologischen Konflikten, die sie auslösen.
Wie beeinflusst die Digitalisierung die Wahrnehmung des Zuschauers?
Die technische Ästhetik digitaler Medien führt zu einer veränderten, technisch orientierten Wahrnehmung und wirft Fragen nach der Produktivität und Rolle des Zuschauers auf.
- Quote paper
- Anna Purath (Author), 2000, Digitales Kino im Kontext der Neuen Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6866