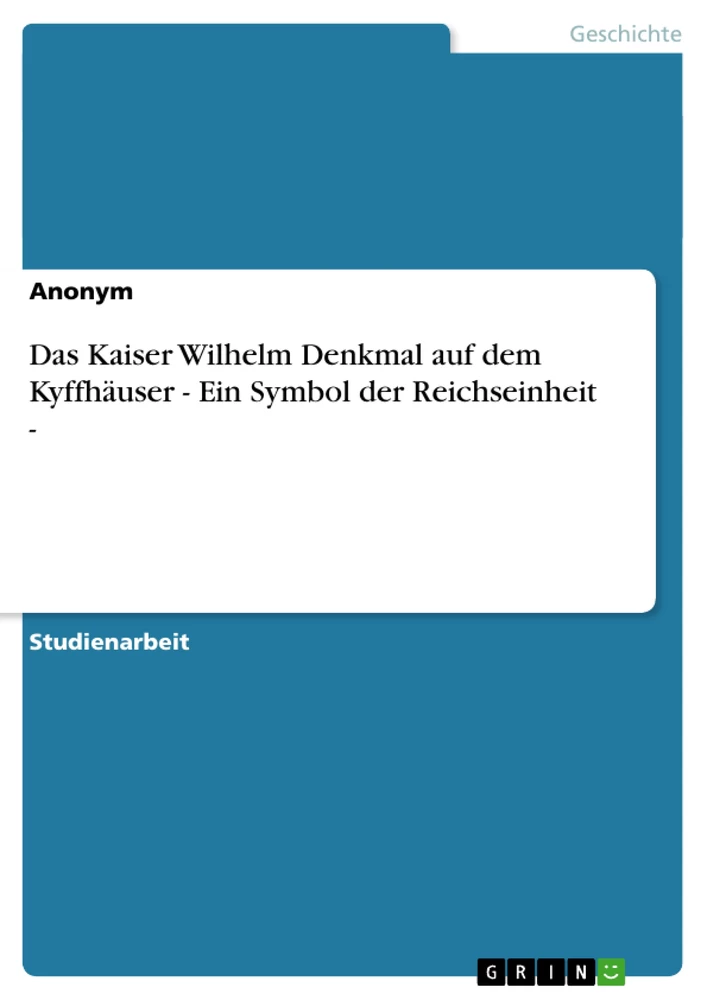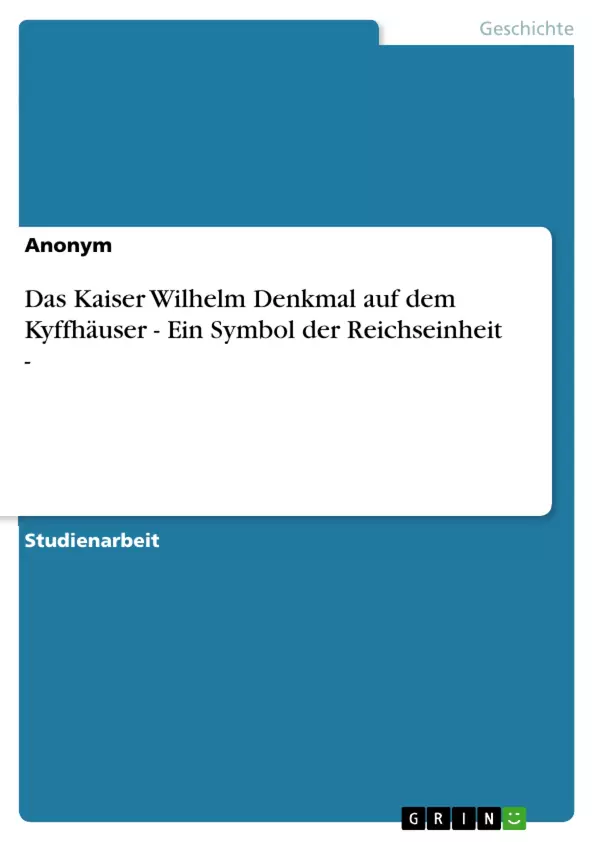Nach einigen einführenden Bemerkungen rund um den Kyffhäuser, bei denen Lage, Begriff und Bauwerke kurz betrachtet werden, steht im zweiten Abschnitt die Sage um Barbarossa im Mittelpunkt. Dabei werde ich der Bedeutung der Rezeption des Mittelalters im 19. Jahrhundert nachgehen und anhand des Mythos um Barbarossa den Zusammenhang zwischen ihm und Wilhelm I. zu verdeutlichen versuchen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zum Bau des Denkmals führten, werden im dritten Abschnitt erörtert. Dabei wird vor allem den Kriegervereinen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, indem auch auf ihre Entwicklung und Bedeutung im Kaiserreich eingegangen wird. In diesem Zusammenhang wird auch ihre Selbstinitiierung anhand der Einweihungsfeier des Denkmals verdeutlicht. In dem letzten Abschnitt wird der Fragestellung nach Erbe und Tradition im Umgang mit dem Denkmal vom Kaiserreich bis in unsere heutige Zeit nachgegangen, bevor zum Abschluss einige Gedanken zum Thema Nation-Denkmal-Identität geäußert werden, die Grundlage für weitere Arbeiten und Diskussionen zu diesem Thema sein können.
Zum Themenbereich des Kyffhäusers gibt es eine umfangreiche Literaturbasis, die von Reisebeschreibungen über Sagen bis hin zu wissenschaftlich thematischen Abhandlungen reicht. In meiner Literaturauswahl habe ich versucht, aus allen Bereichen eine Vielzahl von Quellen zu schöpfen, um einen möglichst umfang- und facettenreichen Einblick in die Geschichte des Kaiser Wilhelm Denkmals zu bekommen. Auf einzelne Werke sei aber bereits an dieser Stelle hingewiesen. Zur Sage um Barbarossa diente mir neben dem HZ Artikel von Georg Voigt von 1871 vor allem das Werk von Stefanie Barbara Berg, in dem neben hilfreichen Quellenangaben eine gute Zusammenfassung zur Beurteilung Barbarossas im 19. und 20 Jahrhundert zu finden war. Einen guten Überblick über die deutschen Kriegervereine fand ich in dem Werk Rohkrämers und im Aufsatz von Düding, die beide neben der Bedeutung auch die Akzeptanz der Kriegervereine in der Bevölkerung untersuchen. Als Basisliteratur für den gesamten Themenkomplex diente mir das Werk von Gunther Mai anlässlich der 100 Jahrfeier des Denkmals 1996. Mittels literarischer Quellen und Literatur aus der Zeit des Denkmalbaus wird die Darstellung des Themenkomplexes meines Erachtens nach anschaulicher. Auf weitere Literatur wird im Text hingewiesen und kann dem Literaturverzeichnis entnommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Rund um den Kyffhäuser
- Das Kyffhäusergebirge
- Deutungsmuster und Interpretation des Begriffs „Kyffhäuser“
- Die Rothenburg
- Die Reichsburg Kyffhausen
- Die Rezeption des Mittelaltermythos im Zeitalter der Romantik
- Die Entstehung von Sagen und Mythen
- Die deutsche Kaisersage
- Inhalt und Probleme
- Von Friedrich II. zu Friedrich I.
- Wünsche und Hoffnungen in der deutschen Kaisersage
- Der Kyffhäuser als Ort der Kaisersage
- Die deutsche Kaisersage im 19. Jahrhundert
- Die Herausbildung der Nationalgeschichtsschreibung
- Politische und gesellschaftliche Verhältnisse im 19. Jahrhundert
- Barbarossa als literarischer Gegenstand
- Die Reichsgründung von 1871 als Erfüllung der deutschen Kaisersage
- Das Kyffhäuserdenkmal ein national-monarchisches Denkmal
- Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Bedeutung der deutschen Kriegerverbände beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals
- Die deutschen Kriegervereine
- Entstehung und Entwicklung der Kriegervereine
- Die Reichseinigungskriege als Schlüsselerlebnis
- Die Kriegervereine als politische Gruppierungen
- Aufgabenbereiche der Kriegervereine
- Der Bau des Kyffhäuserdenkmals
- Ideen und Initiativen zum Denkmalbau
- Der Kyffhäuser als Standort für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal
- Projektausschreibung, Finanzierung und Baubeginn
- Die Grundsteinlegung
- Die Einweihungsfeier
- Zur politischen Bestimmung des Denkmals
- Erbe und Tradition des Kyffhäuserdenkmals
- Träume und Schäume - der Kyffhäuser als Nationalfeststätte
- Das Denkmal in der Weimarer Zeit
- Das Denkmal in der Zeit des Faschismus
- Das Denkmal in der Zeit des Sozialismus
- Diskussionen um den Abriss des Denkmals
- Umgestaltungspläne und die Rettung des Denkmals
- Das Denkmal in der DDR
- Das Denkmal nach der Wiedervereinigung
- Nation - Denkmal - Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kyffhäuser und seine Bedeutung im Kontext der deutschen Geschichte. Ziel ist es, die Entstehung, die Symbolik und die Rezeption des Denkmals im Laufe der Zeit zu analysieren und seine Rolle als nationales Monument zu beleuchten.
- Die Sage von Barbarossa und ihre Rezeption im 19. Jahrhundert
- Die Rolle der deutschen Kriegerverbände beim Bau des Denkmals
- Das Denkmal als Symbol der Reichseinheit und nationaler Identität
- Die politische Instrumentalisierung des Denkmals in verschiedenen Epochen
- Der Kyffhäuser als Ort nationaler Erinnerung und Mythenbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Rund um den Kyffhäuser: Dieses Kapitel beschreibt die geografische Lage des Kyffhäusers, untersucht verschiedene Deutungen seines Namens und beleuchtet die Geschichte der Rothenburg und der Reichsburg Kyffhausen, welche die historische und mythologische Bedeutung des Ortes unterstreichen. Die Beschreibung der beiden Burgen und ihre geschichtliche Einbettung legen den Grundstein für das Verständnis des Kyffhäusers als Ort nationaler Mythenbildung und als geeigneten Platz für das spätere Denkmal.
Die Rezeption des Mittelaltermythos im Zeitalter der Romantik: Das Kapitel analysiert die Entstehung und Entwicklung der Barbarossa-Sage und ihre Bedeutung im 19. Jahrhundert. Es zeigt auf, wie der Mythos um Barbarossa im Kontext der Nationalbewegung instrumentalisiert wurde und wie die Figur Barbarossas mit Wilhelm I. in Verbindung gebracht wurde, um die Idee der nationalen Einheit zu stärken. Die Entwicklung der Sage von Friedrich II. zu Friedrich I. wird detailliert dargestellt und ihre Bedeutung für das nationalistische Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts hervorgehoben.
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Bedeutung der deutschen Kriegerverbände beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, die zum Bau des Denkmals führten. Es hebt die entscheidende Rolle der deutschen Kriegerverbände hervor, die als Initiatoren und Finanzierer des Projekts fungierten und das Denkmal als Symbol ihrer eigenen Bedeutung und des neu geeinten Reichs verstanden. Die Entstehung, Entwicklung und der politische Einfluss der Kriegervereine werden detailliert analysiert, ebenso wie die Planung, Finanzierung und der Bau des Denkmals selbst, inklusive der symbolisch aufgeladenen Grundsteinlegung und Einweihungsfeier.
Erbe und Tradition des Kyffhäuserdenkmals: Das Kapitel zeichnet den Weg des Denkmals nach der Einweihung nach, von der Weimarer Republik über die Zeit des Nationalsozialismus bis hin zur DDR und der Wiedervereinigung. Es analysiert die unterschiedlichen Interpretationen und Nutzungen des Denkmals in diesen verschiedenen politischen Kontexten, vom Versuch, es als Ort nationaler Einheit zu erhalten, bis hin zur Diskussion um seinen Abriss und seiner schließlich dauerhaften Bewahrung als historisches Zeugnis. Die verschiedenen Umdeutungsversuche werden beleuchtet, sowie die dauerhafte Anziehungskraft des Denkmals und des Ortes.
Nation - Denkmal - Identität: Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert den Zusammenhang zwischen Nation, Denkmal und Identität. Er argumentiert, dass das Kyffhäuserdenkmal als ein nationales Denkmal mit integrativer Symbolwirkung zu verstehen ist, das jedoch auch die Herausforderungen und Widersprüche der deutschen nationalen Identität widerspiegelt. Die Arbeit verdeutlicht, wie das Denkmal als Instrument der Mythenbildung und der politischen Legitimation diente und gleichzeitig Fragen nach Inklusion und Exklusion in der nationalen Identität aufwirft.
Schlüsselwörter
Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Kyffhäuser, Barbarossa-Sage, Nationaldenkmal, Reichseinheit, Deutsche Kriegerverbände, Nationalismus, Militarismus, Identität, Geschichtsmythos, Wilhelminisches Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, DDR, Wiedervereinigung.
Häufig gestellte Fragen zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kyffhäuser
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kyffhäuser und seine Bedeutung im Kontext der deutschen Geschichte. Sie untersucht die Entstehung, Symbolik und Rezeption des Denkmals über die Zeit und beleuchtet seine Rolle als nationales Monument.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Barbarossa-Sage und ihre Rezeption im 19. Jahrhundert, die Rolle der deutschen Kriegerverbände beim Bau des Denkmals, das Denkmal als Symbol der Reichseinheit und nationaler Identität, die politische Instrumentalisierung des Denkmals in verschiedenen Epochen und den Kyffhäuser als Ort nationaler Erinnerung und Mythenbildung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: "Rund um den Kyffhäuser" (geografische Lage, Deutungen des Namens, Geschichte der Burgen), "Die Rezeption des Mittelaltermythos im Zeitalter der Romantik" (Entstehung und Entwicklung der Barbarossa-Sage), "Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Bedeutung der deutschen Kriegerverbände beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals" (politische und gesellschaftliche Bedingungen, Rolle der Kriegerverbände), "Erbe und Tradition des Kyffhäuserdenkmals" (Geschichte des Denkmals von der Einweihung bis zur Gegenwart) und "Nation - Denkmal - Identität" (Zusammenfassung und Diskussion).
Welche Rolle spielten die deutschen Kriegerverbände?
Die deutschen Kriegerverbände spielten eine entscheidende Rolle beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Sie fungierten als Initiatoren und Finanzierer des Projekts und sahen das Denkmal als Symbol ihrer eigenen Bedeutung und des neu geeinten Reichs. Die Arbeit analysiert Entstehung, Entwicklung und politischen Einfluss dieser Verbände detailliert.
Wie wurde die Barbarossa-Sage rezipiert?
Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung der Barbarossa-Sage und ihre Bedeutung im 19. Jahrhundert. Sie zeigt auf, wie der Mythos um Barbarossa im Kontext der Nationalbewegung instrumentalisiert wurde und wie die Figur Barbarossas mit Wilhelm I. in Verbindung gebracht wurde, um die Idee der nationalen Einheit zu stärken.
Welche Bedeutung hatte das Denkmal in verschiedenen Epochen?
Das Denkmal wurde in verschiedenen Epochen unterschiedlich interpretiert und genutzt. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Interpretationen und Nutzungen in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus, in der DDR und nach der Wiedervereinigung, einschließlich der Diskussionen um einen möglichen Abriss und die schließlich erfolgte dauerhafte Bewahrung.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Nation, Denkmal und Identität dargestellt?
Die Arbeit argumentiert, dass das Kyffhäuserdenkmal ein nationales Denkmal mit integrativer Symbolwirkung darstellt, das aber auch die Herausforderungen und Widersprüche der deutschen nationalen Identität widerspiegelt. Es diente als Instrument der Mythenbildung und politischen Legitimation und wirft gleichzeitig Fragen nach Inklusion und Exklusion auf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Kyffhäuser, Barbarossa-Sage, Nationaldenkmal, Reichseinheit, Deutsche Kriegerverbände, Nationalismus, Militarismus, Identität, Geschichtsmythos, Wilhelminisches Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, DDR, Wiedervereinigung.
Wo finde ich weitere Informationen zum Kyffhäuserdenkmal?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse des Denkmals. Für weiterführende Informationen können Sie sich an wissenschaftliche Literatur zum Kyffhäuser, zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie zur Geschichte der nationalen Mythenbildung wenden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2001, Das Kaiser Wilhelm Denkmal auf dem Kyffhäuser - Ein Symbol der Reichseinheit -, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68671