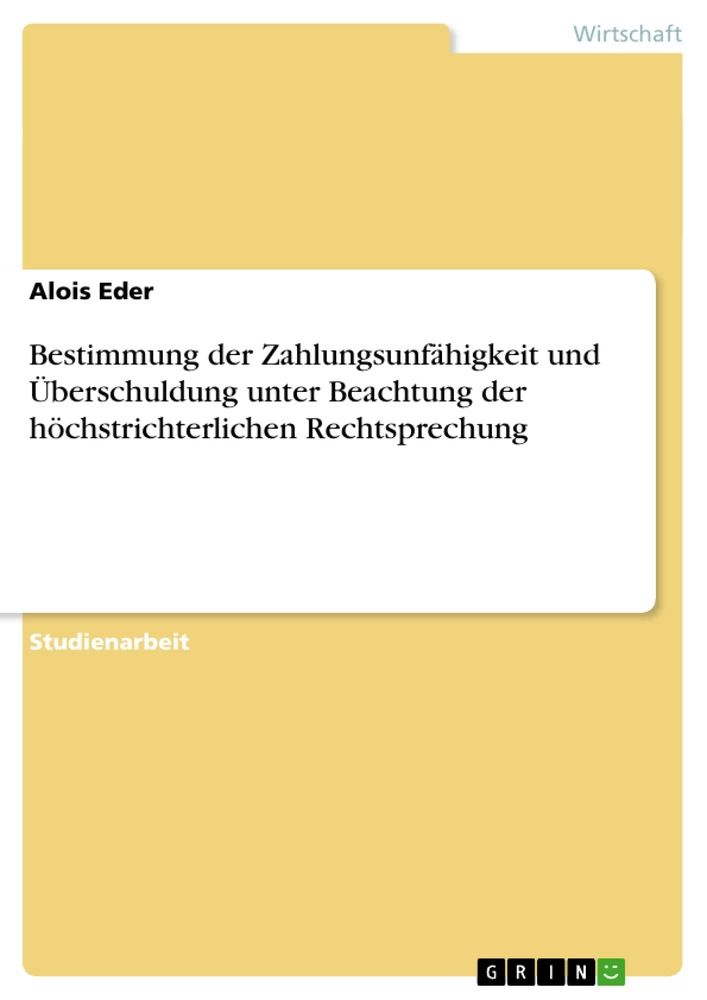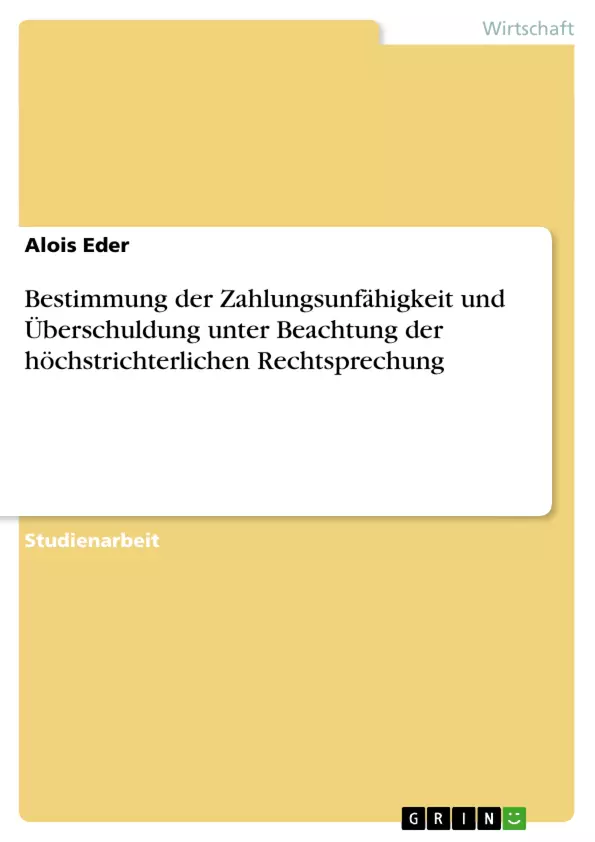Nach den § 64 Abs. 1 Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG), den § 92 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) und den §§ 130 a Abs. 1 und 177 a Handelsgesetzbuch (HGB) ist der Geschäftsführer bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung verpflichtet unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Wochen, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 1 Das Ziel des Insolvenzverfahrens ist die gleichmäßige Befriedigung aller Gläubiger, wobei in der Insolvenzordnung (InsO) neben diesem Ziel auch die Aufgabe einer Unternehmenssanierung durch eine (vorübergehende) Unternehmensfortführung getreten ist. 2 Gemäß § 16 InsO setzt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens voraus, dass ein Eröffnungsgrund gegeben ist. Nach § 14 Abs. 1 InsO kann auch ein Gläubiger einen Antrag stellen, hierzu muss dieser den Eröffnungsgrund glaubhaft machen. 3 Dazu muss der Gläubiger, genauso wie der Schuldner wissen, wann Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Abgesehen von den praktischen Schwierigkeiten, woher soll beispielsweise ein Gläubiger die nur beim Schuldner vorhanden erforderlichen Informationen bekommen, stellt sich für jeden Antragsteller die Frage, was für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um den Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit bzw. der Überschuldung zu erfüllen. 4
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Zahlungsunfähigkeit
- Überschuldung
- Feststellung der Zahlungsunfähigkeit
- Abgrenzung der Zahlungsunfähigkeit von der Zahlungsstockung
- Methoden zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit
- Wirtschaftskriminalistische Feststellungsmethode
- Finanzplan
- Feststellung der Überschuldung
- Anwendung der zweistufigen Methode der Überschuldungsprüfung
- Fortführungsprognose
- Zukünftige Entwicklung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners
- Ertragskraft des Schuldners
- Ansatz und Bewertung im Überschuldungsstatus
- Ansatz und Bewertungsgrundsätze bei positiver Fortbestehungsprognose
- Ansatz und Bewertungsgrundsätze bei negativer Fortbestehensprognose
- Fortführungsprognose
- Anwendung der zweistufigen Methode der Überschuldungsprüfung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Sie soll einen umfassenden Überblick über die relevanten Rechtsgrundlagen und die Anwendung der Kriterien in der Praxis geben.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
- Methoden zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
- Anwendung der zweistufigen Methode der Überschuldungsprüfung
- Ansatz und Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Überschuldungsstatus
- Relevanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Begriffe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung definiert und voneinander abgegrenzt. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Feststellung der Zahlungsunfähigkeit, wobei die Abgrenzung zur Zahlungsstockung und verschiedene Methoden zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit diskutiert werden. Das vierte Kapitel widmet sich der Feststellung der Überschuldung und erläutert die Anwendung der zweistufigen Methode der Überschuldungsprüfung, einschließlich der Fortführungsprognose und der Ansatz- und Bewertungsgrundsätze im Überschuldungsstatus. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzverfahren, Insolvenzordnung, Fortführungsprognose, Überschuldungsprüfung, Ansatz und Bewertung, Rechtsprechung, GmbHG, AktG, HGB, Geschäftsführer, Gläubiger, Schuldner, Vermögen, Verbindlichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Wann muss ein Geschäftsführer Insolvenz anmelden?
Ein Geschäftsführer ist verpflichtet, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, einen Insolvenzantrag zu stellen.
Was ist der Unterschied zwischen Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsstockung?
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner dauerhaft nicht in der Lage ist, seine fälligen Schulden zu begleichen. Eine Zahlungsstockung ist lediglich eine vorübergehende Liquiditätslücke.
Wie wird eine Überschuldung festgestellt?
Die Feststellung erfolgt meist über eine zweistufige Methode: Zuerst wird eine Fortführungsprognose erstellt; fällt diese negativ aus, muss ein Überschuldungsstatus zu Liquidationswerten aufgestellt werden.
Welche Rolle spielt die Fortführungsprognose?
Die Fortführungsprognose prüft, ob das Unternehmen in der Zukunft zahlungsfähig bleiben wird. Sie entscheidet darüber, ob das Vermögen zu Fortführungs- oder zu Zerschlagungswerten bewertet wird.
Können auch Gläubiger einen Insolvenzantrag stellen?
Ja, gemäß § 14 InsO kann ein Gläubiger den Antrag stellen, sofern er ein rechtliches Interesse hat und den Eröffnungsgrund (z. B. Zahlungsunfähigkeit) glaubhaft macht.
- Quote paper
- Alois Eder (Author), 2006, Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung unter Beachtung der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68714