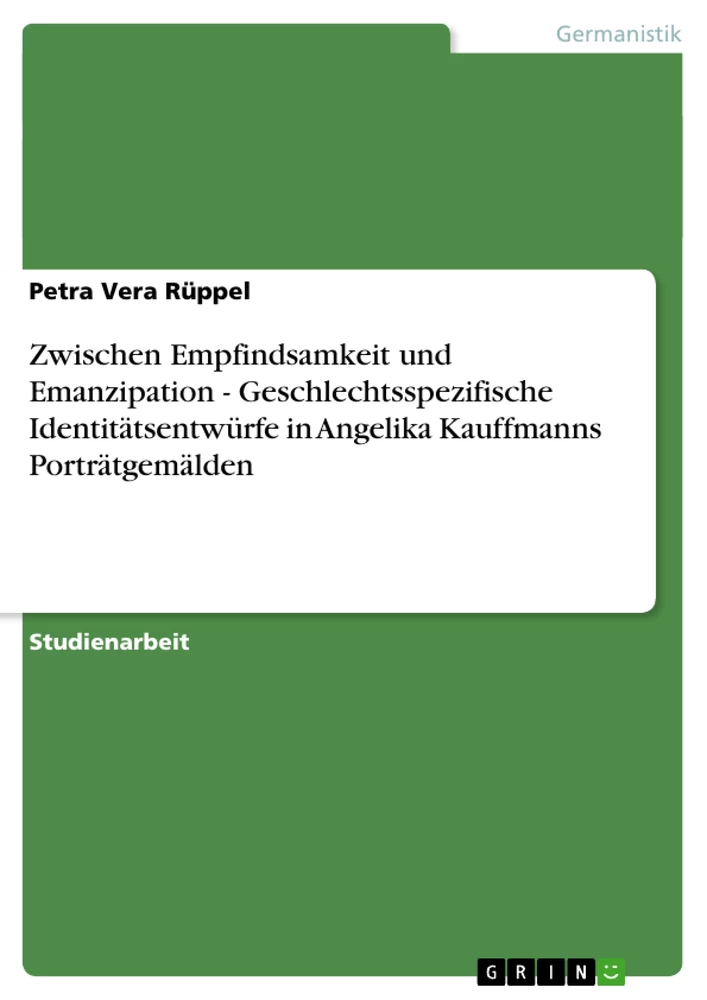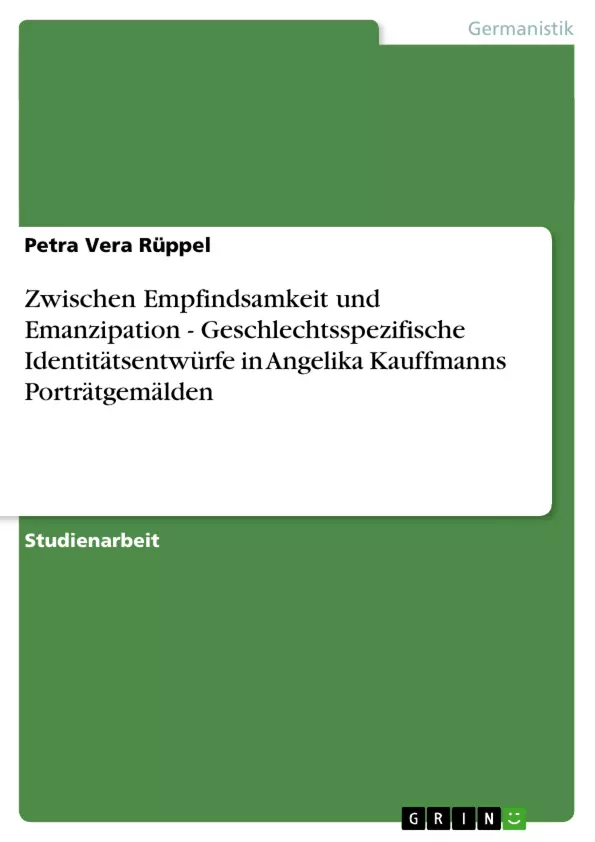Angelika Kauffmann (1741-1807) gilt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 18. Jahrhunderts und erlangte insbesondere aufgrund ihrer Porträtgemälde bereits zu Lebzeiten eine internationale Reputation, die ihr den Zugang zu den höchsten Gesellschaftskreisen Italiens und Englands sicherte und materiellen Wohlstand bescherte. Im folgenden soll gezeigt werden, in welcher Form sich Angelika Kauffmann in deutlicher Abgrenzung zu ihren männlichen Kollegen als individualistisch-innovative Künstlerin etablierte und inwieweit der von ihr selbst geschaffene Mythos um ihre Person mit der geschlechtsspezifischen Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit in ihren Bildnissen korrespondiert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographischer Abriss. Studienjahre
- Die gesellschaftpolitische und soziokulturelle Situation im England des 18. Jahrhunderts
- Die britische Porträtmalerei im 18. Jahrhundert
- Das Porträtstudio und seine Funktionen
- Turquerie - Das Studio als Ort weiblicher Begegnung und Kommunikation
- Weiblichkeitsmodelle in Angelika Kauffmanns Bildnissen
- „Diese Frau ist eine so schöne Seele wies wenige giebt“ – Selbstinszenierung der Künstlerin
- Frauenbilder. Von weiblichen Qualitäten.
- Männerbilder. Das Konzept des Androgynen
- Angelika Kauffmann im Vergleich mit Sir Joshua Reynolds
- Künstlerischer Nachlass
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Zwischen Empfindsamkeit und Emanzipation - Geschlechtsspezifische Identitätsentwürfe in Angelika Kauffmanns Porträtgemälden“ beleuchtet die einzigartige Karriere der Künstlerin Angelika Kauffmann im 18. Jahrhundert. Die Arbeit untersucht, wie Kauffmann sich als individualistische und innovative Künstlerin von ihren männlichen Kollegen abgrenzte und wie sie mit der geschlechtsspezifischen Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit in ihren Werken ihren eigenen Mythos schuf.
- Angelika Kauffmanns künstlerische Entwicklung und ihre Herausforderungen als Frau in der Kunstwelt des 18. Jahrhunderts
- Die Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit in ihren Porträtgemälden
- Der Einfluss des Empfindsamkeitsideals auf Kauffmanns künstlerisches Schaffen
- Der Vergleich mit männlichen Kollegen wie Sir Joshua Reynolds
- Die Rolle von Kauffmanns Porträts in der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des 18. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung von Angelika Kauffmanns Porträtkunst im 18. Jahrhundert dar. Das zweite Kapitel beleuchtet Kauffmanns Biographie mit Fokus auf ihre Studienjahre und die prägenden Jahre vor ihrer Übersiedelung nach London. Das dritte Kapitel analysiert die gesellschaftliche und kulturelle Situation im England des 18. Jahrhunderts, wobei die Entwicklung neuer Weiblichkeitsbilder im Kontext der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft im Vordergrund steht. Die Kapitel vier und fünf beleuchten die Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit in Kauffmanns Bildnissen und vergleichen sie mit dem Schaffen von Sir Joshua Reynolds.
Schlüsselwörter
Angelika Kauffmann, Porträtmalerei, 18. Jahrhundert, Empfindsamkeit, Emanzipation, Weiblichkeitsbilder, Männlichkeitsbilder, Geschlechterrollen, Kunst und Gesellschaft, Sir Joshua Reynolds, Turquerie, Selbstinszenierung, Androgynität
Häufig gestellte Fragen
Wer war Angelika Kauffmann?
Angelika Kauffmann (1741-1807) war eine der erfolgreichsten Malerinnen des 18. Jahrhunderts, berühmt für ihre Porträts und Mitbegründerin der Royal Academy of Arts in London.
Wie inszenierte Kauffmann Weiblichkeit in ihren Bildern?
Sie nutzte oft das Ideal der Empfindsamkeit und stellte Frauen als intellektuelle und gefühlvolle Wesen dar, oft in einem Kontext von Freundschaft und Kommunikation (z. B. Turquerie-Szenen).
Was ist das Besondere an ihren Männerporträts?
Kauffmann brach oft mit traditionellen Maskulinitätsidealen und integrierte androgene oder sanftere Züge in ihre Männerbildnisse, was ihrer Kunst eine innovative Note verlieh.
Wie unterschied sich ihr Stil von Sir Joshua Reynolds?
Während Reynolds oft das Heroische und Monumentale betonte, konzentrierte sich Kauffmann stärker auf Intimität, psychologische Tiefe und die Ästhetik der Empfindsamkeit.
Welche Rolle spielte ihr Porträtstudio?
Das Studio war nicht nur ein Arbeitsort, sondern ein wichtiger soziokultureller Treffpunkt für die Elite, in dem gesellschaftliche Netzwerke geknüpft und Identitäten verhandelt wurden.
- Quote paper
- Mag. Petra Vera Rüppel (Author), 2001, Zwischen Empfindsamkeit und Emanzipation - Geschlechtsspezifische Identitätsentwürfe in Angelika Kauffmanns Porträtgemälden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68768