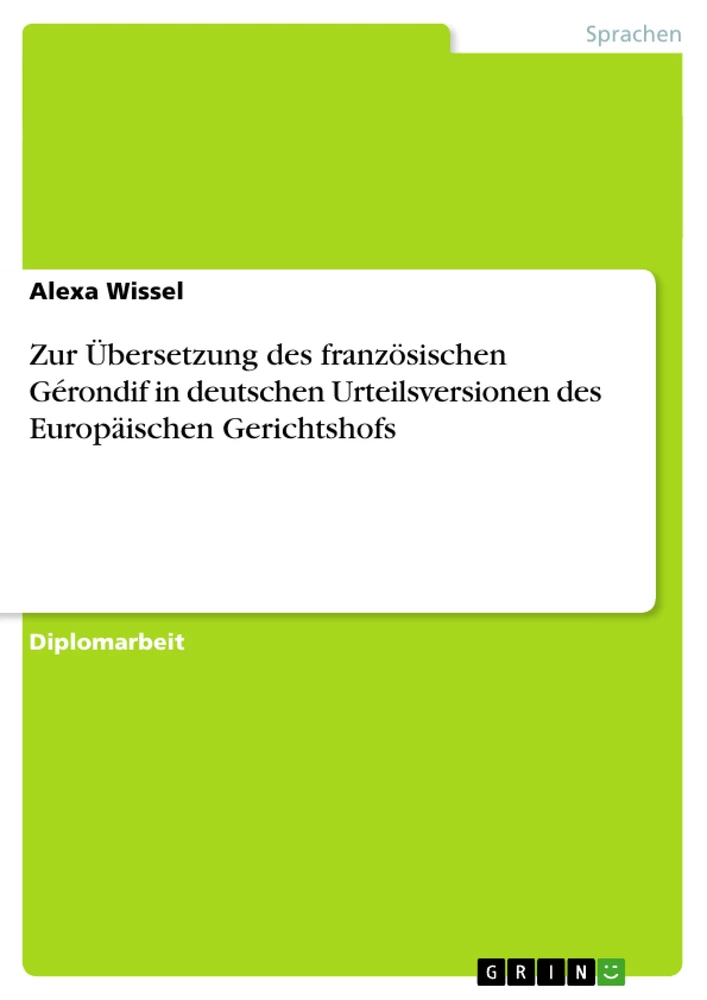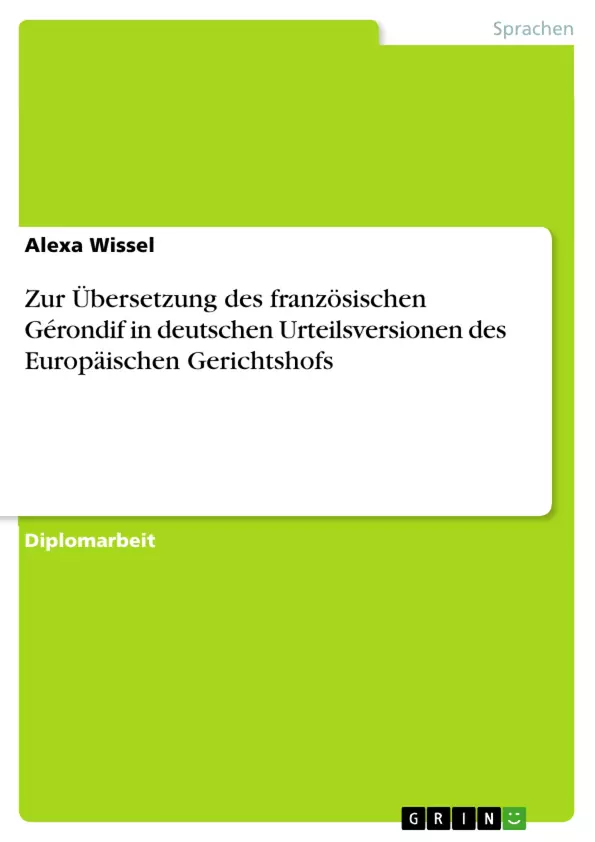Das französische Gérondif, welches als adverbiale Ergänzung zum Verb beschrieben werden kann, stellt ein besonders komplexes Phänomen in der französischen Sprache dar und ist laut Halmøy (vgl. 2003a:3) eine der spannendsten und am häufigsten verwendeten Formen im heutigen Französisch. So sind Gérondifkonstruktionen ein wichtiger Bestandteil sowohl der gesprochenen als auch der geschriebenen Sprache. Das Gérondif stellt eine typisch französische Konstruktion dar, die in dieser Form weder im Lateinischen noch in den romanischen oder germanischen Sprachen ein direktes Äquivalent hat (vgl. ebd.). Nach Auffassung Zembs (vgl. 1978:524) hat das deutsche Gerundium mit dem französischen Gérondif noch weniger gemeinsam als der deutsche Konjunktiv mit dem französischen Subjonctif. Am nächsten käme dem Gérondif noch das deutsche Partizip Präsens mit der Endung -nd, welches ebenfalls adjektivische Funktionen in sich birgt. Dieses spielt jedoch bei der Wiedergabe des Gérondif im Deutschen eine untergeordnete Rolle und strahlt nach Ansicht Serra Bornetos (1982:439) eine Art „antiquierte Eleganz“ aus.
Wenn demnach die deutsche Sprache über kein direktes Äquivalent für diese französische Form verfügt, stellt sich insbesondere für die Übersetzung die Frage, mit welchen Strukturen - wenn nicht mit dem deutschen Gerundium oder dem Partizip Präsens - das französische Gérondif im Deutschen wiedergegeben werden kann. Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass das Gérondif nicht immer eindeutig ist, sondern oft mehr als nur eine Relation ausdrückt. Gerade im Bereich der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Rechtssprache, die sich insbesondere durch Deutlichkeit und Explizitheit auszeichnet (vgl. Roelcke 1999:83), stellt die semantisch-funktionale Vagheit des Gérondif eine große Herausforderung für den fachsprachlichen Übersetzer dar. Der Übersetzer sieht sich mit der Aufgabe konfrontiert zu ermitteln, welche verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten unter Einbeziehung des Kontextes möglich sind. Wenn er sich nun für eine Interpretation entscheidet, besteht die Gefahr, dass er in zweierlei Hinsicht einen Fehler begeht. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass er der Form ihre Polyfunktionalität und somit ihre explizite Vielfalt nimmt. Zum anderen schließt er durch die Wahl einer expliziteren Konstruktion die anderen aus und kann der Form dadurch ihren komplexen Sinn nehmen (vgl. Serra Borneto 1982:44).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das französische Gérondif
- 2.1 Stand der Forschung
- 2.2 Gérondif vs. Participe Présent und Adjectif Verbal
- 2.2.1 Participe Présent vs. Adjectif Verbal
- 2.2.2 Participe Présent vs. Gérondif
- 2.2.3 Übersicht
- 2.3 Morphologische Charakteristika
- 2.3.1 Die Präposition en
- 2.3.1.1 Bedeutung von en
- 2.3.1.2 Wiederholung von en
- 2.4 Syntaktische Charakteristika
- 2.4.1 Die Bezugsgrößen des Gérondif
- 2.4.1.1 Das verbundene Gérondif
- 2.4.1.2 Das unverbundene Gérondif
- 2.4.2 Die Ergänzungen des Gérondif
- 2.4.3 Stellung des Gérondif
- 2.4.4 Weitere syntaktische Besonderheiten des Gérondif
- 2.5 Semantisch-funktionale Charakteristika
- 2.5.1 Das implizite Subjekt des Gérondif
- 2.5.2 Informationsstruktur
- 2.5.3 Die Relationen des Gérondif
- 2.6 Das Gérondif mit tout
- 2.6.1 Syntaktische Merkmale
- 2.6.2 Semantische Merkmale
- 2.7 Zur Frage der Frequenz und der Distribution
- 2.8 Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen
- 2.8.1 Das einfache Gérondif
- 2.8.1.1 Das vorrangig temporale Gérondif
- 2.8.1.2 Das vorrangig modale bzw. instrumentale Gérondif
- 2.8.1.3 Das vorrangig kausale Gérondif
- 2.8.1.4 Das vorrangig konditionale Gérondif
- 2.8.2 Das Gérondif mit tout
- 2.8.2.1 Das vorrangig konzessiv-oppositive Gérondif
- 2.8.2.2 Das Gérondif zum Ausdruck der Gleichzeitigkeit
- 2.9 Zusammenfassung
- 3 Sprachvergleich und Übersetzen in der Fachsprache Recht
- 3.1 Kontrastive Linguistik
- 3.1.1 Definition und Entstehung der kontrastiven Linguistik
- 3.1.2 Ebenen des Sprachvergleichs und Äquivalenz
- 3.1.3 Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft
- 3.2 Die Fachsprache Recht
- 3.2.1 Definition „Fachsprache“
- 3.2.2 Besonderheiten der Fachsprache Recht
- 3.2.2.1 Besondere Merkmale im Bereich der Morphosyntax
- 3.2.2.2 Besondere Merkmale im Bereich der Lexik
- 3.2.2.3 Besondere Merkmale im Bereich des Stils
- 3.2.2.4 Besondere Merkmale im Bereich des Textes
- 3.2.3 Unterschiede zwischen der deutschen und der französischen Rechtssprache
- 3.2.3.1 Unterschiede im Bereich der Morphosyntax
- 3.2.3.2 Unterschiede im Bereich der Lexik
- 3.2.3.3 Unterschiede im Bereich des Stils
- 3.3 Fachsprachenübersetzung
- 3.3.1 Rechts- und Sprachvergleich beim Übersetzen juristischer Fachtexte
- 3.3.1.1 Besonderheiten bei der Übersetzung von EU-Texten
- 3.3.1.2 Besonderheiten bei der Übersetzung von Urteilen des EuGH
- 3.3.2 Übersetzungstheorien und Übersetzungsstrategien
- 3.3.3 Juristische Kompetenz und Sprachkompetenz
- 3.4 Zusammenfassung
- 4 Zur Übersetzung des Gérondif in EuGH-Urteilen
- 4.1 Beschreibung des Korpus
- 4.1.1 Der Europäische Gerichtshof als Institution
- 4.1.1.1 Zusammensetzung des EuGH, des EuG und des EuGÖD
- 4.1.1.2 Zuständigkeiten des EuGH, des EuG und des EuGöD
- 4.1.1.3 Arbeitsweise des EuGH
- 4.1.2 Die Sprachenregelung des Europäischen Gerichtshofs
- 4.1.2.1 Die gesetzliche Regelung einer Verfahrenssprache
- 4.1.2.2 Die Praxis der internen Arbeitssprache
- 4.1.2.3 Organisation und Arbeitsweise des Sprachendienstes des EuGH
- 4.2 Zur Vorgehensweise in der vorliegenden Untersuchung
- 4.3 Übersetzung des Gérondif in EuGH-Urteilen
- 4.3.1 Das einfache Gérondif
- 4.3.1.1 Hypotaktische Konstruktion
- 4.3.1.2 Nominalsyntagma (+ Präposition)
- 4.3.1.3 Parataktische Konstruktion
- 4.3.1.4 Präposition
- 4.3.1.5 Partizip
- 4.3.1.6 Finites Verb + Adverbial
- 4.3.1.7 Verbalkomposition
- 4.3.1.8 Auslassung
- 4.3.2 Das Gérondif mit tout
- 4.3.2.1 Parataktische Konstruktion
- 4.3.2.2 Hypotaktische Konstruktion
- 4.3.2.3 Präposition
- 4.3.2.4 Nominalsyntagma + Präposition
- 4.3.2.5 Partizip
- 4.4 Statistik der im Korpus festgestellten Übersetzungsmöglichkeiten
- 4.5 Ergebnisse der Untersuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Übersetzung des französischen Gérondifs in deutschen Urteilsversionen des Europäischen Gerichtshofs. Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Übersetzung dieses grammatischen Konstrukts zu analysieren und geeignete Übersetzungsstrategien aufzuzeigen.
- Analyse des französischen Gérondifs: morphologische, syntaktische und semantische Eigenschaften
- Kontrastive Analyse des Gérondifs und seiner deutschen Entsprechungen
- Untersuchung der Fachsprache Recht im Deutschen und Französischen
- Entwicklung von Übersetzungsstrategien für das Gérondif im juristischen Kontext
- Empirische Untersuchung anhand eines Korpus von EuGH-Urteilen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz der Untersuchung der Übersetzung des französischen Gérondifs im Kontext des Europäischen Gerichtshofs hervorgehoben.
2 Das französische Gérondif: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung des französischen Gérondifs. Es werden die morphologischen, syntaktischen und semantischen Eigenschaften des Gérondifs erläutert und der Unterschied zu ähnlichen Konstruktionen wie dem Participe Présent und dem Adjectif Verbal herausgearbeitet. Die verschiedenen Funktionen und Bedeutungsnuancen des Gérondifs werden anhand von Beispielen illustriert. Der Abschnitt über das Gérondif mit „tout“ beleuchtet dessen spezifische syntaktische und semantische Eigenschaften. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale des Gérondifs und der möglichen Übersetzungsmöglichkeiten ins Deutsche.
3 Sprachvergleich und Übersetzen in der Fachsprache Recht: Dieses Kapitel widmet sich dem theoretischen Hintergrund der Arbeit. Es werden die Grundlagen der kontrastiven Linguistik erklärt und ihre Relevanz für die Übersetzungswissenschaft dargelegt. Die Besonderheiten der Fachsprache Recht, sowohl im Deutschen als auch im Französischen, werden detailliert analysiert, wobei Unterschiede in Morphosyntax, Lexik, Stil und Textstruktur im Fokus stehen. Schließlich wird das Thema Fachsprachenübersetzung und insbesondere die Übersetzung juristischer Texte im Kontext der EU-Rechtssprache behandelt.
4 Zur Übersetzung des Gérondif in EuGH-Urteilen: In diesem Kapitel wird die empirische Untersuchung präsentiert. Es wird das Korpus beschrieben, welches aus Urteilen des Europäischen Gerichtshofs besteht. Die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten des französischen Gérondifs im Kontext der EuGH-Urteile werden systematisch analysiert und anhand von Beispielen erläutert. Es werden statistische Ergebnisse präsentiert und die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis des juristischen Übersetzens diskutiert.
Schlüsselwörter
Gérondif, französische Rechtssprache, deutsche Rechtssprache, kontrastive Linguistik, Fachsprachenübersetzung, Europäischer Gerichtshof (EuGH), Übersetzung, juristische Fachtexte, Übersetzungstrategien, Morphosyntax, Lexik, Stil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Übersetzung des französischen Gérondifs in EuGH-Urteilen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Übersetzung des französischen Gérondifs in deutsche Urteilsversionen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Sie analysiert die Herausforderungen bei der Übersetzung dieses grammatischen Konstrukts und zeigt geeignete Übersetzungsstrategien auf.
Welche Aspekte des französischen Gérondifs werden behandelt?
Die Arbeit analysiert detailliert die morphologischen, syntaktischen und semantischen Eigenschaften des französischen Gérondifs. Sie vergleicht das Gérondif mit ähnlichen Konstruktionen wie dem Participe Présent und dem Adjectif Verbal und beleuchtet die verschiedenen Funktionen und Bedeutungsnuancen, inklusive des Gérondifs mit „tout“.
Wie wird der Sprachvergleich durchgeführt?
Es findet eine kontrastive Analyse des Gérondifs und seiner deutschen Entsprechungen statt. Die Arbeit untersucht die Fachsprache Recht im Deutschen und Französischen, analysiert Unterschiede in Morphosyntax, Lexik, Stil und Textstruktur und behandelt die Fachsprachenübersetzung, insbesondere die Übersetzung juristischer Texte im Kontext der EU-Rechtssprache.
Welche Methode wird zur empirischen Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einem Korpus von EuGH-Urteilen. Die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten des französischen Gérondifs in diesem Kontext werden systematisch analysiert und anhand von Beispielen erläutert. Statistische Ergebnisse werden präsentiert und ihre Bedeutung für die Praxis des juristischen Übersetzens diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Das französische Gérondif (mit detaillierter Beschreibung), 3. Sprachvergleich und Übersetzen in der Fachsprache Recht (mit theoretischem Hintergrund), und 4. Zur Übersetzung des Gérondifs in EuGH-Urteilen (mit empirischer Untersuchung und Ergebnissen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gérondif, französische Rechtssprache, deutsche Rechtssprache, kontrastive Linguistik, Fachsprachenübersetzung, Europäischer Gerichtshof (EuGH), Übersetzung, juristische Fachtexte, Übersetzungstrategien, Morphosyntax, Lexik, Stil.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen bei der Übersetzung des französischen Gérondifs im Kontext des Europäischen Gerichtshofs zu analysieren und geeignete Übersetzungsstrategien aufzuzeigen. Die Arbeit trägt zum Verständnis der Besonderheiten der juristischen Fachsprache und der Übersetzungsprozesse bei.
Welche Institutionen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Europäischen Gerichtshof (EuGH), inklusive seiner Zusammensetzung, Zuständigkeiten und Arbeitsweise, sowie den Sprachendienst des EuGH und die Sprachenregelung des Gerichts.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Zielsetzung beschreibt. Es folgt eine detaillierte Analyse des französischen Gérondifs, dann ein Kapitel zum Sprachvergleich und der Fachsprachenübersetzung, bevor die empirische Untersuchung an einem Korpus von EuGH-Urteilen präsentiert wird. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Quote paper
- Alexa Wissel (Author), 2007, Zur Übersetzung des französischen Gérondif in deutschen Urteilsversionen des Europäischen Gerichtshofs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68817