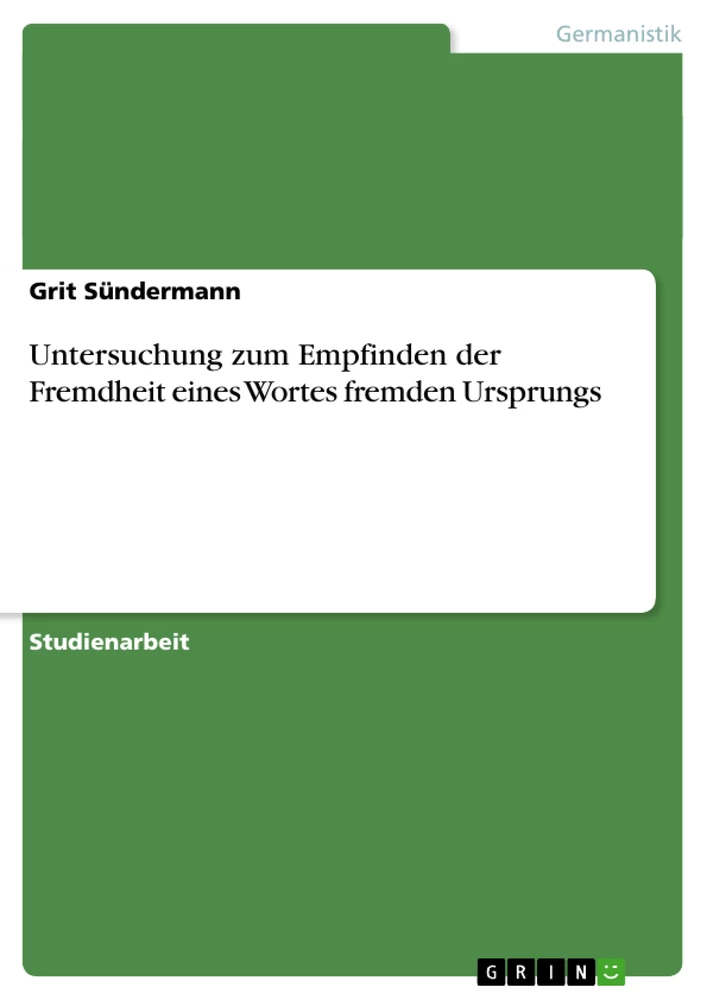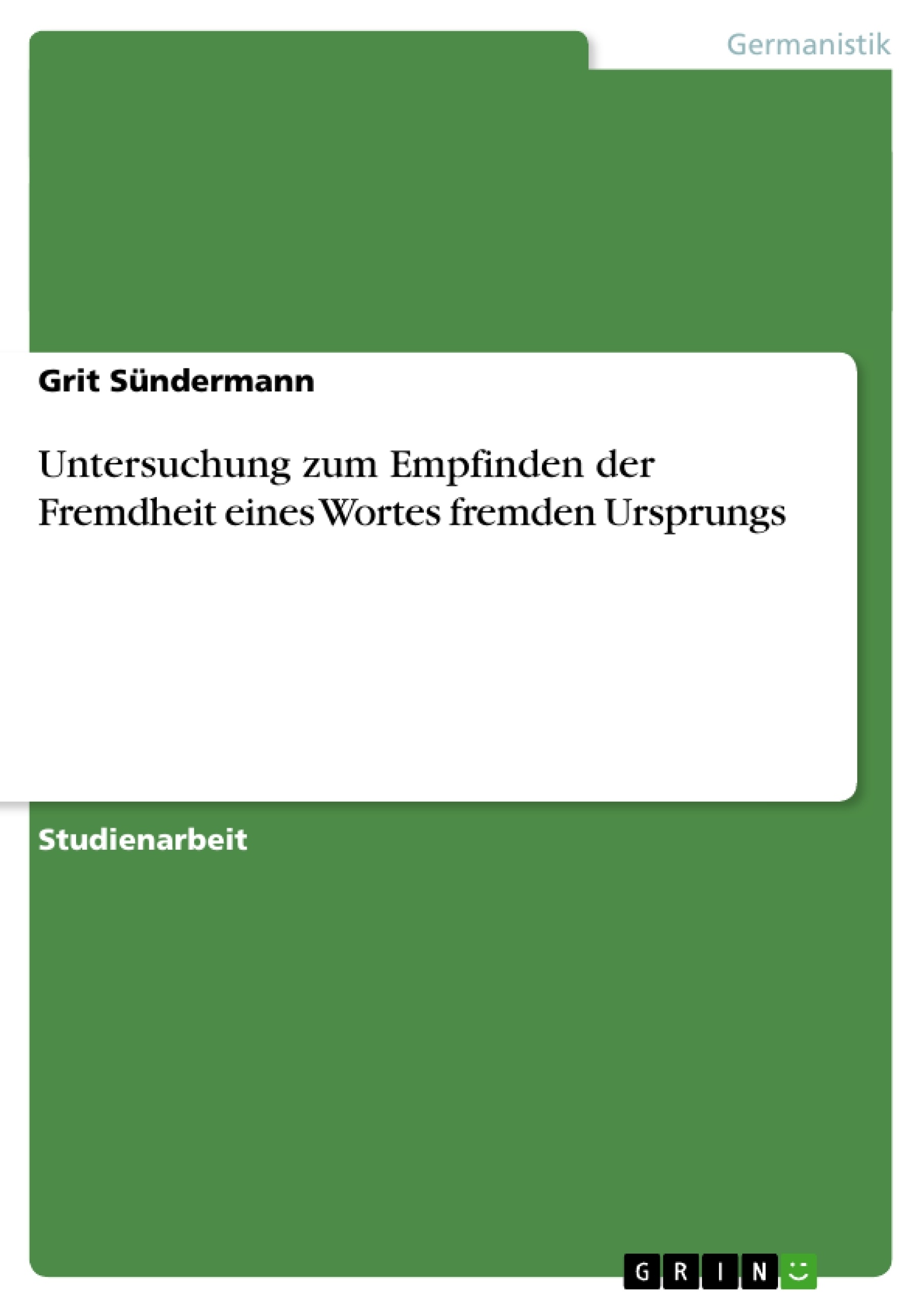Die vorliegende Arbeit ist eine Hausarbeit im Rahmen des Seminars „Fremd oder heimisch? Sprachkontaktphänomene und ihre Bewertung“. Das Thema dieser Hausarbeit ist eine Untersuchung mittels Fragebogen zum subjektiven Fremdheits-Empfinden gegenüber Wörtern fremder Herkunft.
Das Empfinden der Individuen, welche Wörter fremd sind, ist für mich ein wichtiger Punkt in der Diskussion um den Begriff Fremdwort. Die formalen sprachwissenschaftlichen Merkmale, die in Punkt 2 erläutert werden, scheinen mir nicht ausreichend zu sein, um Fremdwörter als klare Gruppe abgrenzen zu können; das subjektive Empfinden bezüglich der Fremdheit eines Wortes richtet sich auch nicht strikt nach der Herkunft dieses Wortes. Welche zentrale Rolle die gefühlte Fremdheit spielt, wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, wie oft sprachwissenschaftliche Laien (und nicht nur diese) überrascht sind, wenn sie erfahren, dass tagtäglich benutzte Wörter eigentlich fremden Ursprungs sind.
Zu Beginn der Arbeit werden die gängigen Definitionen des Begriffs Fremdwort vorgestellt und ihre Problematik dargelegt. Darauf folgt die Erläuterung der Untersuchung mit Ergebnissen und meiner Interpretation, die in einem Fazit zusammengefasst werden. Der komplette Untersuchungsfragebogen befindet sich im Anhang, ebenso eine weitere Ergebnisliste zu den Beantwortungsverhältnissen in den einzelnen Fragebögen.
Ich habe mich in der vorliegenden Arbeit auf lexikalische Entlehnungen beschränkt. Im theoretischen Teil wird zwischen Fremd- und Lehnwort unterschieden, in der Untersuchung taucht der Begriff Lehnwort nicht auf; dort geht es im Allgemeinen um Wörter fremden Ursprungs. Die weiteren Entlehnungsmöglichkeiten wie Lehnprägung, Lehnbildung etc. wurden als Begrifflichkeiten komplett außen vor gelassen; allein in der Liste C des Fragebogens tauchen Wörter wie zum Beispiel Surfbrett auf, die nicht komplett entlehnt sind, sondern eigentlich unter die Hybride fallen. Hier gelten sie, aufgrund des fremden Bestandteils, ebenfalls als Wörter fremden Ursprungs.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen des Begriffs Fremdwort
- Traditionelle Definition
- Heutige gebräuchliche Definition
- Integrationsstufen
- Kritik an den Begriffsfestlegungen
- Untersuchungsgegenstand
- Untersuchung zum Empfinden der Fremdheit eines Wortes
- Untersuchungsaufbau und -methode
- Ergebnisse
- Definition Fremdwort (Teil B)
- Liste der Wörter (Teil C)
- Interpretation der Ergebnisse
- Wörter, die besonders häufig als fremd empfunden wurden
- Wörter, die besonders häufig als nicht fremd empfunden wurden
- Zusammenhang Empfindung – Wissen um Herkunft
- Zusammenhang Empfindung - Definition
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das subjektive Empfinden von Fremdheit gegenüber Wörtern fremden Ursprungs. Ziel ist es, die Grenzen der traditionellen und modernen Definitionen von Fremdwörtern zu beleuchten und die Rolle des individuellen Empfindens in der Wahrnehmung von sprachlicher Fremdheit zu erforschen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Fremdwort"
- Untersuchung des subjektiven Empfindens von Fremdheit
- Analyse des Zusammenhangs zwischen Empfinden, Wissen um die Herkunft und der Definition von Fremdwörtern
- Bewertung der gängigen Definitionen von Fremdwörtern
- Auswertung der Ergebnisse einer empirischen Untersuchung mittels Fragebogen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, welches die subjektive Wahrnehmung von Fremdheit bei Wörtern fremden Ursprungs untersucht. Die Autorin hebt die Bedeutung des individuellen Empfindens im Gegensatz zu rein formalen sprachwissenschaftlichen Kriterien hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit: Definitionen, Methodik, Ergebnisse und Interpretation. Der Fokus liegt auf lexikalischen Entlehnungen, wobei der Unterschied zwischen Fremd- und Lehnwörtern im theoretischen Teil erläutert wird, während die Untersuchung selbst sich auf Wörter fremden Ursprungs konzentriert.
2 Definitionen des Begriffs Fremdwort: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen des Begriffs „Fremdwort“, beginnend mit der traditionellen Definition nach Kleinpaul, die „Fremdheit“ und „Einverleibung“ ins Deutsche betont. Der Unterschied zwischen Fremd- und Lehnwörtern wird diskutiert, wobei die Grenzen zwischen diesen Kategorien als fließend dargestellt werden. Es wird die Kritik an diesen Definitionen dargelegt und die heutzutage gebräuchliche Definition vorgestellt, die Fremd- und Lehnwörter als Unterkategorien von Entlehnungen versteht und Integrationsstufen zur besseren Abgrenzung einführt. Der Fokus liegt auf der Problematik der Abgrenzung und der Unschärfe der bestehenden Definitionen.
Schlüsselwörter
Fremdwort, Lehnwort, Sprachkontakt, subjektives Empfinden, Fremdheit, Entlehnung, Integrationsstufen, empirische Untersuchung, Fragebogen, Wortursprung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Subjektives Empfinden von Fremdheit gegenüber Wörtern
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht das subjektive Empfinden von Fremdheit gegenüber Wörtern fremden Ursprungs. Es geht darum, die Grenzen traditioneller und moderner Definitionen von Fremdwörtern zu beleuchten und die Rolle des individuellen Empfindens bei der Wahrnehmung sprachlicher Fremdheit zu erforschen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Grenzen der Definition von "Fremdwort" zu untersuchen und den Einfluss des individuellen Empfindens auf die Wahrnehmung von sprachlicher Fremdheit zu analysieren. Es wird der Zusammenhang zwischen Empfinden, Wissen um die Herkunft und der Definition von Fremdwörtern untersucht.
Welche Definitionen von "Fremdwort" werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet traditionelle Definitionen (z.B. nach Kleinpaul), die den Aspekt der "Fremdheit" und der "Einverleibung" ins Deutsche betonen, und modernere Definitionen, die Fremd- und Lehnwörter als Unterkategorien von Entlehnungen verstehen und Integrationsstufen zur Abgrenzung einführen. Die Kritik an diesen Definitionen wird ebenfalls diskutiert.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung mittels Fragebogen, um das subjektive Empfinden von Fremdheit gegenüber Wörtern zu erfassen. Der Aufbau und die Methode dieser Untersuchung werden detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden präsentiert und interpretiert. Es werden Wörter aufgeführt, die besonders häufig als fremd bzw. nicht fremd empfunden wurden. Die Zusammenhänge zwischen Empfindung, Wissen um die Herkunft und den Definitionen von Fremdwörtern werden analysiert.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert?
Die Interpretation der Ergebnisse fokussiert auf den Zusammenhang zwischen dem subjektiven Empfinden von Fremdheit, dem Wissen über die Herkunft der Wörter und den verschiedenen Definitionen von Fremdwörtern. Es wird analysiert, wie stark diese Faktoren das Empfinden beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Fremdwort, Lehnwort, Sprachkontakt, subjektives Empfinden, Fremdheit, Entlehnung, Integrationsstufen, empirische Untersuchung, Fragebogen, Wortursprung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die eine Einleitung, Definitionen des Begriffs Fremdwort, den Untersuchungsgegenstand, die Untersuchungsergebnisse, die Interpretation der Ergebnisse und ein Fazit umfassen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist der Unterschied zwischen Fremd- und Lehnwörtern?
Der Unterschied zwischen Fremd- und Lehnwörtern wird im theoretischen Teil der Arbeit erläutert. Die Grenzen zwischen diesen Kategorien werden als fließend dargestellt, wobei die Arbeit sich in der empirischen Untersuchung auf Wörter fremden Ursprungs konzentriert.
- Quote paper
- Grit Sündermann (Author), 2006, Untersuchung zum Empfinden der Fremdheit eines Wortes fremden Ursprungs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68901