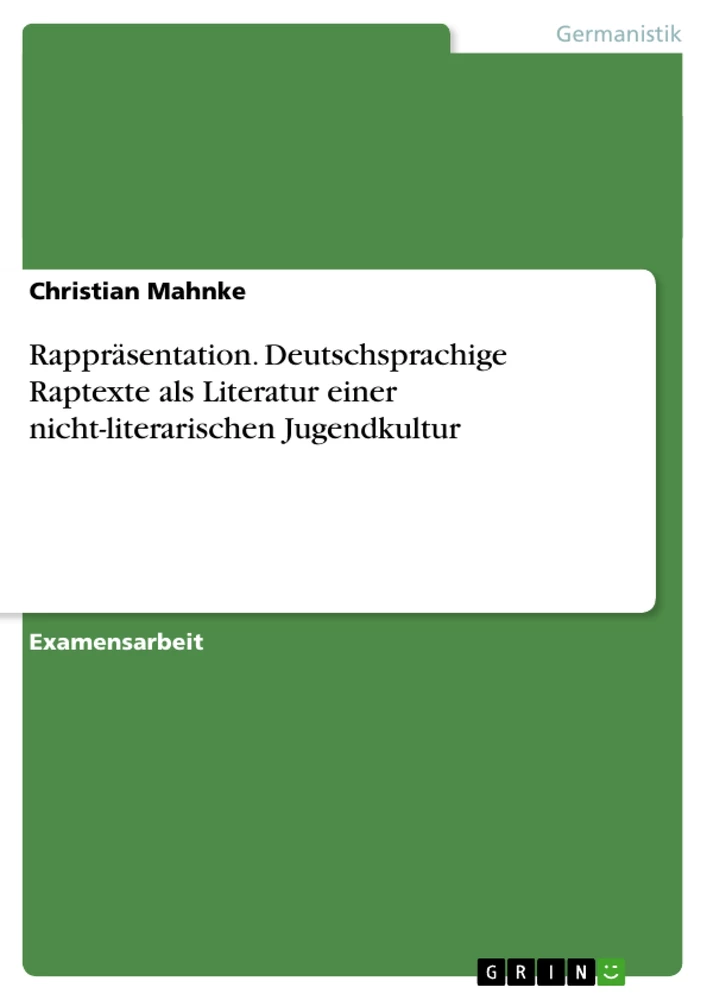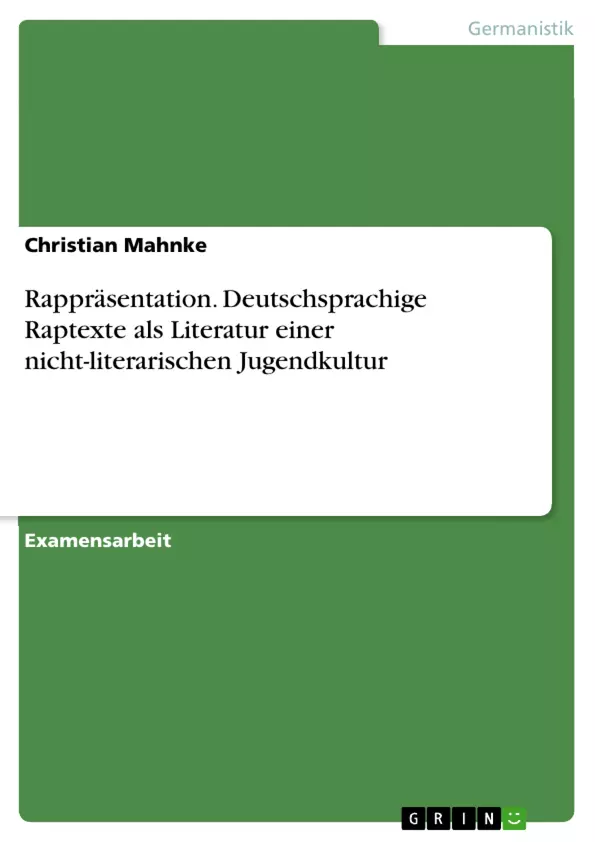"Goethe, Nietzsche und die Kirche shit, der nie im Kontext zu mir entstand [...]ich brech' Dir die Strophe, Vers nach Verse." In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass die jugendlichen Angehörigen der HipHop-Kultur in Deutschland, die meist migrantischer Abstammung sind und, aufgrund ihres sozial schwachen Umfeldes und eigener Existenz- und Zukunftsängste, meist nur einen geringen bis gar keinen Bezug zu traditionellen Literaturformen wie Gedichten, Dramen, Novellen oder Romanen haben, mit der Aneignung und Praktizierung von Rap eine neue literarische Gattung etablierten. Im Sinne einer „Rappräsentation“ erfahren, reflektieren und kommunizieren sich die Jugendlichen selbst und den Rap an sich über die Raptexte. In der Rezeption, Produktion und Performanz von Rap suchen, entwickeln, präsentieren und behaupten sie Identität und bringen ihre individuellen Gesellschaftsbilder zum Ausdruck. Im Sinne einer „Literatur einer nicht-literarischen Jugend“ finden gerade vieler solcher Jugendlicher, die in Zusammenhang mit ihrer persönlichen, sprachlichen oder schulischen Situation literaturverdrossen sind, in den Raptexten einen freien Aktionsraum, in dem sie sich ungezwungen und eigenständig in deutscher Sprache literarisch betätigen, entwickeln und entfalten können. Besonders wichtig erscheint dabei die Möglichkeit, als gesellschaftlicher Außenseiter Kritik an der Herrschaftsgesellschaft ausüben und auf soziale Missstände hinweisen zu können. In Kapitel 2 werden zunächst die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit erläutert, um aufzuzeigen, auf welche Art und Weise deutschsprachige Raptexte die Literatur einer nicht-literarischen Jugendkultur bilden, welche Funktionen sie für die Jugendlichen erfüllen und wie sie von den Jugendlichen inhaltlich gestaltet werden. Dazu wird zuerst der Begriff „deutschsprachiger Raptext“ erläutert und [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen der Arbeit
- Begriffserklärung deutschsprachiger Raptext
- Literaturwissenschaftliche Berechtigung deutschsprachiger Raptexte
- Literaturwissenschaftliche Relevanz deutschsprachiger Raptexte
- Literarische Situation von Jugendlichen in Deutschland
- Forschungsgegenstand Rap im Kontext
- Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Rap im Kontext der HipHop-Kultur
- Entstehung des Rap im Kontext der HipHop-Kultur in den USA
- Entwicklung des Raps im Kontext der HipHop-Kultur in den USA
- Entstehung des Raps im Kontext der HipHop-Kultur in Deutschland
- Entwicklung des Raps im Kontext der HipHop-Kultur in Deutschland
- Afrikanische Sprachpraktiken im Rap
- Rapgenres in Deutschland
- Polit-Rap
- Story-Rap
- Party-Rap
- Pimp-Rap
- Battle-Rap
- Gangster-Rap
- Freestyle-Rap
- Hermeneutisch-kontextualistische Analyse und Interpretation ausgewählter Raptexte
- Präsentation und Konstruktion von Identität in deutschsprachigen Raptexten
- Interpretation des Polit-Raptextes „Eins auf Eins“ von Skills En Masse
- Interpretation des Story-Raptextes „Die Jungs aus'm Reihenhaus“ von Blumentopf
- Interpretation des Story-Raptextes „Ich hab' geschrieben“ von Torch
- Präsentation von Gesellschaftsbildern und Erfahrungswelten in deutschsprachigen Raptexten
- Interpretation des Gangster-Raptextes „Mein Block“ von Sido
- Interpretation des Gangster-Raptextes „Mein Block“ von Azad
- Interpretation des Story-Raptextes „Mein Block“ von Blumentopf
- Interpretation des Battle-Raptextes „Mein Block“ von Aggro Berlin
- Interpretation des Battle-Raptextes „Mein Block“ von Eko
- Resümee und Fazit der Interpretation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht deutschsprachige Raptexte als literarische Ausdrucksform einer nicht-literarischen Jugendkultur. Ziel ist es aufzuzeigen, wie Jugendliche, insbesondere solche mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligtem Umfeld, durch Rap eine neue literarische Gattung etablieren, Identität konstruieren und gesellschaftliche Verhältnisse reflektieren.
- Rap als literarische Gattung in der Jugendkultur
- Identitätskonstruktion und -präsentation in Raptexten
- Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse und sozialer Missstände im Rap
- Der hermeneutisch-kontextualistische Ansatz zur Analyse von Raptexten
- Deutschsprachiger Rap im Vergleich zu US-amerikanischem Rap
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die zentrale These: Deutschsprachige Raptexte bilden eine literarische Gattung innerhalb einer nicht-literarischen Jugendkultur. Sie beschreibt die Motivation der Jugendlichen, sich durch Rap auszudrücken und ihre Erfahrungen zu verarbeiten, insbesondere im Kontext sozialer Benachteiligung und des Mangels an Zugang zu traditionellen Literaturformen. Die Arbeit verspricht eine theoretische Fundierung und eine Analyse ausgewählter Raptexte.
Theoretische Grundlagen der Arbeit: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse deutschsprachiger Raptexte als Literatur fest. Es definiert den Begriff „deutschsprachiger Raptext“ und untersucht dessen Berechtigung und Relevanz als literaturwissenschaftlicher Forschungsgegenstand. Es wird zwischen pragmatischem, deskriptivem und normativem Literaturbegriff unterschieden, um die Einordnung von Raptexten als Literatur zu rechtfertigen. Die Relevanz wird anhand der gesellschaftlichen Kontroversen um Raptexte und deren Bedeutung für Jugendliche erläutert, wobei der Bezug zu sozialen Unruhen in Frankreich 2005 hergestellt wird. Abschließend wird die literarische Situation Jugendlicher in Deutschland dargestellt und zwischen „literarischen“ und „nicht-literarischen“ Jugendlichen unterschieden, basierend auf den Ergebnissen der PISA-Studie und der Shell-Jugendstudie.
Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Rap im Kontext der HipHop-Kultur: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Raps, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Es zeichnet den historischen Kontext nach und betrachtet die verschiedenen Einflüsse, die zur Entstehung und Verbreitung des Raps beigetragen haben. Die Entwicklung der verschiedenen Rapgenres wird detailliert beschrieben und analysiert, um deren Entwicklung und Bedeutung im Gesamtzusammenhang zu verstehen.
Afrikanische Sprachpraktiken im Rap: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss afrikanischer Sprachpraktiken auf den deutschen Rap. Es wird untersucht, wie diese Einflüsse die sprachliche Gestaltung und die kulturelle Bedeutung des Raps prägen.
Rapgenres in Deutschland: In diesem Kapitel werden verschiedene Rapgenres in Deutschland vorgestellt und charakterisiert (Polit-Rap, Story-Rap, Party-Rap, Pimp-Rap, Battle-Rap, Gangster-Rap, Freestyle-Rap). Die spezifischen Merkmale, die jeweiligen Themen und die kulturelle Bedeutung jedes Genres werden im Detail untersucht und in Beziehung zu den anderen Genres und dem Gesamtkontext des deutschen Raps gesetzt.
Schlüsselwörter
Deutschsprachiger Rap, Jugendkultur, Literaturwissenschaft, Identität, Gesellschaftskritik, HipHop, Interpretationsansatz, sozialer Kontext, Migrationshintergrund, Rapgenres.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse deutschsprachiger Raptexte als literarische Ausdrucksform
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht deutschsprachige Raptexte als literarische Ausdrucksform einer nicht-literarischen Jugendkultur. Der Fokus liegt darauf, wie Jugendliche, insbesondere mit Migrationshintergrund und benachteiligtem Umfeld, durch Rap Identität konstruieren, gesellschaftliche Verhältnisse reflektieren und eine neue literarische Gattung etablieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung des Raps in den USA und Deutschland, verschiedene Rapgenres (Polit-Rap, Story-Rap, Party-Rap, Pimp-Rap, Battle-Rap, Gangster-Rap, Freestyle-Rap), afrikanische Sprachpraktiken im Rap, die Präsentation von Identität und Gesellschaftsbildern in Raptexten und die Anwendung eines hermeneutisch-kontextualistischen Analyseansatzes.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen hermeneutisch-kontextualistischen Ansatz zur Analyse der Raptexte. Es werden ausgewählte Texte interpretiert, um die Präsentation von Identität und Gesellschaftsbildern zu untersuchen. Die theoretischen Grundlagen werden durch die Auseinandersetzung mit dem Literaturbegriff und der literarischen Situation Jugendlicher in Deutschland gelegt.
Welche Raptexte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch Texte von Künstlern wie Skills En Masse ("Eins auf Eins"), Blumentopf ("Die Jungs aus'm Reihenhaus", "Mein Block"), Torch ("Ich hab' geschrieben"), Sido ("Mein Block"), Azad ("Mein Block"), und weitere Künstler im Kontext von Gangster- und Battle-Rap.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, deutschsprachigen Rap als literarische Gattung zu etablieren und aufzuzeigen, wie er von Jugendlichen als Medium der Identitätsfindung und gesellschaftlichen Kritik genutzt wird. Es soll die literaturwissenschaftliche Relevanz von Raptexten und deren Bedeutung im Kontext sozialer Benachteiligung und Migration herausgearbeitet werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, Kapitel zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Raps, zu afrikanischen Sprachpraktiken im Rap, zu den Rapgenres in Deutschland und ein Kapitel mit der hermeneutisch-kontextualistischen Analyse ausgewählter Raptexte, gefolgt von einem Schlusskapitel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutschsprachiger Rap, Jugendkultur, Literaturwissenschaft, Identität, Gesellschaftskritik, HipHop, Interpretationsansatz, sozialer Kontext, Migrationshintergrund, Rapgenres.
- Quote paper
- 1. Staatsexamen Christian Mahnke (Author), 2006, Rappräsentation. Deutschsprachige Raptexte als Literatur einer nicht-literarischen Jugendkultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68941