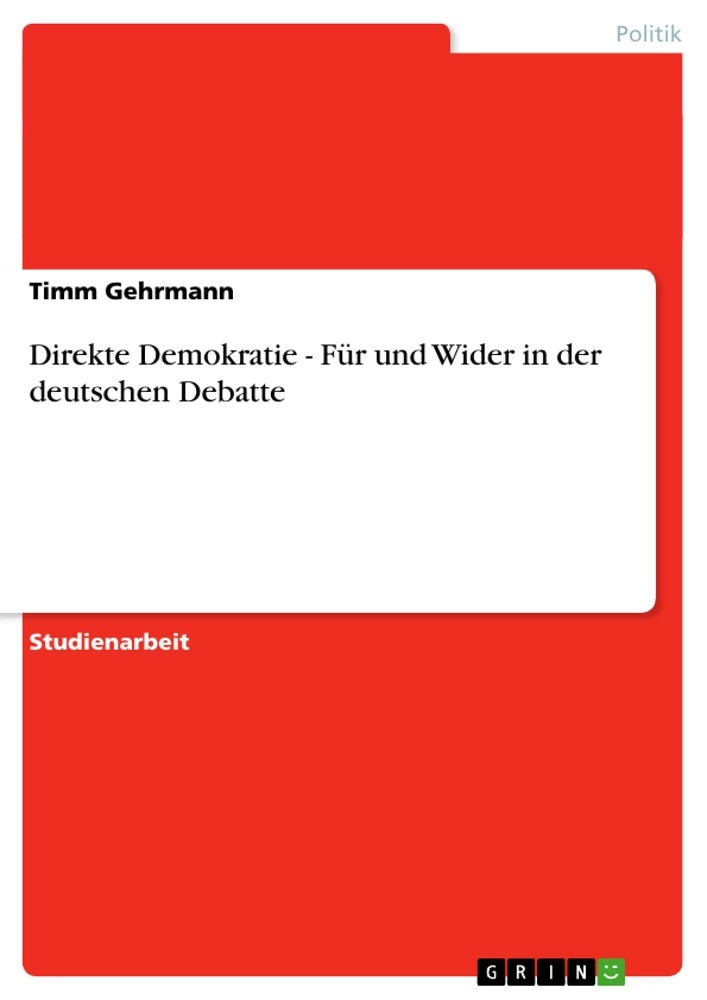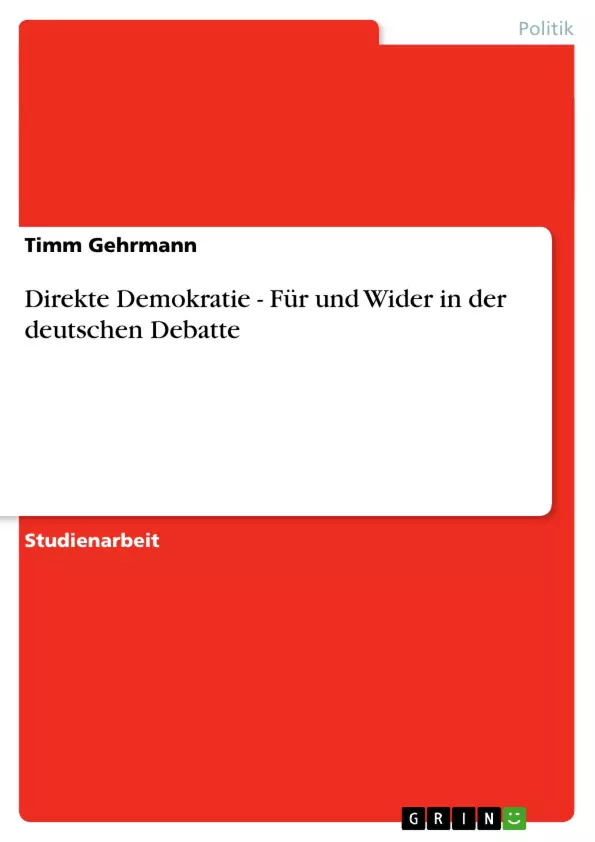In der Antike, als Demokratie erstmals als Idee der Verwaltung größerer Einheiten aufkam, war diese in erster Linie direkt organisiert, und repräsentative Formen, wie der Rat der 500, waren nur zur Erstellung der Tagesordnung und zur Entscheidungsvorbereitung eingerichtet worden1. In der griechischen Polis traf man sich auf dem Marktplatz und es wurde durch Handzeichen abgestimmt. Diese Art der Versammlungsdemokratie hat natürlich ihre Grenzen gefunden und war dementsprechend auch nur in relativ kleinen Gebilden wie eben dem Athenischen Stadtstaat tatsächlich praktikabel. In der Folge dessen wurde die direkte Demokratie zunehmend durch repräsentative Formen des Regierens ersetzt, die zugleich aber auch zu einer Machtkonzentration bei den Vertretern des Volkes geführt haben, die es einem nicht länger erlaubten von einer Demokratie zu sprechen. Im Verlauf der Geschichte kam die Demokratie zunehmend aus der Mode und wurde durch entsprechende diktatorische Formen des Regierens ersetzt, was zunächst als eine Folge der Ablösung von direkter durch repräsentative Formen der Demokratie angesehen werden kann. Erst mit dem „Mayflower Compact“ leben demokratische Ideale wieder im westlich-abendländischen Kontext auf und gipfeln schließlich in der Declaration of Independence 1776, die durch die Lossagung von der Unterdrückung durch den Englischen König den Weg für einen durch das Volk direkt und demokratisch konstituierten Staat frei macht, indem zwar aufgrund seiner Größe nicht alles, aber doch einiges in vielen Bundesstaaten demokratisch entschieden wird. Auf dem europäischen Kontinent hingegen sind die Anfänge durch die französische Revolution e
er dürftig und es wird außer zur Festigung eines diktatorischen Regimes durch Plebiszite kein Gebrauch von den durch die Verfassung verankerten direktdemokratischen Entscheidungsmöglichkeiten gemacht. In Deutschland, wo alleine die Weimarer Verfassung Plebiszite, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zuließ und tatsächlich auch zwei Bürgerentscheide zustande kamen allerdings aufgrund von Beteiligungsquoren nicht Gesetz wurden2, gibt es auf Bundesebene bis heute keine Möglichkeit der direktdemokratischen Entscheidung durch das Volk3. Dennoch hat sich seit den 60er Jahren beständig eine direktdemokratische Kultur entwickelt, die an den durch die Verfassung vorgegeben Grenzen weiterhin zurückgehalten wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Beweggründe für mehr direkte Demokratie
- Direkte Demokratie zur Steigerung der Zufriedenheit mit politischen Entscheidungen
- Direkte Demokratie zur Bereicherung und Förderung des Pluralismus
- Direkte Demokratie als Kontrollinstrument
- Die Argumente gegen direkte Demokratie
- Das Problem der Finanzierbarkeit
- Die Unvorhersehbarkeit und damit Gefährdung der Stabilität
- Die Inkompetenz des Bürgers
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Beweggründen und Argumenten für und gegen mehr direkte Demokratie in Deutschland. Sie untersucht die historischen Wurzeln direkter Demokratie, die aktuelle Debatte um ihre Bedeutung und ihre Rolle in der modernen Gesellschaft.
- Die Rolle der direkten Demokratie in der Steigerung der Zufriedenheit mit politischen Entscheidungen
- Die Bedeutung direkter Demokratie für den Pluralismus und die Bürgerbeteiligung
- Die direkte Demokratie als Kontrollinstrument gegenüber der politischen Macht
- Die Argumente gegen direkte Demokratie, insbesondere die Frage der Finanzierbarkeit und der Stabilität des politischen Systems
- Die Rolle der Bürgerkompetenz im Kontext der direkten Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der direkten Demokratie dar und zeigt ihre Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart auf. Sie betont die Herausforderungen und Chancen, die mit der direkten Demokratie verbunden sind.
Die Beweggründe für mehr direkte Demokratie
Dieses Kapitel beleuchtet die Argumente für mehr direkte Demokratie in Deutschland. Es untersucht die Rolle der direkten Demokratie in der Steigerung der Zufriedenheit mit politischen Entscheidungen, die Förderung des Pluralismus und die Verbesserung der Kontrolle über die politische Macht.
Die Argumente gegen direkte Demokratie
Dieses Kapitel stellt die Argumente gegen mehr direkte Demokratie dar. Es diskutiert die Probleme der Finanzierbarkeit, die Unvorhersehbarkeit und die potenzielle Gefährdung der Stabilität des politischen Systems sowie die Frage der Bürgerkompetenz.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, Bürgerbeteiligung, politische Entscheidungen, Legitimität, Pluralismus, Kontrollinstrument, Finanzierbarkeit, Stabilität, Bürgerkompetenz, Politikverdrossenheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Ursprung der direkten Demokratie?
Die direkte Demokratie hat ihren Ursprung in der antiken griechischen Polis, insbesondere im Athenischen Stadtstaat. Dort trafen sich die Bürger auf dem Marktplatz, um per Handzeichen über politische Angelegenheiten abzustimmen.
Warum gibt es in Deutschland auf Bundesebene keine Volksentscheide?
Obwohl die Weimarer Verfassung Plebiszite zuließ, sieht das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene bisher keine direkten Entscheidungen durch das Volk vor, da der Fokus auf der repräsentativen Demokratie liegt.
Welche Argumente sprechen für mehr direkte Demokratie?
Befürworter argumentieren, dass direkte Demokratie die Zufriedenheit mit politischen Entscheidungen steigert, den Pluralismus fördert und als wichtiges Kontrollinstrument gegenüber politischer Machtkonzentration dient.
Welche Kritikpunkte gibt es gegen direkte Demokratie?
Häufige Gegenargumente sind die hohen Kosten (Finanzierbarkeit), die potenzielle Gefährdung der politischen Stabilität durch Unvorhersehbarkeit sowie Zweifel an der Fachkompetenz der Bürger bei komplexen Themen.
Was war der "Mayflower Compact" in Bezug auf die Demokratie?
Der Mayflower Compact gilt als ein Moment, in dem demokratische Ideale im westlichen Kontext wieder auflebten und schließlich den Weg für direkt konstituierte Staaten wie die USA ebneten.
Wie hat sich die direktdemokratische Kultur in Deutschland seit den 60er Jahren entwickelt?
Seit den 1960er Jahren hat sich in Deutschland stetig eine Kultur der Bürgerbeteiligung entwickelt, die jedoch durch die verfassungsrechtlichen Grenzen der repräsentativen Ordnung limitiert bleibt.
- Quote paper
- Timm Gehrmann (Author), 2007, Direkte Demokratie - Für und Wider in der deutschen Debatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68976