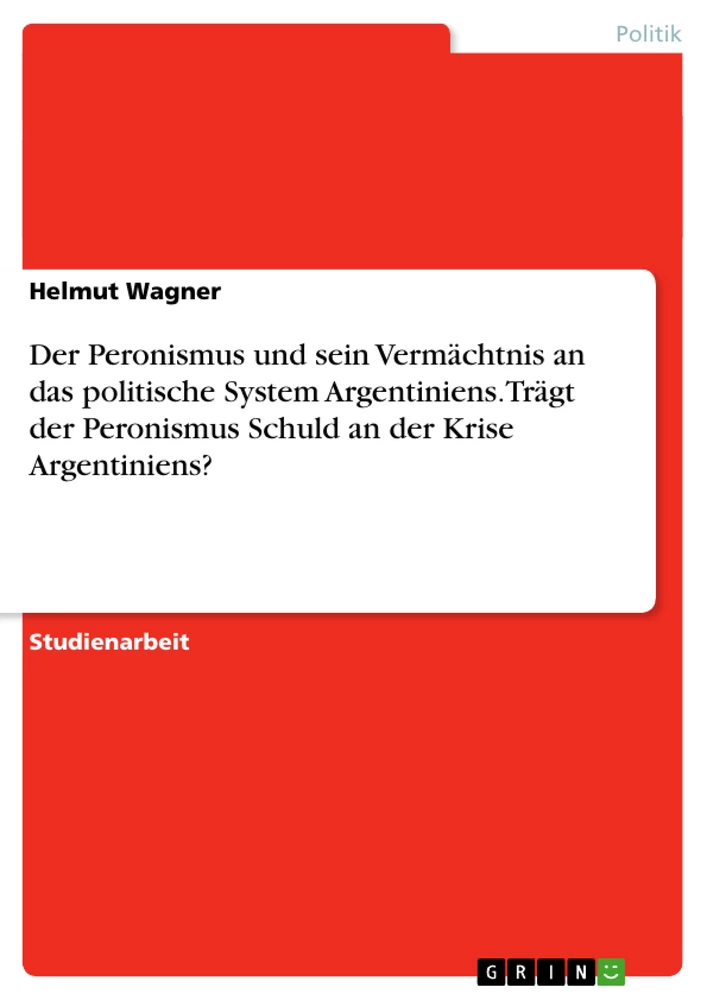Wirft man einen Blick zurück auf das Argentinien zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so bietet sich dem Betrachter auf den ersten Blick ein Land mit glänzenden Perspektiven. Eine gemeinsame Verbindung zum lateinamerikanischen Kontinent schien damals lediglich bezüglich der geographischen Lage herstellbar. Im Vergleich zu seinen Nachbarländern war Argentinien sowohl in sozialer als auch politisch-institutioneller Hinsicht weitaus fortgeschrittener, ins Auge stach jedoch insbesondere die wirtschaftliche Überlegenheit. Diese basierte auf einer Exportökonomie, die sich in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts entwickelte und dem Land bis in die 30er Jahre hinein großen Reichtum und Wohlstand bescherte. Zu dieser Zeit zählte es zu den fortgeschrittensten Ländern und sein Entwicklungsniveau glich in etwa dem Australiens, Kanadas und Südeuropas. Durch seine Entwicklungsvoraussetzungen war das Land geradezu prädestiniert dafür, einen dynamischen Industrialisierungsprozess zu durchlaufen. Argentinien spielte in einer anderen Liga als der Rest des Kontinents und blickte frohen Mutes in die Zukunft.
Statt dauerhafter Prosperität folgten jedoch Peronimus, unzählige Militärdiktaturen und ein dramatischer wirtschaftlicher Abstieg. Argentinien konnte sein Entwicklungspotential nicht nutzen und zu Beginn des neuen Jahrhunderts könnte der Kontrast zur ehemals vielversprechenden Ausgangssituation kaum größer sein: das Land liegt wirtschaftlich am Boden und befindet sich in einem derart umfassenden Geflecht aus ökonomischen, sozialen und politischen Krisen, dass die Lage fast ausweglos erscheint. Argentinien ist heute längst auf dem Boden der Tatsachen angekommen und damit der Illusion beraubt, dem allgemeinen lateinamerikanischen Schicksal entrinnen zu können.
Welche Schuld an dieser Entwicklung trägt dabei das populistische Regime unter Juan D. Peron? Um dieser Frage nachzugehen, werden zuerst die historischen Aufstiegsbedingungen des Peronismus dargestellt. Es folgt eine Analyse seiner inhaltlichen Programmatik, sowie eine Charakterisierung und Einordnung dieser Herrschaftsform. Nach einer Erläuterung seiner Erfolgsbedingungen und Machtquellen, wird dann die Frage nach den Gründen für das Scheitern des Peronismus erörtert. Die Klärung der Schuldfrage erfolgt schließlich aufgrund einer objektiv-historischen Analyse des peronistischen Erbes auf sozialem, ökonomischem und politischem Gebiet.
Fazit der Bewertung: » Eine gelungene Analyse mit differenzierter Abwägung. «
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Peronismus und sein Vermächtnis an das politische System Argentiniens
- Die Bedingungen seines Aufstiegs. Antwort auf eine Krise
- Der Peronismus
- Die Programmatik des Peronismus
- Der Peronismus und lateinamerikanischer Populismus
- Machtquellen und Charisma
- Gründe für das Scheitern. Eine polarisierte Gesellschaft
- Das peronistische Vermächtnis und die argentinische Krise
- Die Gesellschaft
- Die Wirtschaft
- Die Politik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern der Peronismus für die heutige desaströse Situation Argentiniens verantwortlich ist. Dazu werden zunächst die Bedingungen des Aufstiegs der Bewegung im Kontext der Weltwirtschaftskrise von 1930 und der vorhergehenden "década infame" (1930-1943) beleuchtet. Anschließend wird die Programmatik des Peronismus analysiert, seine Herrschaftsform charakterisiert und seine Machtquellen sowie sein Charisma untersucht. Im weiteren Verlauf werden die Gründe für das Scheitern des Peronismus und die Auswirkungen auf die argentinische Gesellschaft, Wirtschaft und Politik beleuchtet.
- Die Weltwirtschaftskrise als Ausgangspunkt für die Entstehung des Peronismus
- Die Programmatik des Peronismus: soziale Stabilität und Wirtschaftspolitik
- Machtquellen und Charisma des Peronismus
- Gründe für das Scheitern des Peronismus
- Das peronistische Vermächtnis und die argentinische Krise
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung skizziert die Situation Argentiniens zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das durch seine wirtschaftliche Überlegenheit gegenüber seinen lateinamerikanischen Nachbarn auffiel. Es wird auf die Entwicklung einer Exportökonomie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingegangen, die dem Land bis in die 30er Jahre großen Wohlstand bescherte. Allerdings konnte Argentinien sein Entwicklungspotential nicht nutzen und fand sich zu Beginn des neuen Jahrhunderts in einer umfassenden Wirtschafts-, Sozial- und politischen Krise wieder.
Der Peronismus und sein Vermächtnis an das politische System Argentiniens
Die Bedingungen seines Aufstiegs. Antwort auf eine Krise
Die Weltwirtschaftskrise von 1930 zeigte die Anfälligkeit des argentinischen Wirtschaftsmodells für konjunkturelle Schwankungen auf dem Weltmarkt auf und führte zu einer "década infame" (1930-1943) mit zunehmender sozialer und politischer Instabilität. Die herrschende Oligarchie, die sich durch Wahlbetrug und Korruption an der Macht hielt, ignorierte die wachsende Bedeutung der einsetzenden Industrialisierung und die damit verbundenen sozialen Veränderungen. Dies führte zu einer Polarisierung der Gesellschaft und der Notwendigkeit einer überparteilichen Entwicklungsstrategie.
Der Peronismus
Die Programmatik des Peronismus
Der Peronismus zielte auf die Gewährleistung sozialer Stabilität durch eine Stärkung des politischen Systems und die Durchsetzung einer am Gemeinwohl orientierten Politik. Der Staat sollte als Schiedsrichter zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen fungieren und den Dialog mit allen Bevölkerungsgruppen suchen.
Der Peronismus und lateinamerikanischer Populismus
Dieser Abschnitt analysiert die Einordnung des Peronismus in den Kontext des lateinamerikanischen Populismus und untersucht, inwiefern sich der Peronismus von anderen populären Bewegungen der Region unterscheidet.
Machtquellen und Charisma
Dieser Abschnitt untersucht die Machtquellen des Peronismus, insbesondere sein Charisma und die Fähigkeit, die Massen zu mobilisieren. Es wird beleuchtet, wie Perón durch seine Politik die Unterstützung der Arbeiterklasse gewinnen konnte und wie er seine Macht durch autoritäre Methoden festigte.
Gründe für das Scheitern. Eine polarisierte Gesellschaft
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Ursachen für das Scheitern des Peronismus. Es wird argumentiert, dass die polarisierte Gesellschaft und der fehlende Konsens über die politische und wirtschaftliche Zukunft Argentiniens zu einer Instabilität führten, die letztlich den Zusammenbruch des Peronismus bewirkte.
Das peronistische Vermächtnis und die argentinische Krise
Dieser Abschnitt beleuchtet die Folgen des Peronismus für die argentinische Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Es werden die Auswirkungen auf die soziale Struktur, die wirtschaftliche Entwicklung und die politische Stabilität analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Peronismus, seiner Programmatik, seiner Herrschaftsform und seiner Auswirkungen auf die argentinische Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Peronismus, Argentinien, lateinamerikanischer Populismus, Wirtschaftskrise, soziale Stabilität, Machtquellen, Charisma, politische Polarisierung, Wirtschaftspolitik, Entwicklungspotenzial.
Häufig gestellte Fragen
Trägt der Peronismus Schuld an der Krise Argentiniens?
Die Arbeit analysiert das peronistische Erbe auf ökonomischem und sozialem Gebiet und wägt ab, inwieweit diese Politik zur langfristigen Instabilität beitrug.
Wie kam Juan D. Perón an die Macht?
Perón nutzte die Krise der Exportökonomie und die soziale Instabilität der „década infame“, um die Unterstützung der Arbeiterklasse zu gewinnen.
Was war die zentrale Programmatik des Peronismus?
Ziele waren soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit und politische Souveränität (Justicialismo), oft gepaart mit populistischen Methoden.
Warum scheiterte das peronistische Modell schließlich?
Interne Widersprüche, eine polarisierte Gesellschaft und wirtschaftliche Ineffizienz führten zum Niedergang und zu nachfolgenden Militärdiktaturen.
Was ist das bleibende Vermächtnis des Peronismus in der Politik?
Bis heute prägt der Peronismus die politische Identität Argentiniens und sorgt für eine tiefe Spaltung zwischen Anhängern und Gegnern des Modells.
- Arbeit zitieren
- Helmut Wagner (Autor:in), 2004, Der Peronismus und sein Vermächtnis an das politische System Argentiniens.Trägt der Peronismus Schuld an der Krise Argentiniens?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69047