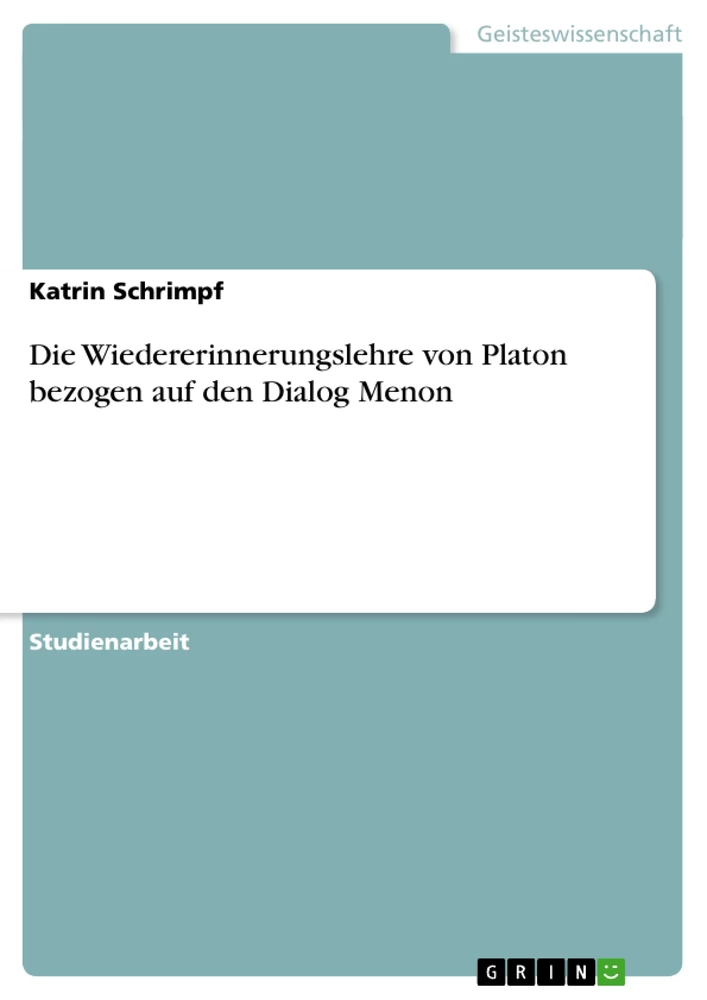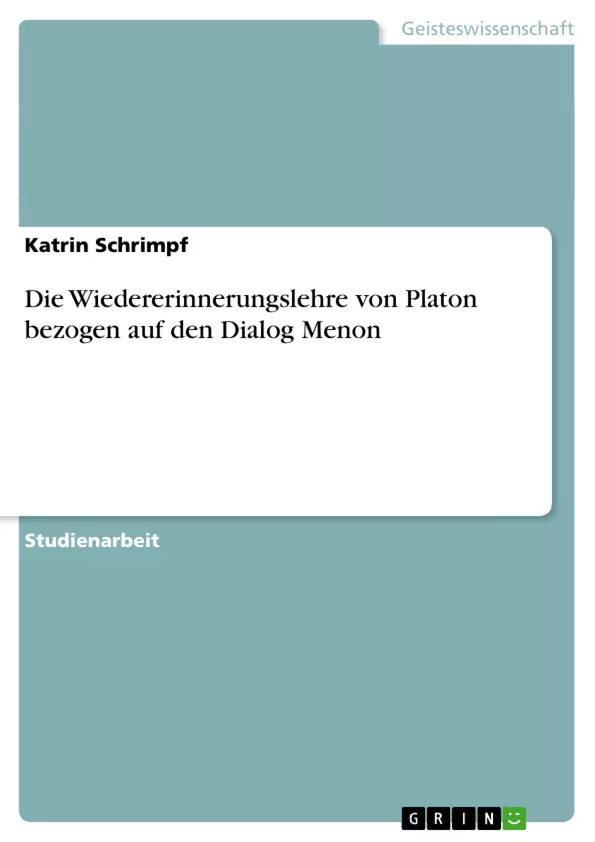Ich möchte mich in dieser Arbeit mit der Problematik der Wiedererinnerung aus dem Dialog Menon, welcher etwa zwischen 385 und 380 vor Christi von dem griechischen Philosoph Platon verfasst wurde, beschäftigen, da ich bereits im Seminar die Möglichkeit hatte, mich eingehendst mit diesem Thema auseinander zu setzen und ich den Gedanken, Lernen sei Wiedererinnern, persönlich sehr interessant finde.
Der Dialog Menon ist das einzige Werk, welches die Wiedererinnerung in Bezug auf Seelenwanderung und Reinkarnation aufgreift. Er behandelt das Thema, ob Tugend lehrbar sei und wirft somit zunächst die Frage einer Definition von Tugend auf. Im weiteren Verlauf wird dann das Problem des Lernens, welches als Wiedererinnern (Anamnesis) vorgestellt wird, erörtert.
Zunächst möchte ich kurz die Deutungsgeschichte der Wiedererinnerungslehre Platons anschneiden. Daraufhin folgt die Beschreibung und Interpretation der Geometriestunde, welche als Beweis der Anamnesis gilt. Diese Interpretation ist bezogen auf eine Theorie, welche mir am plausibelsten erscheint und bereits am Ende der Deutungsgeschichte kurz dargestellt und unter „3. Interpretationsvorschlag des Werkes“ genauer beschrieben wird.
Danach werde ich noch kurz auf eine häufig beschriebene Schwäche Platons eingehen und abschließend meine eigenen Gedanken zum Thema formulieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutungsgeschichte
- Die Geometriestunde
- Interpretationsvorschlag des Werks
- Kritik an Platon
- Schluss und eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Wiedererinnerungslehre im Kontext des Dialogs Menon. Ziel ist es, verschiedene Interpretationen dieser Lehre zu analysieren und eine eigene Position zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Interpretation des Textes, insbesondere die Verbindung von Anamnesis, Seelenwanderung und Apriori-Wissen.
- Interpretationsschwierigkeiten der Wiedererinnerungslehre
- Die Geometriestunde als Beweis der Anamnesis
- Anamnesis als Theorie des Apriori
- Kritik an Platons Argumentation
- Die Rolle von Wissen und Meinung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wiedererinnerungslehre Platons im Menon ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Autorin begründet ihr Interesse an diesem Thema durch ihre vorherige Auseinandersetzung im Seminar und hebt die Besonderheit des Menons hervor, als einziges Werk, das Wiedererinnerung mit Seelenwanderung verknüpft. Die zentrale Frage nach der Lehrbarkeit von Tugend und die Darstellung des Lernens als Wiedererinnern werden als Hauptthemen genannt.
Deutungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der Interpretation der Anamnesis, insbesondere die fehlende Thematisierung der Ideenlehre im Menon und die Relativierungen des Wiedererinnerungsmysthos durch Sokrates. Es wird auf verschiedene Interpretationsansätze eingegangen, von wörtlichen bis hin zu aprioristischen Lesarten, wobei die Schwierigkeiten und Kritikpunkte der jeweiligen Ansätze herausgestellt werden. Besonders wird die Interpretation der Anamnesis als Abfolge von zwei Erkenntnisakten (Erkenntnis des Nichtwissens und Erinnerung des Vergessenen) hervorgehoben, welche die Autorin für die weitere Analyse verwenden wird.
Die Geometriestunde: Dieses Kapitel analysiert die Geometriestunde im Menon als zentrale Illustration für Platons These vom Lernen als Wiedererinnern. Die Autorin beschreibt schrittweise den Dialog zwischen Sokrates und dem Sklaven, wobei sie die Phasen der anfänglichen falschen Antwort, der Erkenntnis des Nichtwissens und schließlich der richtigen Lösung herausarbeitet. Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung der Einsicht in das eigene Nichtwissen als Fortschritt im Erkenntnisprozess und widerlegt alternative Interpretationen.
Interpretationsvorschlag des Werks: Dieses Kapitel präsentiert einen eigenen Interpretationsvorschlag, der den Kontext des Dialogs und Menons Aporie in Bezug auf die Tugend berücksichtigt. Die Geometriestunde wird nicht als isolierter Beweis für die Anamnesis betrachtet, sondern als Sokrates' Antwort auf Menons sophistischen Einwand. Die Autorin analysiert Menons Missverständnis von Aporie und Sokrates' Strategie, dieses Missverständnis durch die Geometriestunde zu korrigieren. Das Kapitel erläutert, wie Sokrates Menons Vorstellung von Wissen und Aporie umdeutet und den Fortschritt im Erkenntnisprozess als Überwindung des Irrtums darstellt.
Kritik an Platon: Dieses Kapitel kritisiert Platons Theorie der Anamnesis. Es wird die Vermischung von wissenschaftlicher Erkenntnis und mythischer Dichtung angesprochen, die im Menon deutlich wird. Die Autorin moniert die unbewiesene Voraussetzung eines vorzeitlichen Seins der Seele als Fundament der platonischen Logik.
Schluss und eigene Stellungnahme: Die Autorin reflektiert ihre Recherche und stellt fest, dass die meisten Interpretationen des Menons sich nicht primär auf die Wiedererinnerungslehre konzentrieren. Sie wirft kritische Fragen zur Reichweite der Anamnesis auf, beispielsweise in Bezug auf soziale Erfahrungen und den unterschiedlichen Bildungsgrad von Menschen. Die stufenartige Entwicklung der Menschheit und der Ursprung des „ersten Wissens“ der Seele werden als weitere Probleme diskutiert. Abschließend interpretiert sie Platons Theorie als Metapher für das logische Denken und betont den positiven Aspekt der Anamnesis, dass sie den Menschen dazu anregen kann, aktiv nach Wissen zu suchen.
Schlüsselwörter
Wiedererinnerung (Anamnesis), Platon, Menon, Seelenwanderung, Apriori-Wissen, Geometriestunde, Lehrbarkeit der Tugend, Meinung, Wissen, Aporie, Interpretation, Kritik.
Häufig gestellte Fragen zu Platons Menon und der Wiedererinnerungslehre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Wiedererinnerungslehre (Anamnesis), wie sie im Dialog Menon dargestellt wird. Sie untersucht verschiedene Interpretationen dieser Lehre und entwickelt eine eigene Position dazu. Ein besonderer Fokus liegt auf den Schwierigkeiten bei der Interpretation des Textes und der Verbindung von Anamnesis, Seelenwanderung und Apriori-Wissen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Deutungsgeschichte, Die Geometriestunde, Interpretationsvorschlag des Werks, Kritik an Platon und Schluss und eigene Stellungnahme. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Wiedererinnerungslehre im Menon.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Interpretationen von Platons Wiedererinnerungslehre zu analysieren und eine eigene, fundierte Position zu entwickeln. Dabei werden die Interpretationsschwierigkeiten, die Rolle der Geometriestunde als Beweis der Anamnesis, Anamnesis als Theorie des Apriori und die Kritik an Platons Argumentation beleuchtet.
Wie wird die Geometriestunde interpretiert?
Die Geometriestunde im Menon wird als zentrale Illustration für Platons These vom Lernen als Wiedererinnern analysiert. Die Autorin beschreibt den Dialog zwischen Sokrates und dem Sklaven und betont die Bedeutung der Einsicht in das eigene Nichtwissen als Fortschritt im Erkenntnisprozess. Alternative Interpretationen werden widerlegt.
Welchen Interpretationsvorschlag bietet die Autorin?
Die Autorin präsentiert einen eigenen Interpretationsvorschlag, der den Kontext des Dialogs und Menons Aporie in Bezug auf die Tugend berücksichtigt. Die Geometriestunde wird nicht als isolierter Beweis gesehen, sondern als Sokrates' Antwort auf Menons sophistischen Einwand. Sokrates' Strategie, Menons Missverständnis von Aporie zu korrigieren, wird analysiert.
Welche Kritikpunkte an Platons Theorie werden genannt?
Die Arbeit kritisiert die Vermischung von wissenschaftlicher Erkenntnis und mythischer Dichtung in Platons Theorie. Die unbewiesene Voraussetzung eines vorzeitlichen Seins der Seele als Fundament der platonischen Logik wird moniert. Die Reichweite der Anamnesis bezüglich sozialer Erfahrungen und unterschiedlichen Bildungsgrades wird hinterfragt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Autorin?
Die Autorin stellt fest, dass viele Interpretationen des Menons sich nicht primär auf die Wiedererinnerungslehre konzentrieren. Sie wirft Fragen zur Reichweite der Anamnesis auf und diskutiert die stufenartige Entwicklung der Menschheit und den Ursprung des „ersten Wissens“ der Seele. Sie interpretiert Platons Theorie letztlich als Metapher für logisches Denken und betont den positiven Aspekt der Anamnesis, Menschen zum aktiven Wissenssuchen anzuregen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Wiedererinnerung (Anamnesis), Platon, Menon, Seelenwanderung, Apriori-Wissen, Geometriestunde, Lehrbarkeit der Tugend, Meinung, Wissen, Aporie, Interpretation, Kritik.
- Citar trabajo
- Katrin Schrimpf (Autor), 2006, Die Wiedererinnerungslehre von Platon bezogen auf den Dialog Menon, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69049