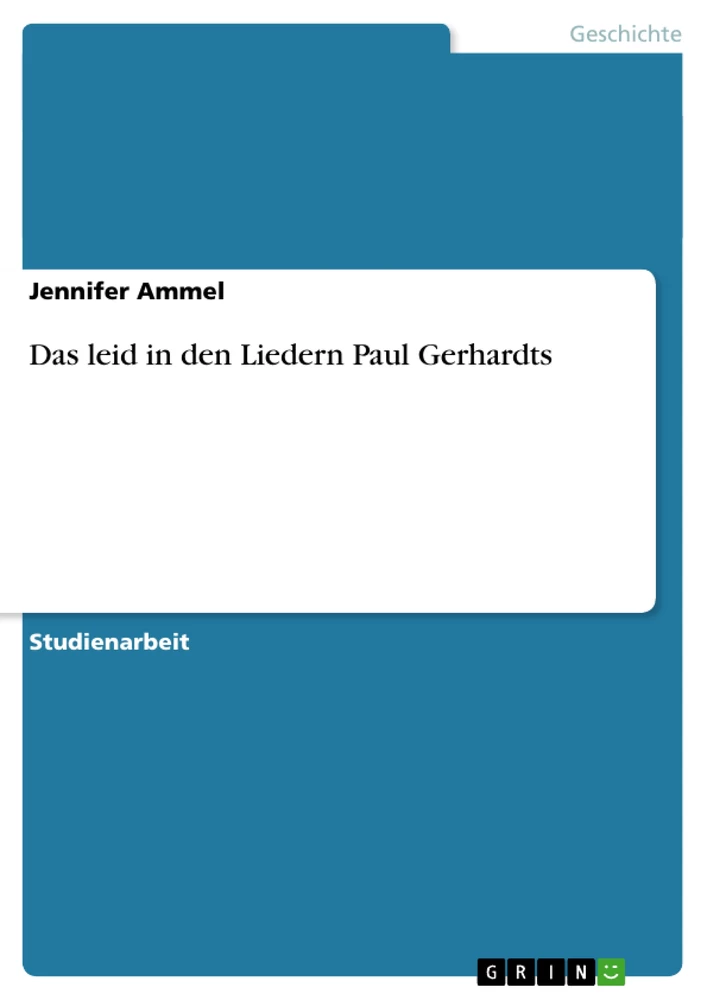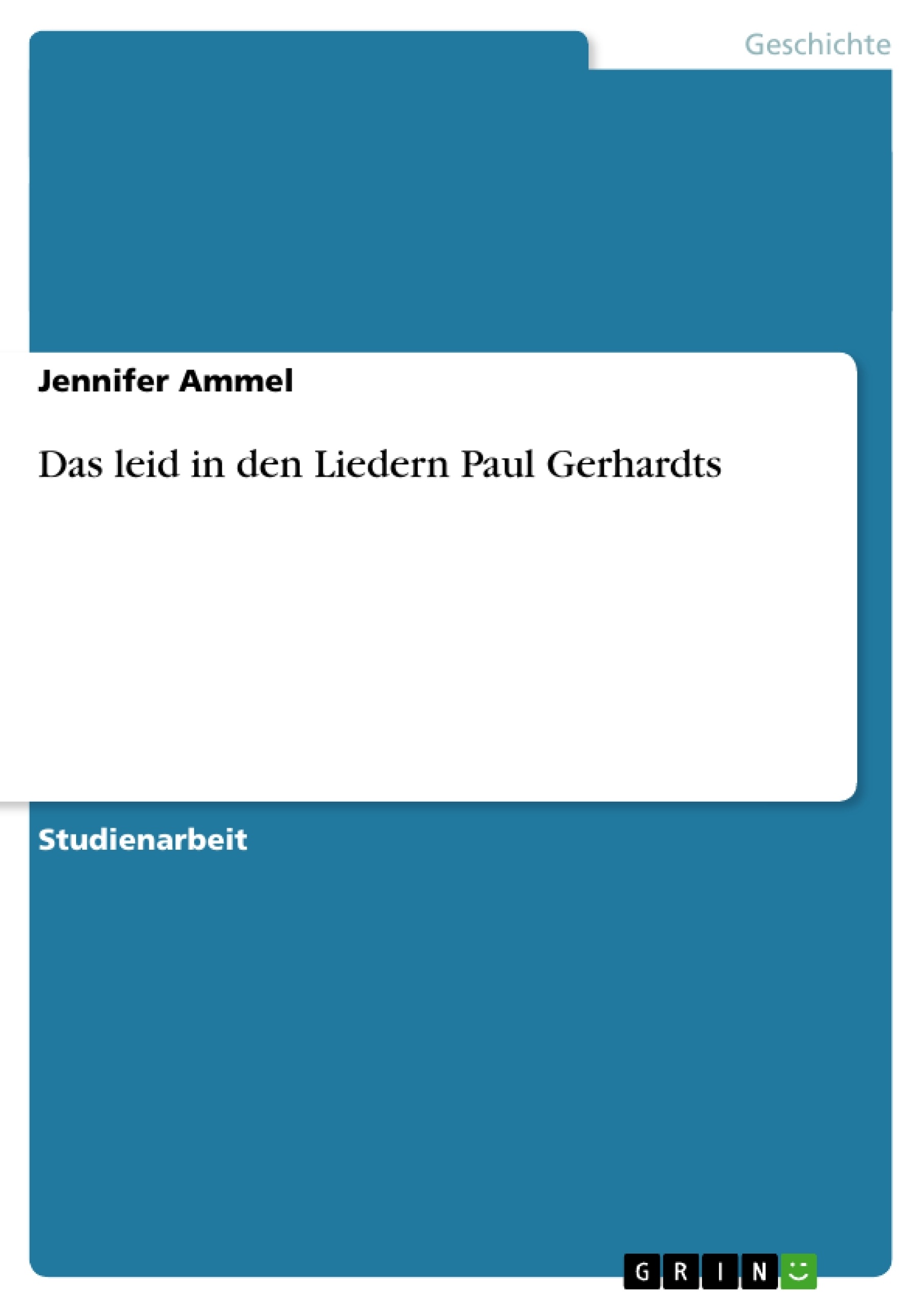Das Problem des Leids in den Liedern Paul Gerhardts (1607-1976) soll das Thema dieser Hausarbeit sein.
Paul Gerhardt stammte aus dem Mutterland der Reformation, dem Kurfürstentum Sachsen. Bereits in seiner Schulzeit in Grimma wurde er mit den theologischen Grundsätzen des Luthertums vertraut gemacht. Er studierte Theologie in Wittenberg und arbeitete später als Hauslehrer und schließlich als Geistlicher. Aus seinem Lebenslauf erklärt sich, dass Gerhardt tief geprägt war von der lutherischen Theologie. Sie war die Grundlage für sein geistiges Leben und somit auch für seine Lieder.
Gerhardts geistliche Dichtungen sollen näher untersucht werden, um so Rückschlüsse auf den Umgang mit Not und Leid zu ziehen, in einer Zeit, die vom Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) geprägt war. Wie wurden die Menschen mit ihrem Leid fertig? Wo fanden sie geistigen Halt? Was half ihnen ihren Glauben zu bewahren?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wird sich diese Arbeit mit der Analyse des Inhalts und dem theologischen Hintergrund von Gerhardts geistlichen Dichtungen beschäftigen.
Die Bandbreite seiner Lieder reicht von den Stationen des Lebens wie Geburt, Ehe, Krankheit und Tod, über Tages- und Jahreszeiten. Er schrieb Buß- und Dankeslieder ebenso wie Lieder, die sich nach den Ereignissen des Kirchenjahres richteten: Passions- und Osterlieder, Advents- und Weihnachtslieder etc. Der damaligen Mode entsprechend, wurde die Dichtkunst zu jedem denkbaren Anlass gepflegt.
Paul Gerhardts Lieder könnte man als „Gebrauchslyrik“ bezeichnen, denn sie begleiten den Christen auf seinem Lebensweg und sollen ihm helfen, ein gottgefälliges Leben zu führen, das heißt, sie haben die Aufgabe, dem Gläubigen beratend und ermahnend zur Seite zu stehen, um ihn auf den richtigen Weg zu führen. Dieser Weg soll natürlich zu Gott und zur Erlösung führen. Doch um nach dem Tod erlöst zu werden, muss der Christ Gottes Allmacht erkennen, sich zu seinen Sünden bekennen und Buße tun, denn im orthodoxen Luthertum geht es vor allem um die Rechtfertigung des Sünders und Gottes Gnadenspruch.
Gerhardt gelang es, einen neuen Typus von geistlichen Liedern zu schaffen, indem er die theologischen Grundsätze der lutherischen Theologie in seinen Dichtungen veranschaulichte. So überwand er das Defizit, das die reine Worttheologie, die sich stark am Intellekt orientierte, geschaffen hatte und ließ eine Sprache entstehen, die man singen und beten konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erkenntnis
- Die Ursache des Leids
- Geduld
- Paul Gerhardts Lieder als Lebenshilfe
- Erlösung
- Providenz und Eschaton
- Schuld und Tod
- Trost
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Problem des Leids in den Liedern Paul Gerhardts (1607-1676) und untersucht den Umgang mit Not und Leid in einer Zeit, die vom Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) geprägt war.
- Analyse des Inhalts und des theologischen Hintergrunds von Gerhardts geistlichen Dichtungen
- Die Rolle der lutherischen Theologie im Umgang mit Leid
- Die Bedeutung von Gottes Allmacht, Buße und der Rechtfertigung des Sünders
- Gerhardts Lieder als Quelle für die Lebenshilfe und den geistigen Halt in schweren Zeiten
- Der Einfluss von Hutters und Gerhards theologischen Schriften auf Gerhardts Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht den Prozess der Erkenntnis, der für ein "erfolgreiches", gottgefälliges Leben notwendig ist. Es betrachtet die Ursache des Leids, die Bedeutung von Geduld und die Rolle von Gerhardts Liedern als Lebenshilfe.
Schlüsselwörter
Paul Gerhardt, Barocke Dichtung, geistliche Lieder, Leid, Not, Elend, lutherische Theologie, Rechtfertigung, Gottes Allmacht, Buße, Providenz, Eschaton, Hutter, Gerhard, Dreißigjähriger Krieg, Lebenshilfe, Geistiger Halt.
- Quote paper
- Jennifer Ammel (Author), 2005, Das leid in den Liedern Paul Gerhardts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69169