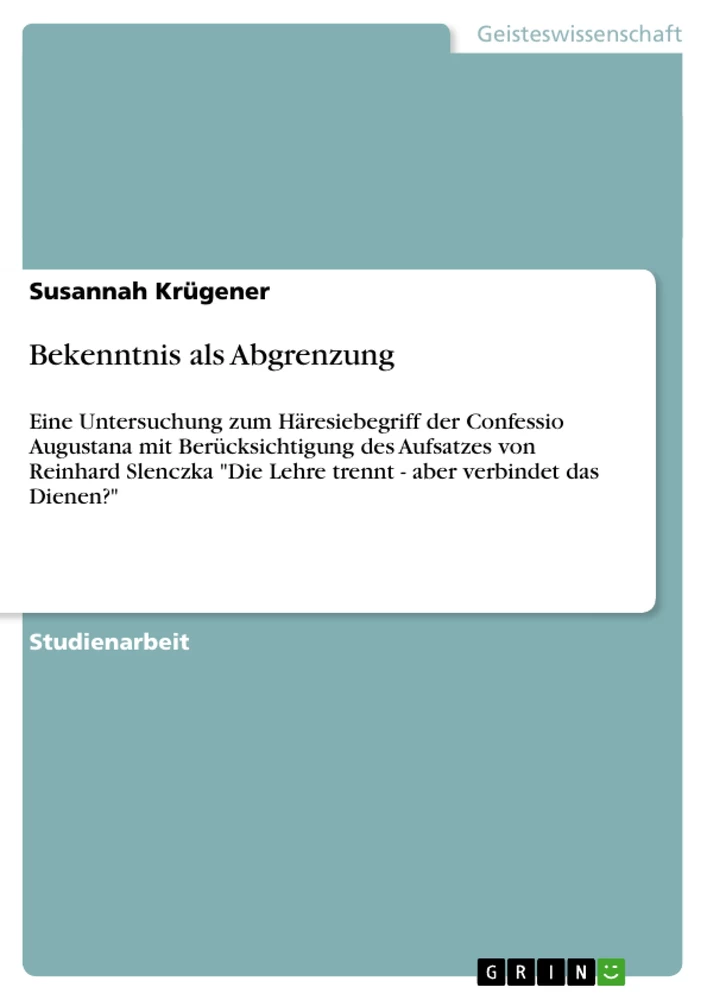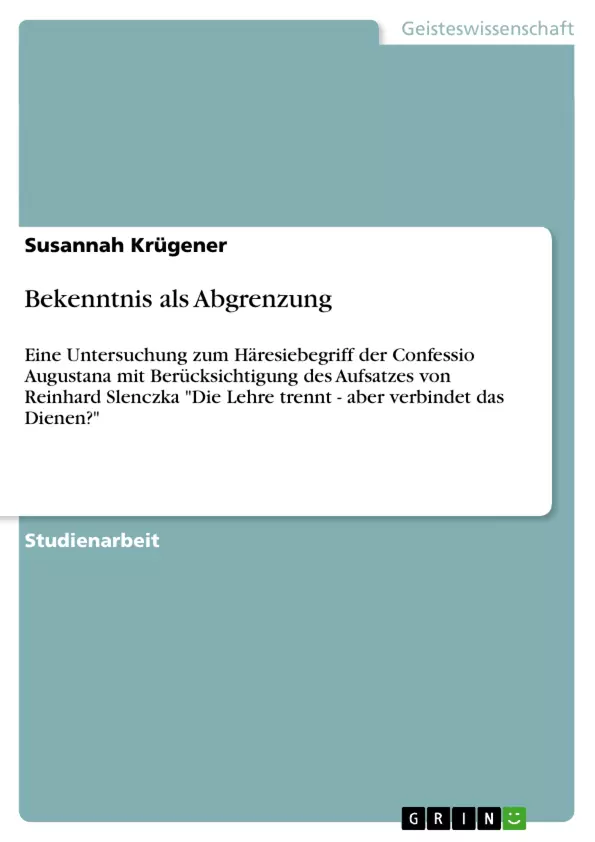In der Zeit der Glaubensspaltungen und konfessionellen Bürgerkriege wurde die Dissoziierung von Kirche und Staat eingeleitet. Dies und die gleichzeitig aufkommende Forderung eines Toleranzgebotes hatten zur Folge, daß nunmehr die Anwendung von weltlichen Strafen bei der Durchsetzung von Häresieurteilen wegfallen mußte.
Damit löste sich der alte Häresiebegriff auf, welcher dogmatische und moralische Verfehlung ineins gesetzt hatte. An die Stelle der Häresieprozesse trat die Lehrbeanstandung.
Mit besonderer Intensität stellt sich die Frage nach der kirchentrennenden Wirkung von Lehrgegensätzen auf dem Feld der Ökumene.
»Die Lehre trennt, aber das Dienen verbindet« – diese Formel, die im Zusammenhang mit der ersten Konferenz für Praktisches Christentum 1925 in Stockholm geprägt wurde, steht für den Versuch eines gemeinsamen, pragmatischen Ausgangspunktes. Die tieferliegenden theologischen Probleme in Bezug auf die Bedingungen kirchlicher Einheit werden durch sie allerdings nicht gelöst werden können.
Der weitere Verlauf der ökumenischen Debatte um die Überwindung von Gegensätzen in Bekenntnisschriften und Kirchenverfassungen machte eine Neuaufnahme der Häresie-Thematik notwendig, so geschehen 1952 bei der dritten Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung in Lund.
Dort bemühte man sich um eine Definition des Begriffes, der seither in der ökumenischen Diskussion beträchtliche Ausweitung erfuhr: Eine ökumenische Studie beschrieb in den sechziger Jahren strukturelle Häresie; 1968 stellte W.A.Visser’t Hooft in Uppsala vor der Vollversammlung des Ökumenischen Rates die Frage nach »ethischen« Häresien.
Die Klärung des Häresiebegriffes selbst ist dringlich geworden, denn dieser ist verknüpft mit den Orientierungsproblemen der Kirche – heute nicht weniger als gestern.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- EIN ÖKUMENISCHES SCHLAGWORT
- BEMERKUNGEN ZUM BEGRIFF DER HÄRESIE
- Dogmatische Häresie
- Ethische Häresie
- DAS AUGSBURGER BEKENNTNIS
- Der historische Kontext
- Zur Autorität von Bekenntnisschriften
- Die Möglichkeit einer römisch-katholischen Anerkennung der Confessio Augustana
- SCHLUSSFOLGERUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff der Häresie im Kontext der Confessio Augustana, insbesondere unter der Frage, ob evangelische Christen sich die Verwerfungsurteile dieser Bekenntnisschrift zu eigen machen müssen. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen dogmatischer und ethischer Häresie sowie auf der Relevanz des Häresiebegriffs im ökumenischen Kontext.
- Der Häresiebegriff in der Confessio Augustana
- Die Unterscheidung zwischen dogmatischer und ethischer Häresie
- Die Bedeutung des Häresiebegriffs für die ökumenische Bewegung
- Die Rolle von Bekenntnisschriften in der Kirche
- Das Spannungsfeld zwischen Lehre und Dienen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Häresiebegriffs im Kontext von Glaubensspaltungen und konfessionellen Bürgerkriegen. Es wird auf die Bedeutung des Häresiebegriffs im ökumenischen Kontext und die Frage nach der kirchentrennenden Wirkung von Lehrgegensätzen eingegangen.
- Ein ökumenisches Schlagwort: Dieses Kapitel analysiert die Formel "Die Lehre trennt, aber das Dienen verbindet" und beleuchtet die Spannungen zwischen Dogmatismus und Pragmatismus in der ökumenischen Bewegung.
- Bemerkungen zum Begriff der Häresie: Hier werden verschiedene Aspekte des Häresiebegriffs beleuchtet, darunter die Definition von Häresie und die Problematik der Anwendung des Begriffs in der Praxis. Die Unterscheidung zwischen dogmatischer und ethischer Häresie wird eingeführt.
- Das Augsburger Bekenntnis: Dieses Kapitel befasst sich mit dem historischen Kontext der Entstehung der Confessio Augustana, ihrer Autorität sowie der Frage nach einer möglichen Anerkennung durch die römisch-katholische Kirche.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Häresiebegriff, der Confessio Augustana, der ökumenischen Bewegung, Bekenntnisschriften, Dogma, Ethik, Lehre, Dienen, Konfession, und der Frage nach der Einheit der Kirche.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter dem Begriff der Häresie in der Confessio Augustana verstanden?
In der Confessio Augustana bezieht sich der Häresiebegriff auf dogmatische und moralische Verfehlungen, wobei die Arbeit untersucht, inwiefern evangelische Christen die damaligen Verwerfungsurteile heute noch teilen müssen.
Was ist der Unterschied zwischen dogmatischer und ethischer Häresie?
Die dogmatische Häresie bezieht sich auf Abweichungen von Glaubenslehren, während die ethische Häresie, ein später in der Ökumene aufgekommener Begriff, Verfehlungen im moralischen Handeln und sozialen Verhalten beschreibt.
Welche Rolle spielt die Formel „Die Lehre trennt, aber das Dienen verbindet“?
Diese Formel von 1925 steht für den Versuch eines pragmatischen Ausgangspunkts in der Ökumene, löst jedoch nicht die tieferliegenden theologischen Probleme der kirchlichen Einheit.
Warum wurde der Häresiebegriff 1952 in Lund neu diskutiert?
Die Weltkonferenz in Lund machte eine Neuaufnahme notwendig, um Gegensätze in Bekenntnisschriften und Kirchenverfassungen im modernen ökumenischen Kontext zu überwinden.
Was versteht man unter struktureller Häresie?
Strukturelle Häresie beschreibt Abweichungen, die sich in den institutionellen Strukturen der Kirche manifestieren, wie sie in ökumenischen Studien der sechziger Jahre definiert wurden.
- Quote paper
- Susannah Krügener (Author), 1997, Bekenntnis als Abgrenzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69180