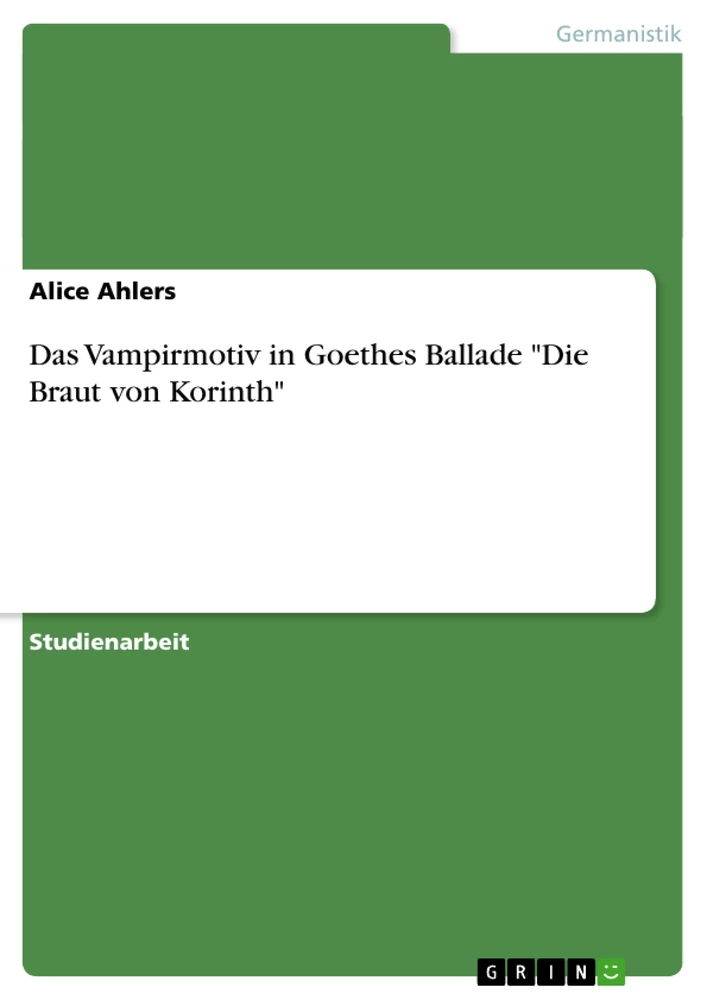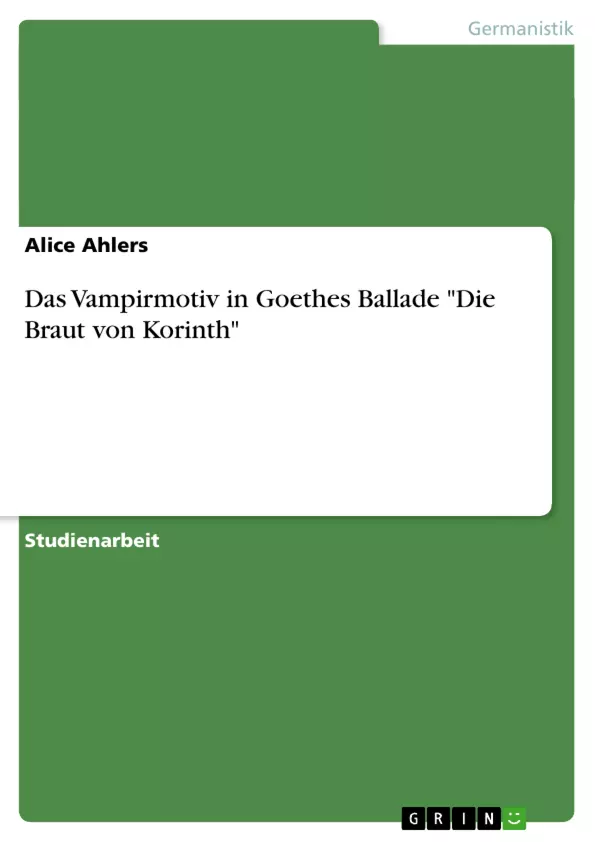Das Jahr 1816 gilt als Geburtsjahr des Vampirs in der englischen Literatur. Der Arzt John William Polidori, Mary Godwin und ihr späterer Ehemann Percy Shelley treffen sich in Lord Byrons Villa am Genfer See. Gemeinsam liest man deutsche Gespenstergeschichten. Byron schlägt schließlich den Anwesenden vor, jeder solle versuchen etwas Derartiges zu schreiben. Während die spätere Mary Shelley hierauf ihren „Frankenstein“ entwickelt, schreibt Polidori mit Anleihen aus einem Fragment von Byron die Novelle „Der Vampyr“ („The Vampyre“). Nach ihrer Veröffentlichung 1819 wird sie ein großer Erfolg und gilt seitdem als erste bedeutende literarische Verwertung des später so fruchtbaren Vampir-Motivs. Knapp zwanzig Jahre vor der Entstehung von „The Vampyre“ finden wir den Vampir bereits in Goethes Ballade „Die Braut von Korinth“ von 1797. Nur der weniger bekannte deutsche Lyriker Heinrich August Ossenfelder hatte den Stoff bereits 1748 in einem Gedicht poetisch verarbeitet. Dieses und Goethes Gedicht bleiben also lange die einzigen fiktionalen Texte, die den Stoff aufnahmen.1 Wenn es in der Forschung heißt, dass Polidoris Vampir-Novelle so eine rasche Verbreitung fand, weil damals „die Zeit erst für das Vampir-Motiv präpariert war“2, war Goethe seiner Zeit offenbar voraus. Auch wenn das Wort „Vampir“ in der Ballade selbst nicht vorkommt, spricht Goethe ihm in Tagebucheinträgen eine zentrale Rolle zu. Am 4. und 5. Juni 1797 notiert er Beginn und Abschluss der Produktion und bezeichnet die Ballade wiederholt als „Vampyrisches Gedicht“3. An Christiane schreibt er am 6. Juni er habe „eine große Gespensterromanze für den Almanach“ fertiggestellt. Mit der Gespensterballade knüpft Goethe an Bürgers populäre Ballade „Lenore“ aus dem Jahr 1773 an. Seitdem sind das Magische und Geisterhafte dem Gattungscharakter der Ballade zuzuschreiben. Goethe selbst hält dies für ein zentrales Merkmal der Gattung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Vampir im 18. Jahrhundert
- Die Verbreitung des slawischen Vampirglaubens in Europa
- Der Vampir in zeitgenössischen Publikationen
- Die antiken Quellen des Vampirs in „Die Braut von Korinth“
- Die antike Wiedergängerin Philinion
- Die antiken Lamien und Empusen
- Der Vampir in „Die Braut von Korinth“
- Die vampirische Perspektive
- Der Vampir zwischen heidnischer Antike und Christentum
- Der Motivkomplex des Blutes
- Der Vampir als anti-christliche Rächergestalt?
- Goethes,,Braut von Korinth“ als Vampir der Aufklärung
- „Die Braut von Korinth“ als Liebestragödie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Vampirmotiv in Goethes Ballade „Die Braut von Korinth“ und untersucht dessen Funktion im Kontext der zeitgenössischen Vorstellung vom Vampir sowie der antiken Quellen des Stoffes. Dabei werden die historischen Hintergründe des Vampirglaubens, die literarische Entwicklung des Motivs und die spezifische Ausprägung in Goethes Werk beleuchtet.
- Der Vampir im 18. Jahrhundert: Verbreitung des slawischen Aberglaubens und literarische Bearbeitung
- Antike Quellen des Vampirs in „Die Braut von Korinth“
- Das Vampirmotiv in Goethes Ballade: Funktionen und Interpretationen
- Der Vampir als Verbindung zwischen heidnischer Antike und Christentum
- Die Rolle des Vampirs in Goethes,,Braut von Korinth“ als Vampir der Aufklärung und Liebestragödie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung des Vampirmotivs in der Literatur, insbesondere im Hinblick auf Goethes „Die Braut von Korinth“. Kapitel 2 geht auf den Vampirglauben im 18. Jahrhundert ein und beleuchtet dessen Verbreitung und Bedeutung in der zeitgenössischen Gesellschaft. In Kapitel 3 werden die antiken Quellen des Vampirs in „Die Braut von Korinth“ analysiert und die spezifischen Merkmale des Vampirs in Goethes Werk herausgestellt. Kapitel 4 untersucht das Vampirmotiv in der Ballade, dessen Funktionen und Interpretationen im Hinblick auf die zeitgenössischen und antiken Quellen. Dieses Kapitel widmet sich auch der Frage, wie der Vampir in Goethes „Braut von Korinth“ als Verbindung zwischen heidnischer Antike und Christentum sowie als Vampir der Aufklärung und Liebestragödie interpretiert werden kann.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Themen Vampir, „Die Braut von Korinth“, Goethe, heidnische Antike, Christentum, Aufklärung, Liebestragödie. Zudem werden die historischen Hintergründe des Vampirglaubens, die Verbreitung des slawischen Aberglaubens und die literarische Entwicklung des Motivs im 18. Jahrhundert beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
War Goethe ein Vorreiter des Vampirmotivs?
Ja, mit „Die Braut von Korinth“ (1797) griff Goethe das Motiv fast zwanzig Jahre vor Polidoris berühmter Novelle „Der Vampyr“ auf.
Kommt das Wort „Vampir“ in der Ballade vor?
Nein, das Wort selbst wird nicht verwendet, aber Goethe bezeichnete das Werk in seinen Tagebüchern explizit als „vampyrisches Gedicht“.
Welche antiken Quellen nutzte Goethe?
Er bezog sich auf die Geschichte der Wiedergängerin Philinion sowie auf antike Wesen wie Lamien und Empusen.
Welchen Konflikt thematisiert die Ballade?
Die Ballade behandelt den Gegensatz zwischen der heidnischen Antike (Lebensfreude) und dem strengen Christentum (Entsagung).
Wie wird der Vampir in diesem Werk interpretiert?
Als eine tragische Liebesgestalt und zugleich als anti-christliche Rächerfigur, die durch das Motiv des Blutes eine Verbindung zum Sakralen herstellt.
- Quote paper
- Alice Ahlers (Author), 2004, Das Vampirmotiv in Goethes Ballade "Die Braut von Korinth", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69204