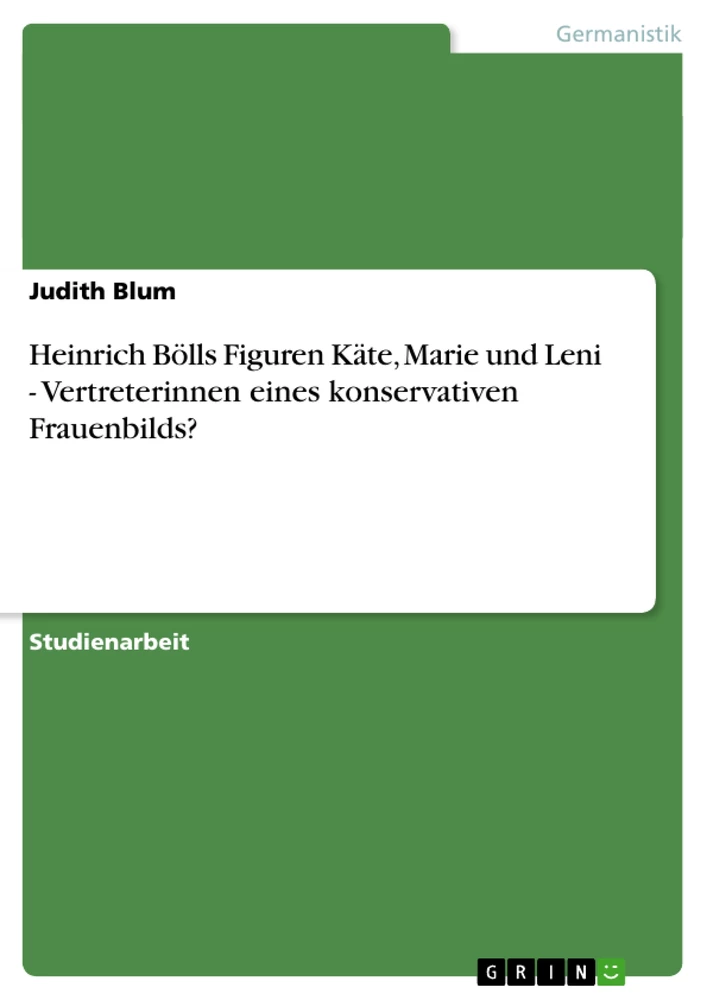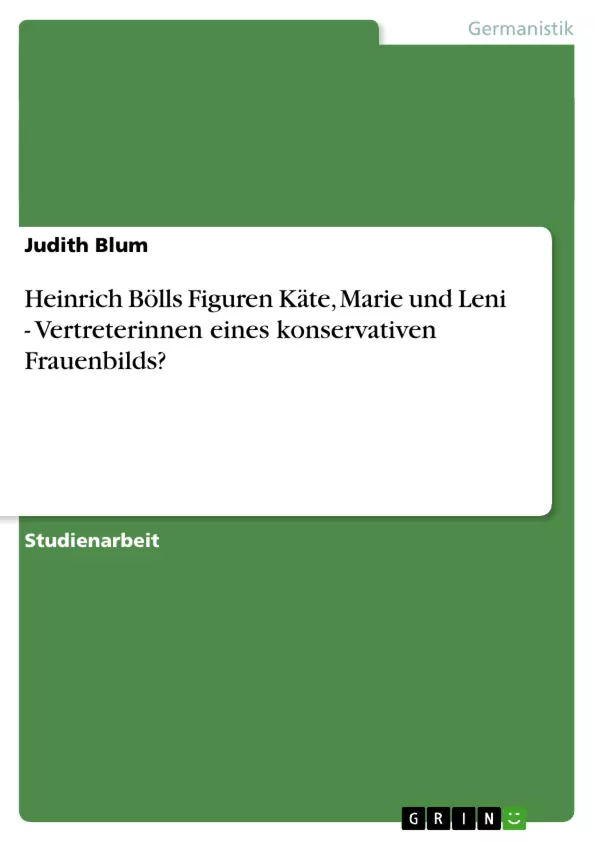Beschäftigt man sich mit feministischer Sekundärliteratur zu Frauenfiguren im Werk von Heinrich Böll, stößt man häufig auf negative Urteile, die seine Darstellung der Frauen als zu unemanzipiert und klischeehaft kritisieren. Diese Bewertungen differenzieren zumeist nicht zwischen den Frauen in den verschiedenen Texten, sondern beziehen sich pauschal auf die Gesamtheit der untersuchten Werke und nivellieren so Besonderheiten der einzelnen Figuren zugunsten einer allgemeinen Typisierung. So konstatiert Graßmann, dass Böll „trotz seiner Einordnung als gesellschaftskritischer Autor [...] in seinen Romanen ein konservatives Frauenbild [entwirft]“ , „die Frau ausschließlich als Gegenüber des Mannes [imaginiert]“ und sie als Heilige und Retterin des Mannes verklärt. Clasen resümiert: „Weil Bölls Heldinnen Trägerinnen von Eigenschaften sind, die in der patriarchalischen Gesellschaft [...] hoch im Kurs stehen, sind sie aus feministischem Gesichtspunkt nicht emanzipatorisch zu nennen.“ Sie sieht Bölls Protagonistinnen als „Projektionen männlicher Sehnsüchte und Behälter patriarchalischer Wunschvorstellungen.“
Gefragt wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit , ob Urteile dieser Art über Bölls Frauenfiguren angemessen sind. Grundlage für die Untersuchung bilden die Werke "Und sagte kein einziges Wort" (Kapitel I), "Ansichten eines Clowns" (Kapitel II) und "Gruppenbild mit Dame" (Kapitel III).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. „Und sagte kein einziges Wort“ – Käte Bogner
- I.1 Die doppelte Ich-Perspektive
- I.2 Aktive Frau, passiver Mann
- II. „Ansichten eines Clowns“ – Marie Derkum
- II. 1 „Die abwesende Heldin“
- II.2 Der Beginn der Liebesgeschichte
- II.3 Das gemeinsame Leben
- II.4 Die Trennung
- III. „Gruppenbild mit Dame“ – Leni Pfeiffer geb. Gruyten
- III.1 Der Verfasser
- III.2 Leni als Madonna und „verkanntes Genie der Sinnlichkeit“
- III.3 Leni und die Bildung
- III.4 Leni und die Liebe
- III.5 Leni und die Kunst
- III.6 Leni und die Politik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung von Frauenfiguren in drei ausgewählten Romanen Heinrich Bölls: „Und sagte kein einziges Wort“, „Ansichten eines Clowns“ und „Gruppenbild mit Dame“. Sie setzt sich kritisch mit der häufig geäußerten Behauptung auseinander, dass Bölls Frauenfiguren ein konservatives Frauenbild repräsentieren und stereotypen Vorstellungen von Weiblichkeit entsprechen. Die Arbeit untersucht, ob diese pauschalen Bewertungen gerechtfertigt sind und ob die einzelnen Figuren in den jeweiligen Texten differenzierter betrachtet werden müssen.
- Die Darstellung der Frauenfiguren in den Romanen von Heinrich Böll
- Analyse der traditionellen weiblichen Eigenschaften, die den Figuren zugeschrieben werden
- Bedeutung des Geschlechterverhältnisses und der Rollenverteilung in den Beziehungen
- Einbezug der Zeitgeschichte und der gesellschaftlichen Kontexte der 1950er und 1960er Jahre
- Bewertung der Frauenfiguren im Kontext der emanzipatorischen Debatten der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
I. „Und sagte kein einziges Wort“ – Käte Bogner
Das erste Kapitel befasst sich mit der Figur der Käte Bogner aus dem Roman „Und sagte kein einziges Wort“. Die Analyse konzentriert sich auf die doppelte Ich-Perspektive, die Böll in diesem Roman einsetzt, und wie sie die Isolation und fehlende Kommunikation zwischen Käte und ihrem Mann Fred reflektiert. Das Kapitel untersucht außerdem, inwiefern Käte traditionelle weibliche Eigenschaften verkörpert und welche Rolle die Kriegserfahrungen Freds auf die Beziehung der beiden haben.
II. „Ansichten eines Clowns“ – Marie Derkum
Das zweite Kapitel analysiert die Figur der Marie Derkum aus dem Roman „Ansichten eines Clowns“. Es untersucht die Rolle von Marie als „abwesende Heldin“ und beleuchtet die Entwicklung ihrer Beziehung zum Protagonisten Hans Schnier. Das Kapitel beleuchtet die Darstellung der Liebe, des gemeinsamen Lebens und der Trennung des Paares und untersucht, inwiefern Marie als emanzipierte Frau dargestellt wird.
III. „Gruppenbild mit Dame“ – Leni Pfeiffer geb. Gruyten
Das dritte Kapitel widmet sich der Figur der Leni Pfeiffer aus dem Roman „Gruppenbild mit Dame“. Es beleuchtet die Vielschichtigkeit der Figur, ihre Darstellung als „verkanntes Genie der Sinnlichkeit“, ihre Rolle in Bezug auf Bildung, Liebe, Kunst und Politik. Das Kapitel untersucht, inwiefern Leni ein „konservatives Frauenbild“ verkörpert und wie sie in den Kontext der Zeit und der Gesellschaftlichen Debatten der 1960er Jahre einzuordnen ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Frauenfiguren in den Werken Heinrich Bölls und beleuchtet dabei wichtige Aspekte wie traditionelle Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Kriegstraumata, Liebesbeziehungen, Emanzipation, gesellschaftliche Kontexte und die Rolle der Frau in den 1950er und 1960er Jahren. Die Analyse stützt sich auf die Romane „Und sagte kein einziges Wort“, „Ansichten eines Clowns“ und „Gruppenbild mit Dame“ und untersucht die Figuren Käte Bogner, Marie Derkum und Leni Pfeiffer.
Häufig gestellte Fragen
Entwerfen die Romane von Heinrich Böll ein konservatives Frauenbild?
Feministische Literatur kritisiert Bölls Figuren oft als unemanzipiert. Die Arbeit untersucht jedoch, ob diese pauschale Typisierung den individuellen Charakteren wie Käte, Marie und Leni gerecht wird.
Wer ist Käte Bogner in „Und sagte kein einziges Wort“?
Käte Bogner ist die Protagonistin, deren Leben durch die Isolation in der Ehe und die traumatischen Kriegserfahrungen ihres Mannes Fred geprägt ist.
Welche Rolle spielt Marie Derkum in „Ansichten eines Clowns“?
Marie wird als „abwesende Heldin“ beschrieben. Ihre Trennung von Hans Schnier und ihre Hinwendung zu katholischen Kreisen steht im Zentrum der Handlung.
Was macht Leni Pfeiffer in „Gruppenbild mit Dame“ besonders?
Leni wird als „verkanntes Genie der Sinnlichkeit“ und Madonna-Figur dargestellt, die sich durch ihre Menschlichkeit von der harten Gesellschaft der 1960er Jahre abhebt.
Wie beeinflusst der gesellschaftliche Kontext der 50er Jahre die Frauenfiguren?
Die Figuren agieren in einer patriarchalisch geprägten Nachkriegsgesellschaft, was ihre Handlungsspielräume und die Wahrnehmung ihrer Emanzipation stark prägt.
- Quote paper
- Judith Blum (Author), 2006, Heinrich Bölls Figuren Käte, Marie und Leni - Vertreterinnen eines konservativen Frauenbilds?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69223