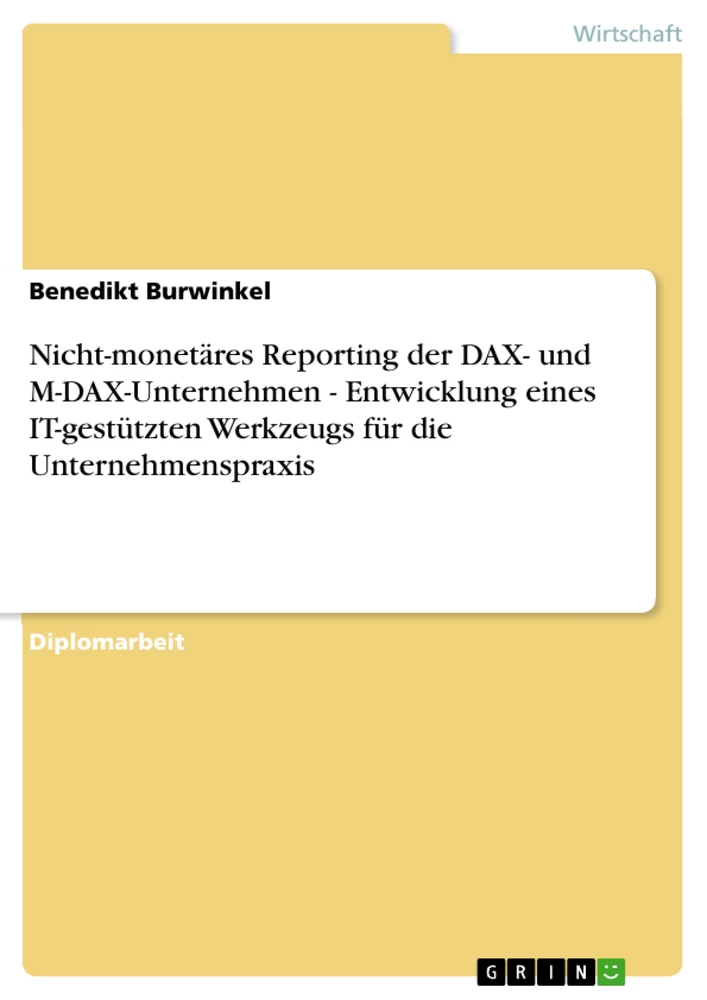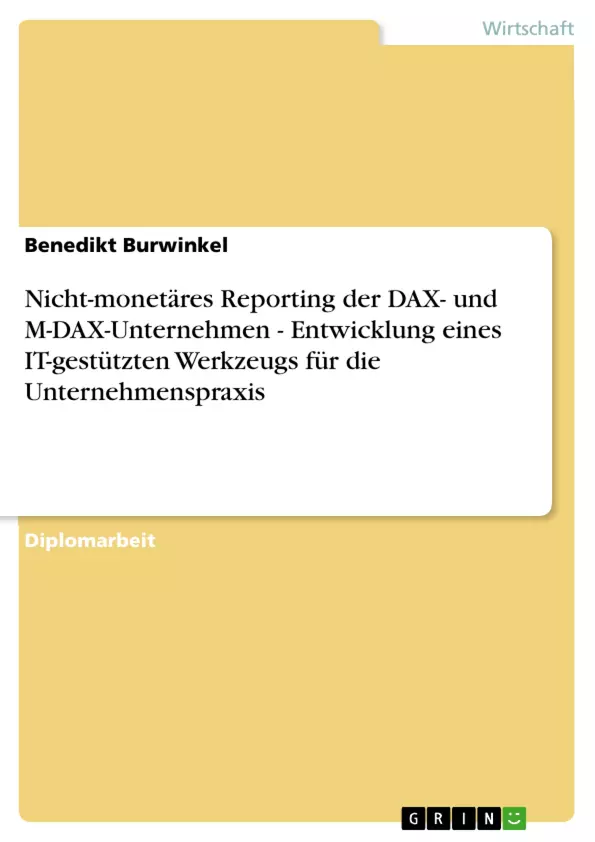Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und future e.V. veröffentlichte Anfang 2005 in der Zeitschrift Ökologisches Wirtschaften das aktuelle Ranking der Nachhaltigkeitsberichte deutscher Unternehmen unter der Überschrift „Vertrauen durch Transparenz“. Nachhaltigkeitsberichte stellen jedoch nur einen Bruchteil des Reportings dar, welches in seiner Gesamtheit für Transparenz und somit Vertrauen sorgen soll. Die zunehmend komplexer werdenden und global ablaufenden Unternehmensprozesse führen zu einer drastischen Intensivierung des (internationalen) Wettbewerbs. Die dadurch bedingte Unsicherheit der beteiligten Akteure lässt dem Reporting eine wachsende Bedeutung zukommen. Diese Entwicklung ist für Unternehmen Herausforderung und Chance zugleich.
Die Fachliteratur verweist zusätzlich sowohl auf das gestiegene Verlangen von Anteilseignern und Stakeholdern nach einer erhöhten Transparenz seitens der Unternehmen als auch auf die fehlende Bereitschaft, auf die sie betreffenden Informationen zu verzichten. Dieser Gesichtspunkt verdeutlicht auch den Bedeutungszuwachs des Reportings und die damit verbundenen Möglichkeiten.
Im Rahmen der Kommunikation des Unternehmens mit seinen Anteilseignern und den potentiellen Investoren dient das Reporting als wichtiges Kommunikationsmedium auf dem Kapitalmarkt. DiPiazza bezeichnet hierbei die Informationen als Existenzgrundlage und Lebenselixier der Kapitalmärkte. Im Hinblick auf den Trend, dass einerseits immer mehr Unternehmen zur Finanzierung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Expansion auf den Kapitalmarkt drängen und andererseits Stakeholder mehr Transparenz fordern, gewinnt ein aussagekräftiges Reporting als Schlüssel zum Kapitalmarkt an Bedeutung. Labhart unterstreicht dies mit dem Hinweis, „dass Investoren eine hochwertige Berichterstattung mit geringeren Risikoprämien belohnen“. Dies impliziert sinkende Kapitalkosten für die Unternehmen. Unternehmen profitieren aber auch im Hinblick auf ihre Kunden von einem verbesserten Reporting. Mit der Möglichkeit zur Einsicht in die unternehmensindividuellen Charakteristika und die stattfindende Wertschöpfungskette differenziert sich ein Unternehmen einerseits von der Konkurrenz und schafft andererseits durch diese Transparenz Vertrauen. Das Marketing und der Vertrieb können dies in einen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen ummünzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Transparenz schafft Vertrauen: das Reporting – eine unternehmerische Herausforderung und Chance.
- 1.1 Die wachsende Bedeutung des Reportings für Unternehmen..
- 1.2 Aufbau und Zielsetzung dieser Arbeit
- 2 Die verschiedenen Berichtsformen – das Fundament des Reportings.
- 2.1 Das Reporting im Überblick......
- 2.1.1 Informationsasymmetrien als theoretische Grundlage für das Reporting.
- 2.1.2 Der Zusammenhang von Unternehmenspublizität, Reporting und Berichten.....
- 2.2 Monetäre Berichte
- 2.2.1 Gesetzliche Vorschriften: die Basis monetärer Berichte.
- 2.2.2 Monetäre Berichte im Überblick
- 2.2.3 Darstellung ausgewählter monetärer Berichte...
- 2.2.3.1 Geschäftsberichte und Jahresberichte..
- 2.2.3.2 Zwischenberichte und Quartalsberichte..
- 2.3 Nicht-monetäre Berichte ….....
- 2.3.1 Normen und Richtlinien: die Basis nicht-monetärer Berichte.........
- 2.3.2 Nicht-monetäre Berichte im Überblick
- 2.3.3 Darstellung ausgewählter nicht-monetärer Berichte..
- 2.3.3.1 Umweltbericht
- 2.3.3.2 Umwelterklärung
- 2.3.3.3 Corporate Social Responsibility-Bericht..
- 2.3.3.4 Nachhaltigkeitsbericht...
- 3 Studie zu den nicht-monetären Berichten der DAX- und M-DAX-Unternehmen....
- 3.1 Methodik
- 3.1.1 Ausgewählte Kennzahlen der monetären Berichte als Grundlage der nicht-monetären Berichtsform-Wahl
- 3.1.2 Normen und Richtlinien als Orientierungshilfe für die Gestaltung der verschiedenen nicht-monetären Berichte
- 3.2 Ergebnisse.......
- 3.2.1 Ausgewählte Kennzahlen der monetären Berichte als Grundlage der nicht-monetären Berichtsform-Wahl.
- 3.2.1.1 Übersicht über die nicht-monetäre Berichterstattung im Marktsegment DAX und M-DAX...
- 3.2.1.2 Branchenzugehörigkeit………………………..\n
- 3.2.1.3 Unternehmensalter und „Börsenalter“ der Unternehmen ....
- 3.2.1.4 Mitarbeiterzahl...
- 3.2.1.5 Bilanzsumme...
- 3.2.1.6 Eigenkapital- und Fremdkapitalquote.......
- 3.2.1.7 Rating.....
- 3.2.1.8 Gesamtumsatz und europäischer Umsatzanteil..
- 3.2.1.9 Cash Flow aus Investitionstätigkeit ………….\n
- 3.2.1.10 Unverwässertes Ergebnis je Aktie...\n
- 3.2.1.11 Beta-Faktor
- 3.2.2 Normen und Richtlinien als Orientierungshilfe für die Gestaltung der verschiedenen nicht-monetären Berichte
- 3.2.2.1 Übersicht über die angewendeten Normen und Richtlinien im Marktsegment DAX und M-DAX.
- 3.2.2.2 Umweltbericht.....
- 3.2.2.3 Umwelterklärung
- 3.2.2.4 Corporate Social Responsibility-Bericht..
- 3.2.2.5 Nachhaltigkeitsbericht.
- 4 Entwicklung eines computerbasierten Instruments zur unternehmens-individuellen Auswahl und zum Aufbau eines nicht-monetären Berichts
- 4.1 Methodik
- 4.2 Darstellung des IT-gestützten Werkzeugs A.E.B……………………………………….\n
- 4.2.1 Die unternehmensindividuelle A.E.B.-Empfehlung zur Wahl einer angemessenen nicht-monetären Berichtsform
- 4.2.2 Der A.E.B. als Orientierungshilfe zur Erstellung einzelner nicht-monetärer Berichte
- 4.2.2.1 Umweltbericht...
- 4.2.2.2 Umwelterklärung
- 4.2.2.3 Corporate Social Responsibility-Bericht...
- 4.2.2.4 Nachhaltigkeitsbericht..\n
- 4.3 Kritische Aspekte des A.E.B...\n
- 5 Nicht-monetäres Reporting - eine wissenschaftliche und unternehmerische Chance und Herausforderung ....\n
- 5.1 Zusammenfassung der Theorie und der Ergebnisse der Studie.\n
- 5.2 Fazit: Nicht-monetäres Reporting - eine Chance zum Ergreifen
- Entwicklung eines IT-gestützten Werkzeugs für die Erstellung von nicht-monetären Berichten
- Analyse der Bedeutung nicht-monetärer Berichte für DAX- und M-DAX-Unternehmen
- Untersuchung der verschiedenen Arten von nicht-monetären Berichten
- Relevanz von Normen und Richtlinien für die Erstellung von nicht-monetären Berichten
- Verbindung von monetären und nicht-monetären Berichten im Kontext der Unternehmenskommunikation
- Kapitel 1: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung von Transparenz und Vertrauen im Kontext des Reportings und stellt die wachsende Bedeutung des Reportings für Unternehmen heraus. Es legt auch die Ziele und den Aufbau der Arbeit dar.
- Kapitel 2: Hier werden die verschiedenen Berichtsformen, insbesondere monetäre und nicht-monetäre Berichte, im Detail beschrieben. Die theoretische Grundlage des Reportings wird mit dem Konzept der Informationsasymmetrien erläutert. Darüber hinaus werden gesetzliche Vorschriften für monetäre Berichte und Normen und Richtlinien für nicht-monetäre Berichte beleuchtet.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Studie zu den nicht-monetären Berichten der DAX- und M-DAX-Unternehmen. Die Methodik der Studie wird beschrieben, wobei der Fokus auf ausgewählten Kennzahlen aus den monetären Berichten und relevanten Normen und Richtlinien liegt. Die Ergebnisse der Studie werden in Bezug auf die Berichtsformen, Branchenzugehörigkeit, Unternehmensgröße und andere relevante Faktoren dargestellt.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des computerbasierten Instruments A.E.B., das Unternehmen bei der Auswahl und Erstellung von nicht-monetären Berichten unterstützen soll. Die Methodik und die Funktionsweise des Instruments werden erläutert, und es werden konkrete Anwendungsbeispiele für die Erstellung von verschiedenen nicht-monetären Berichten präsentiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines IT-gestützten Werkzeugs zur Erstellung von nicht-monetären Berichten für Unternehmen, die im DAX und M-DAX gelistet sind. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Arten von nicht-monetären Berichten und analysiert deren Bedeutung für Unternehmen im Kontext der heutigen Informationslandschaft.Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Diese Diplomarbeit behandelt das Thema des nicht-monetären Reportings im Kontext von DAX- und M-DAX-Unternehmen. Es werden verschiedene Arten von Berichten untersucht, darunter Umweltberichte, Umwelterklärungen, Corporate Social Responsibility-Berichte und Nachhaltigkeitsberichte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung eines IT-gestützten Werkzeugs, das Unternehmen bei der Auswahl und Erstellung dieser Berichte unterstützt. Die zentralen Themen der Arbeit sind Transparenz, Vertrauen, Informationsasymmetrien, Normen und Richtlinien, sowie die Integration von monetären und nicht-monetären Berichten in die Unternehmenskommunikation.Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des IT-gestützten Werkzeugs A.E.B.?
Das Werkzeug A.E.B. dient der unternehmensindividuellen Auswahl und dem Aufbau nicht-monetärer Berichte wie Umwelt- oder Nachhaltigkeitsberichten.
Warum ist Transparenz im Reporting für Unternehmen so wichtig?
Transparenz schafft Vertrauen bei Investoren und Stakeholdern, was zu geringeren Risikoprämien und somit sinkenden Kapitalkosten führen kann.
Welche Arten von nicht-monetären Berichten werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht Umweltberichte, Umwelterklärungen, Corporate Social Responsibility (CSR)-Berichte und Nachhaltigkeitsberichte.
Welche Unternehmen wurden für die Studie herangezogen?
Die Studie analysiert das nicht-monetäre Reporting von Unternehmen, die in den deutschen Marktsegmenten DAX und M-DAX gelistet sind.
Welche theoretische Grundlage wird für das Reporting genutzt?
Die Arbeit nutzt das Konzept der Informationsasymmetrien als theoretische Basis, um die Notwendigkeit von Unternehmenspublizität zu erklären.
- Citar trabajo
- Benedikt Burwinkel (Autor), 2006, Nicht-monetäres Reporting der DAX- und M-DAX-Unternehmen - Entwicklung eines IT-gestützten Werkzeugs für die Unternehmenspraxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69311