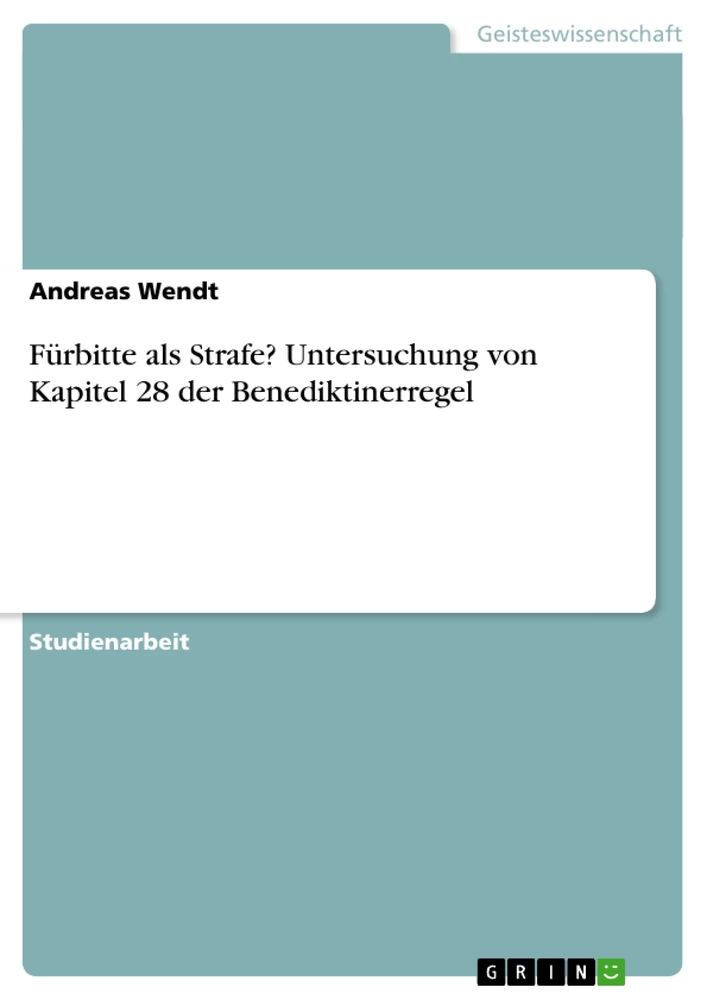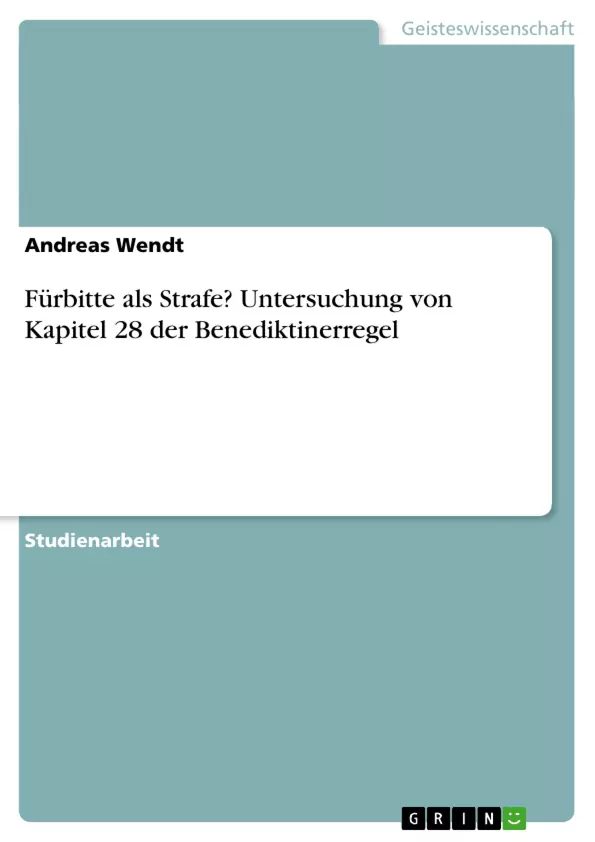In Kap. 28 der Regula Benedicti nehmen die Sanktionen für Mönche, die gegen die Klosterregel verstoßen haben, eine bisher kaum beachtete Wendung: Wenn alle Strafen nichts nützen, um den Mönch zur Besserung zu bewegen, soll für ihn gebetet werden, damit der allmächtige Gott die Besserung wirkt. Erst wenn das nichts nützt, soll der Mönch ausgeschlossen werden.
Die vorliegende Untersuchung fragt nach den kirchen- und theologiegeschichtlichen Hintergründen dieser Wendung. Das theologische Interesse liegt dabei auf den beiden Fragen, warum der zu Bessernde erst Züchtigungen über sich ergehen lassen muss, wenn Gebet doch besser wirkt, und warum es bei Gottes Allmacht nach Benedicts Ansicht offenbar dennoch möglich ist, dass das Gebet nichts nützt.
Die Arbeit kommt zu dem Zwischenergebnis, dass erst Klosterregeln im 6. Jahrhundert das Gebet im Zusammenhang mit Sanktionen erwähnen, die Verantwortung für die Besserung oder den Ausschluss in den älteren Regeln des 4. Jahrhunderts noch ganz beim Menschen liegt. Sie kommt zu dem Schlluss, dass die Problematik des Verhältnisses von göttlichem und menschlichem Handeln im 6. Jahrhundert bereits deutlicher bewusst war.
Dieses Thema wurde im 5. Jahrhundert im größeren Rahmen im pelagianischen Streit verhandelt. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Positionen dieses Streits und ihre Anwendung auf das Klosterleben erlauben es, die These zu wagen: Benedict hat wahrscheinlich unbewusst die augustinische Prädestinationslehre auf den Mikrokosmos des Klosters übertragen. Wichtiger als dogmatische Schlüssigkeit war ihm jedoch, bei einer praktikablen Ordnung des Klosterlebens gleichzeitig dem Verdacht des Pelagianismus zu entgehen. Das ist ihm mit Kap. 28. der Regula Benedicti gelungen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Text
- Paraphrase
- Fragen
- Die Quellen
- Biblische Quellen
- Ex. 32 und Amos 7
- Mt. 18,14 - 22
- weitere eventuell relevante Bibelstellen
- Auswertung
- Ältere Klosterregeln
- Die Regula Magistri
- Die Regula Pachomii
- Die "Regula Basilii"
- Ambrosius, de officiis
- Auswertung
- Die Geschichte
- Pelagius
- Augustin
- der "Semipelagianismus"
- die Synode von Orange 529
- Auswertung
- Würdigung
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Sekundärliteratur
- Hilfsmittel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von Kapitel XXVIII der Benediktinerregel und untersucht die Rolle der Fürbitte im Kontext der Strafe für Verstöße gegen die Regel. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der scheinbar paradoxen Stellung des Gebets im Vergleich zu anderen disziplinarischen Maßnahmen.
- Die Analyse der unterschiedlichen Handlungsweisen gegenüber einem Mönch, der gegen die Regel verstößt.
- Die Untersuchung der Rolle des Gebets im Kontext von Strafmaßnahmen.
- Die Klärung des Verhältnisses zwischen göttlichem und menschlichem Handeln in der Regel.
- Die Einordnung von Kapitel XXVIII in den Kontext der Regel und der theologischen Diskussionen um Pelagianismus und Semipelagianismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Paraphrase von Kapitel XXVIII der Benediktinerregel, die die unterschiedlichen Schritte zur Disziplinierung eines Regelbrechers beleuchtet. Dabei wird die Betonung auf die ultima ratio des Gebets und die anschließende Entscheidung des Abtes, den Mönch auszuschließen, gelegt. Im Anschluss daran werden verschiedene Fragestellungen hinsichtlich der Rolle des Gebets innerhalb dieses Disziplinierungsprozesses aufgeworfen.
Die Arbeit betrachtet dann die Quellen, die Benedikt für Kapitel XXVIII genutzt hat, und analysiert die Relevanz verschiedener biblischer Stellen sowie älterer Klosterregeln. Die Geschichte der theologischen Debatten um die Frage nach Gottes Gnade und dem menschlichen Willen wird beleuchtet, insbesondere im Zusammenhang mit den Ansichten von Pelagius und Augustinus sowie der Entwicklung des Semipelagianismus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Benediktinerregel, insbesondere mit Kapitel XXVIII, und analysiert die Rolle von Fürbitte und Strafe im Kontext von Regelverstößen. Weitere wichtige Themen sind Pelagianismus, Semipelagianismus, die Synode von Orange, die Bedeutung von Gebeten und die theologischen Aspekte des Verhältnisses von göttlichem und menschlichem Handeln. Die Arbeit untersucht die Quellen und die historische Einordnung des Kapitels innerhalb der Klosterregel.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Kapitel 28 der Benediktinerregel über die Bestrafung von Mönchen?
Wenn herkömmliche Strafen nicht zur Besserung führen, sieht die Regel vor, dass für den Mönch gebetet werden soll, bevor als letzte Konsequenz der Ausschluss erfolgt.
Warum wird Gebet in diesem Kontext als „Strafe“ oder Sanktion betrachtet?
Es ist eine spirituelle Intervention, die dann eingesetzt wird, wenn menschliche Züchtigungen versagen, um eine göttliche Wirkung zur Besserung zu erflehen.
Welchen theologischen Hintergrund hat diese Praxis?
Die Arbeit zieht Parallelen zur augustinischen Prädestinationslehre und dem pelagianischen Streit um das Verhältnis von göttlicher Gnade und menschlichem Willen.
Welche Quellen nutzte Benedikt für dieses Kapitel?
Neben biblischen Stellen (z.B. Mt 18) dienten ältere Klosterregeln wie die Regula Magistri oder Schriften von Ambrosius als Grundlage.
Was war Benedikts Ziel bei dieser Regelung?
Er wollte eine praktikable Ordnung des Klosterlebens schaffen und gleichzeitig theologisch dem Verdacht des Pelagianismus entgehen.
- Quote paper
- Andreas Wendt (Author), 1998, Fürbitte als Strafe? Untersuchung von Kapitel 28 der Benediktinerregel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69333