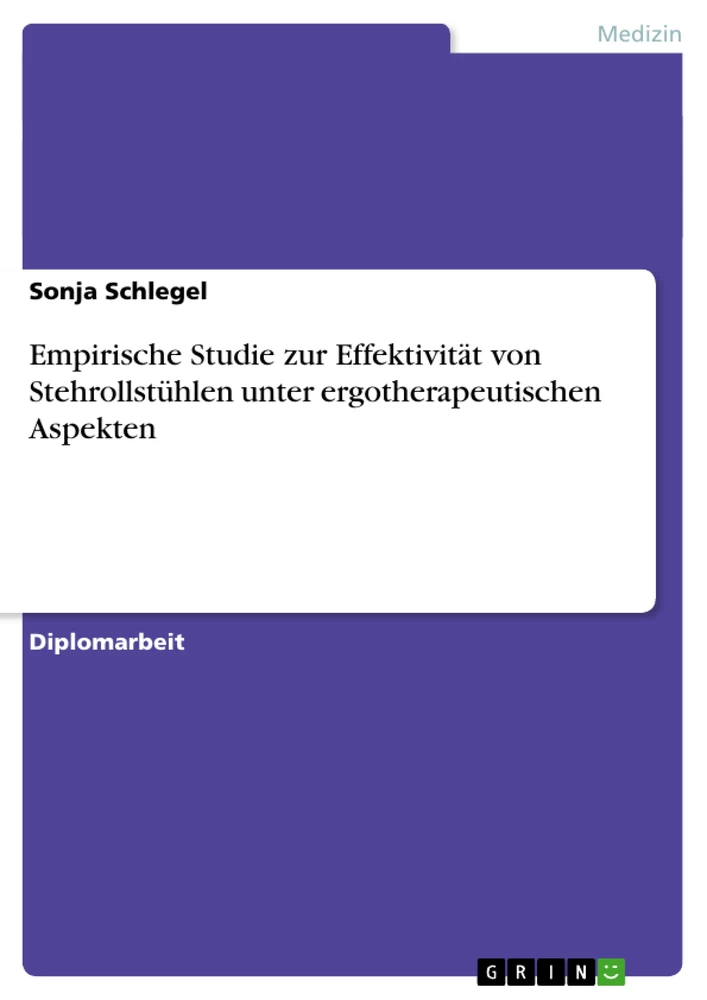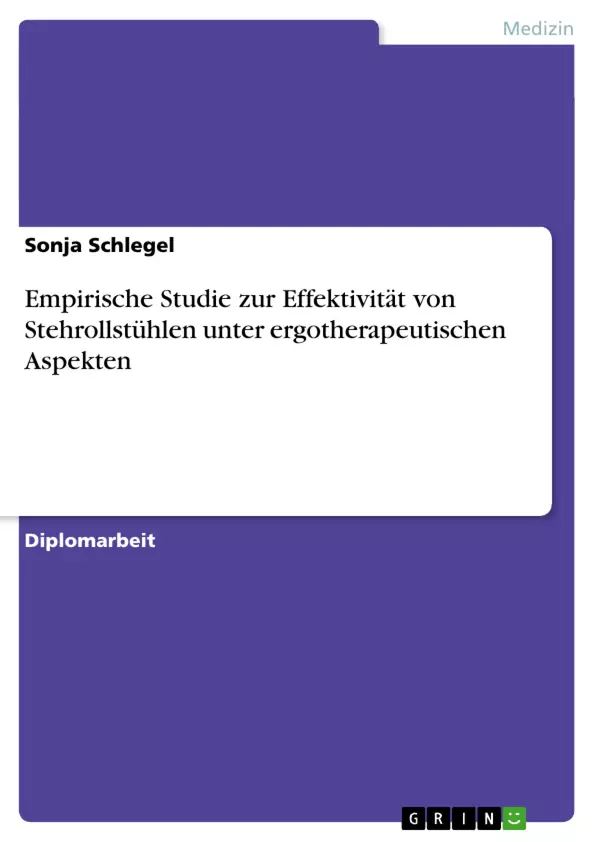Die Redewendung, dass „jemand im Rollstuhl sitzt“ ist heutzutage ein fester Bestandteil in unserem Sprachgebrauch geworden. Doch was steckt hinter diesen wenigen Worten? Nicht allein die Tatsache, dass eine Person in einem Stuhl sitzt, wird hiermit formuliert. Eine gewisse Hilflosigkeit wird den Betroffenen pauschal zugeschrieben. Wie sehr schränkt die Beeinträchtigung die behinderten Menschen in ihrem Leben, ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden tatsächlich ein?
Ein Rollstuhl ermöglicht ihnen eine passive oder auch aktive Fortbewegung im häuslichen Umfeld sowie im Außenbereich. Er stellt ein unverzichtbares Hilfsmittel bezüglich der Mobilität jedes Einzelnen dar. Jedoch sind die Einsatzmöglichkeiten eines Rollstuhles deutlich begrenzt. Wie häufig greifen beispielsweise stehfähige Menschen über sich, um Gegenstände auf höher gelegenen Regalen zu erreichen? Wie häufig stehen wir auf, weil uns die Sitzposition unbequem geworden ist?
Mediziner betonen schon seit vielen Jahren die Wichtigkeit des Stehens, insbesondere für behinderte Menschen, die viel Zeit im Sitzen und Liegen verbringen. Jedoch stellte das Therapeutische Stehen in der Vergangenheit für viele Klienten eine Tortur dar. Viele Stehständer hatten den entscheidenden Nachteil, dass sie zwar den medizinischen Grundgedanken, häufig jedoch nicht den sozialen und alltagspraktischen Belangen der Anwender gerecht wurden.
Dieser Problematik haben sich in den letzten Jahren Fachleute angenommen, um sogenannte Stehrollstühle zu entwickeln. Wie der Name verrät, sind dies Rollstühle, die durch eine spezielle Mechanik aus der Sitz- in die Standposition gebracht werden können. Da man die Stehrollstühle erst seit wenigen Jahren auf dem Markt der Hilfsmittel finden kann, sind der Einsatz und die Erfahrungswerte noch nicht sehr verbreitet. Aus diesem Grunde ist es Ziel dieser Arbeit, die Wirksamkeit und somit die Effektivität von Stehrollstühlen eingehender zu betrachten und zu analysieren.
Da der Fokus speziell auf den ergotherapeutischen Aspekten liegt, werden einerseits die medizinischen Wirkunsweisen des Stehens genau analysiert und andererseits der essentielle Bereich der Partizipation, Selbstständigkeit und der Selbstbestimmtheit der Klienten speziell betrachtet. Nur in Kombination dieser Komponenten ist eine fundierte Bewertung bezüglich der Effektivität von Stehrollstühlen hinsichtlich der ergotherapeutischen Gesichtspunkte erst möglich.
Inhaltsverzeichnis
- Glossar.
- Abkürzungsverzeichnis.
- 1. Problemstellung, Methodenwahl und Aufbau der Arbeit
- 2. Zur Bedeutung des Sitzens und Stehens bei Funktionseinschränkungen
- 2.1 Krankheitsbilder und deren Symptomatiken, bei denen Stehmedien eingesetzt werden.
- 2.2 Therapeutische Stehmedien der Vergangenheit.
- 2.3 Modellbeispiele der heutigen Stehrollstühle.
- 3. Bewältigungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Stehrollstühlen
- 3.1 Die inneren Organe
- 3.2 Der Bewegungsapparat
- 3.3 Die psycho-soziale Ebene und der Partizipationsaspekt.
- 4. Empirische Erfahrungen mit Stehrollstühlen
- 4.1 Methodisches Vorgehen.
- 4.2 Entwicklung eines Fragebogens.
- 5. Ergebnisse der Befragung.
- 5.1 Darstellung der Stichprobe.
- 5.2 Ergebnisse zur Beurteilung der Stehrollstühle.
- 5.3 Sonstige Angaben der Befragten
- 6. Diskussion der Ergebnisse.
- 7. Zusammenfassung und Ausblick.
- Abbildungsverzeichnis.
- Tabellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhang.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Effektivität von Stehrollstühlen der Firma LifeStand unter ergotherapeutischen Aspekten. Sie zielt darauf ab, die Auswirkungen des Stehens auf verschiedene Körperfunktionen und Lebensbereiche von Menschen mit Funktionseinschränkungen zu untersuchen. Die Arbeit untersucht die Funktionsweise von Stehrollstühlen und beleuchtet deren potenziellen Nutzen in der Rehabilitation.
- Bewertung der Effektivität von Stehrollstühlen bei der Verbesserung von körperlichen Funktionen
- Analyse der psycho-sozialen Auswirkungen des Stehens auf Menschen mit Funktionseinschränkungen
- Untersuchung des Einflusses von Stehrollstühlen auf die Partizipation im Alltag
- Entwicklung eines Fragebogens zur Erhebung der Erfahrungen mit Stehrollstühlen
- Analyse der Ergebnisse der Befragung von Nutzern von Stehrollstühlen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die Problemstellung, die Methodenwahl und den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas und der Fokus der Untersuchung dargestellt. Kapitel zwei beleuchtet die Bedeutung des Sitzens und Stehens bei Funktionseinschränkungen, wobei verschiedene Krankheitsbilder und deren Symptomatiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Stehmedien beleuchtet werden. Des Weiteren werden historische Entwicklungen von Stehmedien und aktuelle Modellbeispiele von Stehrollstühlen vorgestellt. In Kapitel drei werden die möglichen Bewältigungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Stehrollstühlen in Bezug auf die inneren Organe, den Bewegungsapparat und die psycho-soziale Ebene, sowie den Partizipationsaspekt, diskutiert. Kapitel vier beschäftigt sich mit der empirischen Erforschung des Themas. Es wird das methodische Vorgehen bei der Entwicklung eines Fragebogens erläutert. Die Ergebnisse der Befragung werden im fünften Kapitel vorgestellt, einschließlich einer Darstellung der Stichprobe und einer Analyse der Befragungsergebnisse. Die Diskussion der Ergebnisse und die Zusammenfassung der Arbeit mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze finden sich in Kapitel sechs und sieben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte der Arbeit sind: Stehrollstuhl, Stehmedien, Ergotherapie, Funktionseinschränkung, Rehabilitation, Partizipation, Lebensqualität, Befragung, empirische Forschung, Fragebogen, Körperfunktionen, psycho-soziale Ebene, Lebensbereiche.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Stehrollstühle und wie funktionieren sie?
Stehrollstühle sind Hilfsmittel, die durch eine spezielle Mechanik den Nutzer aus einer Sitzposition sicher in eine aufrechte Standposition bringen können.
Warum ist das Stehen für Rollstuhlfahrer medizinisch wichtig?
Es unterstützt die Funktion der inneren Organe, stärkt den Bewegungsapparat, beugt Druckstellen vor und verbessert die Durchblutung.
Welche ergotherapeutischen Vorteile bietet ein Stehrollstuhl?
Er fördert die Partizipation im Alltag, ermöglicht das Erreichen höher gelegener Gegenstände und verbessert die soziale Interaktion durch Kommunikation auf Augenhöhe.
Wie beeinflusst das Stehen die psycho-soziale Ebene der Nutzer?
Es steigert die Selbstständigkeit und das Wohlbefinden, da die Nutzer weniger auf fremde Hilfe angewiesen sind und aktiv an verschiedenen Lebensbereichen teilnehmen können.
Was wurde in der empirischen Studie dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert mittels eines Fragebogens die Effektivität und Nutzererfahrungen mit Stehrollstühlen der Firma LifeStand unter Berücksichtigung medizinischer und sozialer Aspekte.
- Quote paper
- Sonja Schlegel (Author), 2006, Empirische Studie zur Effektivität von Stehrollstühlen unter ergotherapeutischen Aspekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69376