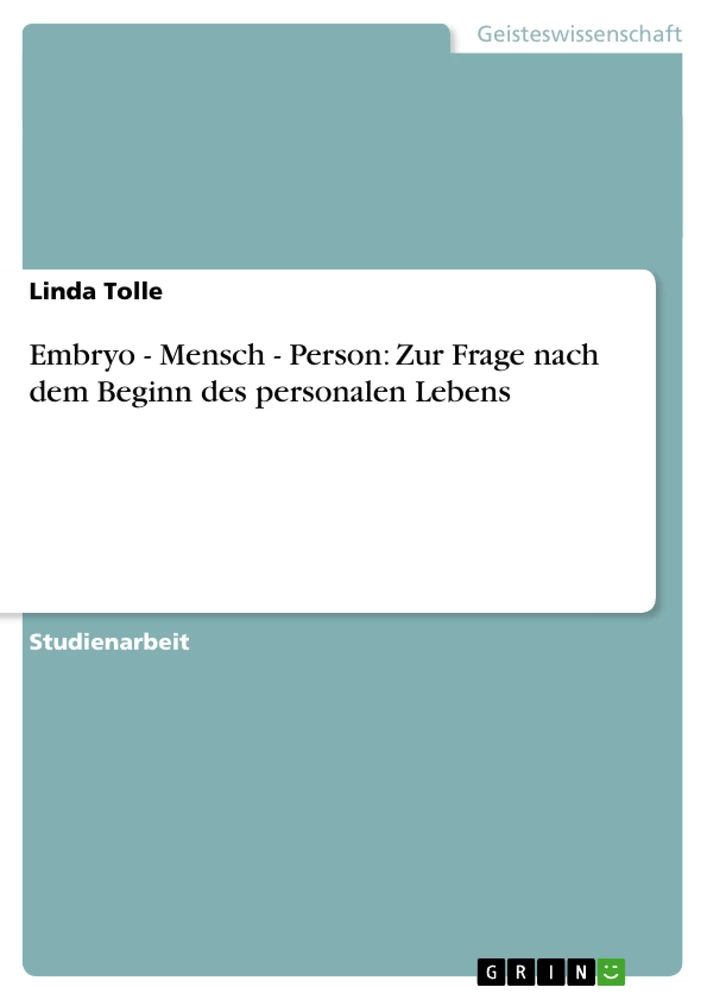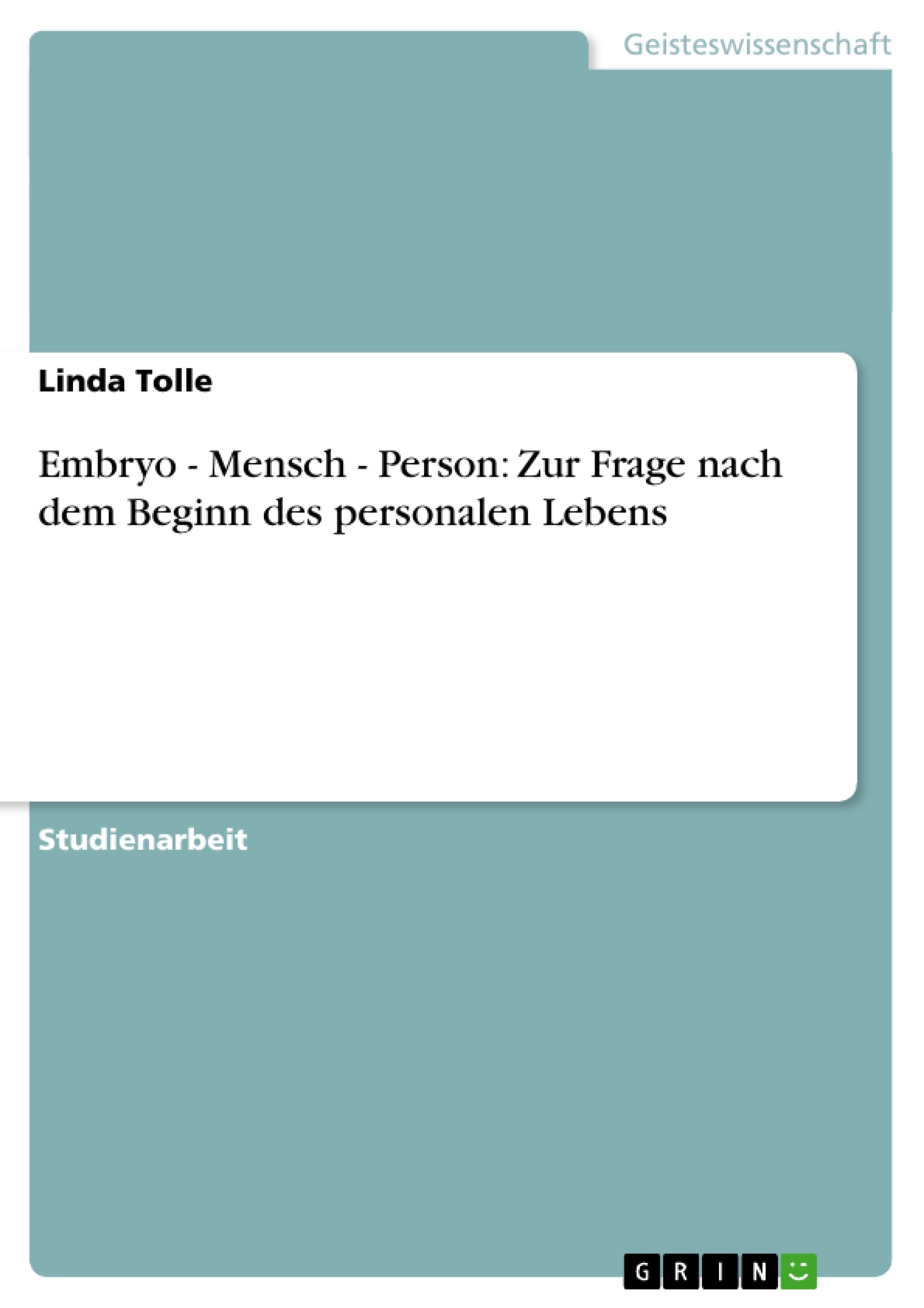1 Einleitung
Schlagworte wie „Embryonenforschung“, „Abtreibung“ oder „Verhütung“ finden fast täglich Gebrauch in unserer Sprache oder einem Zeitungsartikel und stellen schon seit langem einen gesellschaftlichen Streitpunkt dar. Denn die Meinungen über eben diese Themen, sei es aus theologischer, medizinischer oder philosophischer Sicht, gehen auseinander.
Doch all diesen Streitthemen liegt eine Frage zu Grunde: Wann beginnt das menschliche Leben? Diese Frage versucht Günter Rager in seinem Aufsatz „Embryo - Mensch - Person: Zur Frage nach dem Beginn des personalen Lebens“ zu klären.
2 „Zur Frage nach dem Beginn des personalen
Lebens“
Im Folgenden möchte Rager´s seine Argumentationsweise vorstellen und seine Argumente und Thesen mit denen anderer Autoren vergleichen und diskutieren. Hierzu verwende ich nicht dieselbe Gliederungsstruktur wie Rager selbst, sondern gehe in der Entwicklung des Embryos chronologisch vom Tag der Zeugung bis zu seiner Geburt vor.
Rager geht von der These aus, der Embryo stelle ab dem Zeitpunkt seiner Zeugung, der Verschmelzung des Spermiums mit der Eizelle, personales Leben dar. Um dieses zu belegen, versucht er die Gegenargumente zu widerlegen. Die Antithesen ziehen allesamt eine Grenze, ab wann der Embryo personales Leben darstellt. Diese Grenzen möchte Rager aufheben und so von seiner These zu überzeugen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 „Zur Frage nach dem Beginn des personalen Lebens“
- 2.1 8-Zell-Stadium
- 2.2 16. Embryonaltag
- 2.3 Geburt
- 2.4 Die Entwicklung im allgemeinen Überblick
- 3 Zusammenfassung und kritische Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Günter Rager untersucht die Frage nach dem Beginn des personalen Lebens. Er analysiert verschiedene Argumente, die den Beginn des personalen Lebens an unterschiedliche Entwicklungsstufen des Embryos ansetzen, und versucht, diese zu widerlegen. Ziel ist es, die These zu verteidigen, dass der Embryo von der Zeugung an als personales Leben betrachtet werden sollte.
- Beginn des personalen Lebens
- Entwicklung des Embryos
- Totipotenz der Zellen
- Reifung des Nervensystems
- Individuelle Einheit des Embryos
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die gesellschaftliche Debatte um Embryonenforschung, Abtreibung und Verhütung ein und benennt die zentrale Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens. Sie stellt den Aufsatz von Günter Rager vor, der sich dieser Frage widmet. Der Text kündigt eine chronologische Betrachtung der Embryonalentwicklung vom Zeitpunkt der Zeugung bis zur Geburt an, wobei Ragers Argumentation im Vergleich mit anderen Autoren diskutiert werden soll.
2 „Zur Frage nach dem Beginn des personalen Lebens“: Dieses Kapitel präsentiert Ragers Argumentation, dass der Embryo bereits ab der Zeugung personales Leben darstellt. Rager konfrontiert und widerlegt Gegenargumente, die den Beginn des personalen Lebens an späterere Entwicklungsstufen setzen. Die Analyse konzentriert sich auf die verschiedenen Thesen und deren Auseinandersetzung. Es wird deutlich, dass ein zentrales Argument die Widerlegung von Thesen ist, die eine Grenze für den Beginn des personalen Lebens setzen.
2.1 8-Zell-Stadium: Dieser Abschnitt beleuchtet das 8-Zell-Stadium des Embryos, in welchem die Zellen totipotent sind. Rager diskutiert die daraus resultierenden Begriffsschwierigkeiten, insbesondere die Möglichkeit der Entstehung von Zwillingen, und wie diese scheinbar der Auffassung „Person von Anfang an“ widerspricht. Er argumentiert, dass der Embryo bereits ab der ersten Zellteilung durch Steuerungs- und Regelungsmechanismen gesteuert wird und eine individuelle Einheit, einen dynamischen Prozess des Subsistierens darstellt. Diese Individualität wird mit der Befruchtung begründet und durch die Argumentation von Blechschmidt und Spaemann gestützt.
2.2 16. Embryonaltag: Dieses Unterkapitel erörtert die Entwicklung des Nervensystems und die damit verbundene Frage nach dem Beginn des Hirnlebens und der damit verbundenen Vernunftfähigkeit, als wichtiges Kriterium für Personsein. Rager argumentiert, dass die Reifung des Nervensystems nicht ausschlaggebend für den Beginn des Personseins ist. Die ungleichmäßige und zeitlich versetzte Entwicklung des Nervensystems an verschiedenen Stellen des Embryos unterstreicht diese These. Die These des „Personseins von Anfang an“ bleibt zentral.
Schlüsselwörter
Embryo, Mensch, Person, personales Leben, Zeugung, 8-Zell-Stadium, 16. Embryonaltag, Totipotenz, Nervensystem, Hirnleben, Individualität, Rager, Blechschmidt, Spaemann.
Häufig gestellte Fragen zu Ragers Aufsatz "Zur Frage nach dem Beginn des personalen Lebens"
Was ist der Hauptgegenstand von Ragers Aufsatz?
Ragers Aufsatz untersucht die Frage nach dem Beginn des personalen Lebens. Er analysiert verschiedene Argumente, die den Beginn des personalen Lebens an unterschiedliche Entwicklungsstufen des Embryos ansetzen, und versucht, diese zu widerlegen. Die zentrale These ist, dass der Embryo von der Zeugung an als personales Leben betrachtet werden sollte.
Welche Entwicklungsstufen des Embryos werden im Aufsatz besonders betrachtet?
Der Aufsatz betrachtet insbesondere das 8-Zell-Stadium und den 16. Embryonaltag. Diese Stadien werden im Hinblick auf die Totipotenz der Zellen und die Entwicklung des Nervensystems analysiert, um die These des "personalen Lebens von Anfang an" zu stützen.
Welche Argumente werden im Aufsatz widerlegt?
Rager widerlegt Argumente, die den Beginn des personalen Lebens an spätere Entwicklungsstufen des Embryos knüpfen, z.B. an die Entwicklung des Nervensystems oder das Erreichen einer bestimmten Stufe der Vernunftfähigkeit. Er argumentiert gegen die These, dass erst mit der Ausbildung bestimmter Merkmale (wie z.B. Hirnleben) der Embryo als Person gelten kann.
Welche Rolle spielt die Totipotenz der Zellen im 8-Zell-Stadium?
Die Totipotenz der Zellen im 8-Zell-Stadium, die die Möglichkeit der Entstehung von Zwillingen impliziert, wird als scheinbarer Widerspruch zur These des "Personseins von Anfang an" diskutiert. Rager argumentiert jedoch, dass die Individualität des Embryos bereits mit der Befruchtung beginnt und durch Steuerungs- und Regelungsmechanismen aufrechterhalten wird, ungeachtet der Totipotenz.
Welche Bedeutung hat die Entwicklung des Nervensystems im 16. Embryonaltag?
Die Entwicklung des Nervensystems am 16. Embryonaltag wird im Kontext des Beginns des Hirnlebens und der damit verbundenen Vernunftfähigkeit diskutiert. Rager argumentiert, dass die ungleichmäßige und zeitlich versetzte Entwicklung des Nervensystems gegen die These spricht, dass die Reifung des Nervensystems ausschlaggebend für den Beginn des Personseins ist.
Welche Autoren werden in Ragers Argumentation erwähnt?
Die Argumentation von Rager wird durch die von Blechschmidt und Spaemann gestützt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Aufsatz?
Schlüsselwörter sind: Embryo, Mensch, Person, personales Leben, Zeugung, 8-Zell-Stadium, 16. Embryonaltag, Totipotenz, Nervensystem, Hirnleben, Individualität, Rager, Blechschmidt, Spaemann.
Wie ist der Aufsatz strukturiert?
Der Aufsatz umfasst eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Zur Frage nach dem Beginn des personalen Lebens") mit Unterkapiteln zum 8-Zell-Stadium und dem 16. Embryonaltag, sowie eine Zusammenfassung und Schlussbemerkungen.
- Quote paper
- Linda Tolle (Author), 2007, Embryo - Mensch - Person: Zur Frage nach dem Beginn des personalen Lebens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69485