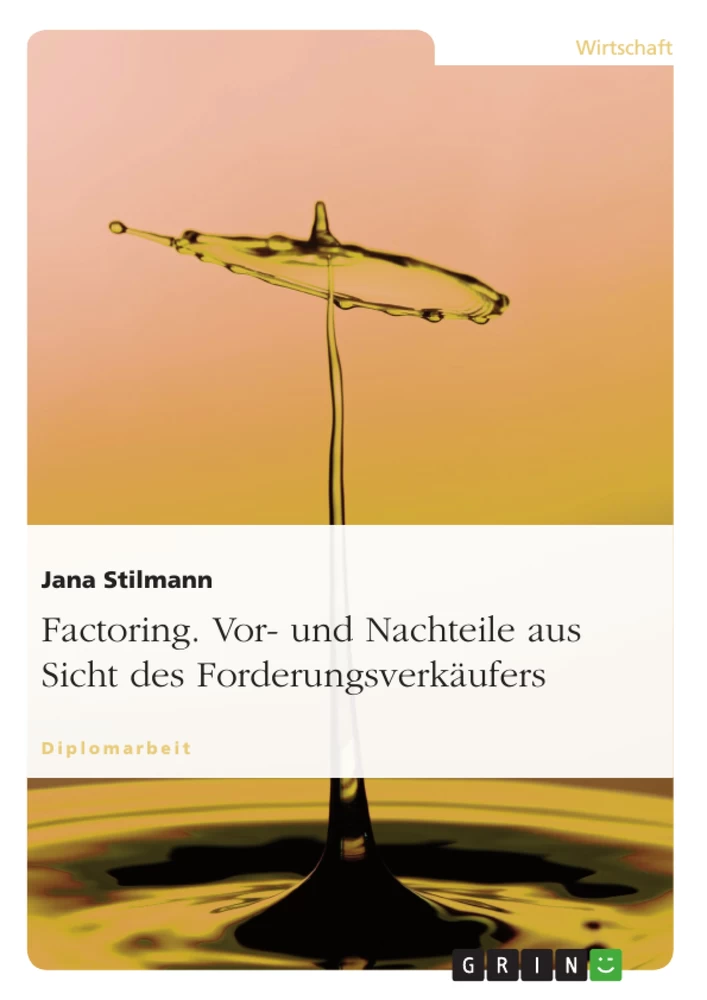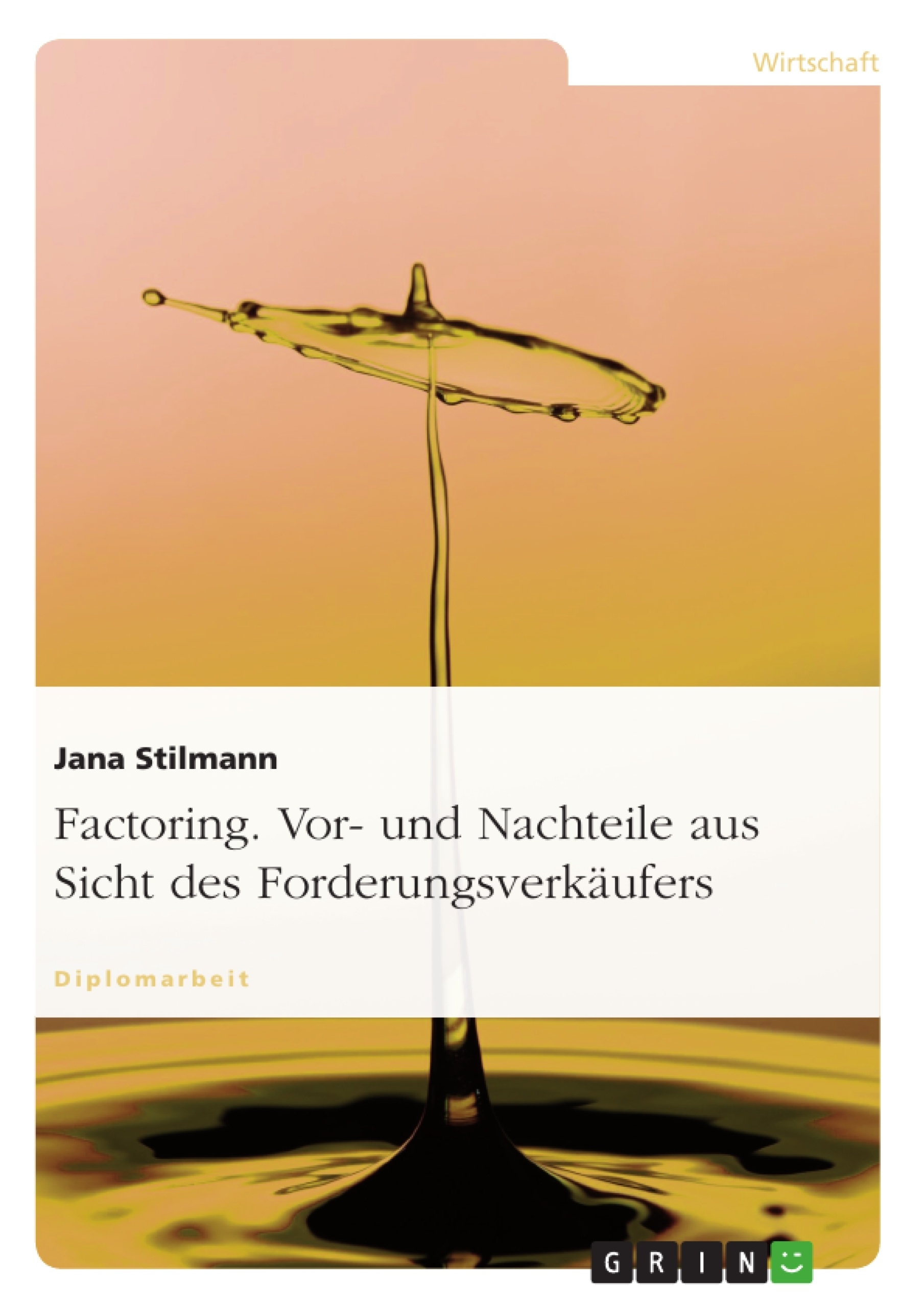Seit einigen Jahren befindet sich die Unternehmensfinanzierung in Deutschland in einem umfassenden Veränderungsprozess. Der Mittelstand ist davon am meisten betroffen. Daher suchen immer mehr Unternehmen nach alternativen, nicht bankenorientierten Finanzierungsformen wie Factoring. Anhand empirischen Untersuchungen zeigt diese Arbeit, welche praxisrelevante Bedeutung die Vor- und Nachteile des Factorings für die Factoringkunden haben.
Um diesem Ziel gerecht zu werden, werden zuerst der typische Factoring-Kunde (der Mittelstand) und seine wesentlichen Merkmale beschrieben.
Der Abschnitt 2.2. rückt die finanzielle Situation des Mittelstandes in den Mittelpunkt, wobei auf die Finanzierungsprobleme des Mittelstandes und deren Ursachen eingegangen wird.
In Kapitel 3 der Arbeit werden das Wesen und die allgemeinen Funktionsprinzipien des Factorings erläutert, um dem Leser das theoretische Grundwissen über Factoring zu vermitteln.
Desweiteren werden in Abschnitt 4 die betriebswirtschaftlichen Effekte des Factorings hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile für den Forderungsverkäufer im Einzelnen betrachtet. Zu diesem Zweck werden die theoretischen Ansätze zur Vorteilhaftigkeit und den Nachteilen des Factorings mit den Ergebnissen aus empirischen Untersuchungen zum Thema "Factoring", an denen mehrere Factoring-Anwender teilgenommen haben, verglichen. Die dabei festgestellten Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis werden hinsichtlich ihrer Ursachen analysiert. Der Abschnitt 5 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung und Ziel der Arbeit
- 2. Mittelstand als der typische Factoring-Anwender
- 2.1. Bedeutung des Mittelstandes
- 2.2. Probleme der Finanzierung im Mittelstand
- 3. Factoring als Lösungsmöglichkeit der Finanzierungsproblematik
- 3.1 Definition von Factoring
- 3.2. Ablauf eines Factoring-Geschäftes
- 3.3. Eignungsvoraussetzungen für Factoring
- 3.4. Funktionen des Factorings
- 3.4.1. Die Finanzierungsfunktion
- 3.4.2. Die Delkrederefunktion
- 3.4.3. Die Dienstleistungsfunktion
- 4. Betriebswirtschaftliche Effekte des Factorings und ihre Bedeutung für den Forderungsverkäufer
- 4.1. Vorbemerkung zu der empirischen Untersuchung
- 4.2. Die Finanzierungsfunktion
- 4.2.1. Vorteile für den Factor-Kunden
- 4.2.2. Nachteile für den Factor-Kunden
- 4.3. Die Delkrederefunktion
- 4.3.1. Vorteile für den Factor-Kunden
- 4.3.2. Nachteile für den Factor-Kunden
- 4.4. Die Dienstleistungsfunktion
- 4.4.1. Vorteile für den Factor-Kunden
- 4.4.2. Nachteile für den Factor-Kunden
- 4.5. Auswirkungen des Factorings auf die Eigenkapitalquote und die Rentabilität des Factor-Kunden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Vor- und Nachteile des Factorings aus der Perspektive des Forderungsverkäufers. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Factoring auf Unternehmen zu zeichnen und die Relevanz dieser Finanzierungsform im Kontext des Mittelstandes zu beleuchten.
- Bedeutung und Herausforderungen der Finanzierung im Mittelstand
- Definition und Funktionsweise von Factoring
- Betriebswirtschaftliche Effekte des Factorings (Finanzierung, Delkredere, Dienstleistung)
- Vorteile und Nachteile von Factoring für den Forderungsverkäufer
- Auswirkungen auf Eigenkapitalquote und Rentabilität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung und Ziel der Arbeit: Diese Einleitung definiert die Forschungsfrage und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die Relevanz des Themas Factoring im Kontext der Finanzierung kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU).
2. Mittelstand als der typische Factoring-Anwender: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Mittelstandes für die deutsche Wirtschaft und analysiert die spezifischen Finanzierungsprobleme, die für KMU charakteristisch sind. Es wird dargelegt, warum Factoring eine potentiell geeignete Lösung für diese Probleme darstellt.
3. Factoring als Lösungsmöglichkeit der Finanzierungsproblematik: Hier wird Factoring definiert und seine Funktionsweise detailliert beschrieben. Der Ablauf eines Factoring-Geschäfts wird erläutert, einschließlich der Eignungsvoraussetzungen und der drei Kernfunktionen: Finanzierung, Delkredere und Dienstleistung. Diese Funktionen bilden die Basis für die weitere Analyse der betriebswirtschaftlichen Effekte.
4. Betriebswirtschaftliche Effekte des Factorings und ihre Bedeutung für den Forderungsverkäufer: Dieser zentrale Teil der Arbeit untersucht die Auswirkungen des Factorings auf die Finanzsituation des Forderungsverkäufers. Die drei Funktionen des Factorings werden einzeln betrachtet: Die Finanzierungsfunktion (verbesserte Liquidität, geringere Kapitalbindung), die Delkrederefunktion (Ausfallrisiko-Minimierung) und die Dienstleistungsfunktion (Entlastung des Debitorenmanagements). Für jede Funktion werden die Vor- und Nachteile detailliert analysiert, unterstützt durch empirische Daten und Fallbeispiele.
Schlüsselwörter
Factoring, Mittelstand, Finanzierung, Liquidität, Delkredere, Dienstleistung, betriebswirtschaftliche Effekte, Eigenkapitalquote, Rentabilität, Kreditrisiko, Debitorenmanagement, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diplomarbeit über Factoring im Mittelstand
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Vor- und Nachteile von Factoring für Unternehmen, insbesondere im Mittelstand. Sie analysiert die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Factoring und beleuchtet die Relevanz dieser Finanzierungsform für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Bedeutung und Herausforderungen der Finanzierung im Mittelstand; Definition und Funktionsweise von Factoring; die betriebswirtschaftlichen Effekte des Factorings (Finanzierung, Delkredere, Dienstleistung); Vorteile und Nachteile von Factoring für den Forderungsverkäufer; und die Auswirkungen auf Eigenkapitalquote und Rentabilität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung und die Ziele der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet den Mittelstand als typischen Factoring-Anwender und dessen Finanzierungsprobleme. Kapitel 3 definiert Factoring und beschreibt dessen Funktionsweise detailliert. Kapitel 4 untersucht die betriebswirtschaftlichen Effekte des Factorings und deren Bedeutung für den Forderungsverkäufer, inklusive einer Analyse der Vor- und Nachteile der einzelnen Funktionen (Finanzierung, Delkredere, Dienstleistung) und deren Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote und Rentabilität.
Was versteht man unter Factoring?
Factoring ist eine Finanzierungsform, bei der ein Unternehmen seine Forderungen an einen Factor (Finanzdienstleister) verkauft. Der Factor übernimmt das Risiko des Forderungsausfalls (Delkredere) und stellt dem Unternehmen den Rechnungsbetrag (abzüglich einer Provision) sofort oder kurzfristig zur Verfügung. Zusätzlich bietet Factoring oft Dienstleistungen im Debitorenmanagement an.
Welche Vorteile bietet Factoring für Unternehmen?
Factoring bietet Unternehmen Vorteile in Bezug auf verbesserte Liquidität, geringere Kapitalbindung, Minimierung des Ausfallrisikos (Delkredere), und Entlastung im Debitorenmanagement. Es kann die Eigenkapitalquote und Rentabilität positiv beeinflussen.
Welche Nachteile hat Factoring?
Zu den Nachteilen von Factoring gehören die anfallenden Kosten (Provisionen), der teilweise Verlust der Kundenbeziehung durch den Factor und die potenziellen Auswirkungen auf das Image beim Kunden.
Für wen ist Factoring besonders relevant?
Factoring ist besonders relevant für Unternehmen im Mittelstand, die unter Liquiditätsengpässen leiden oder ihr Debitorenmanagement optimieren möchten. Die spezifischen Finanzierungsprobleme des Mittelstandes machen Factoring zu einer potentiell geeigneten Lösung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Factoring, Mittelstand, Finanzierung, Liquidität, Delkredere, Dienstleistung, betriebswirtschaftliche Effekte, Eigenkapitalquote, Rentabilität, Kreditrisiko, Debitorenmanagement, empirische Untersuchung.
Wo finde ich empirische Daten in der Arbeit?
Die Arbeit verwendet empirische Daten und Fallbeispiele, um die betriebswirtschaftlichen Effekte von Factoring zu belegen. Diese Daten und Beispiele werden im Kapitel 4, das sich mit den betriebswirtschaftlichen Effekten des Factorings befasst, detailliert dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Betriebswirtin (VWA) Jana Stilmann (Autor:in), 2006, Factoring. Vor- und Nachteile aus Sicht des Forderungsverkäufers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69659