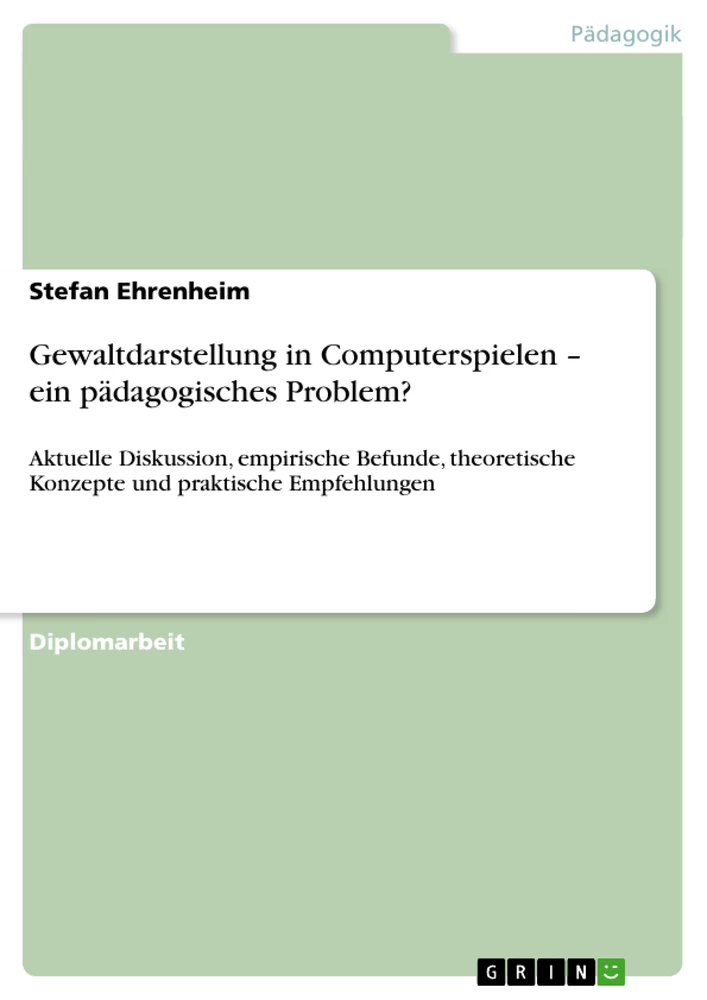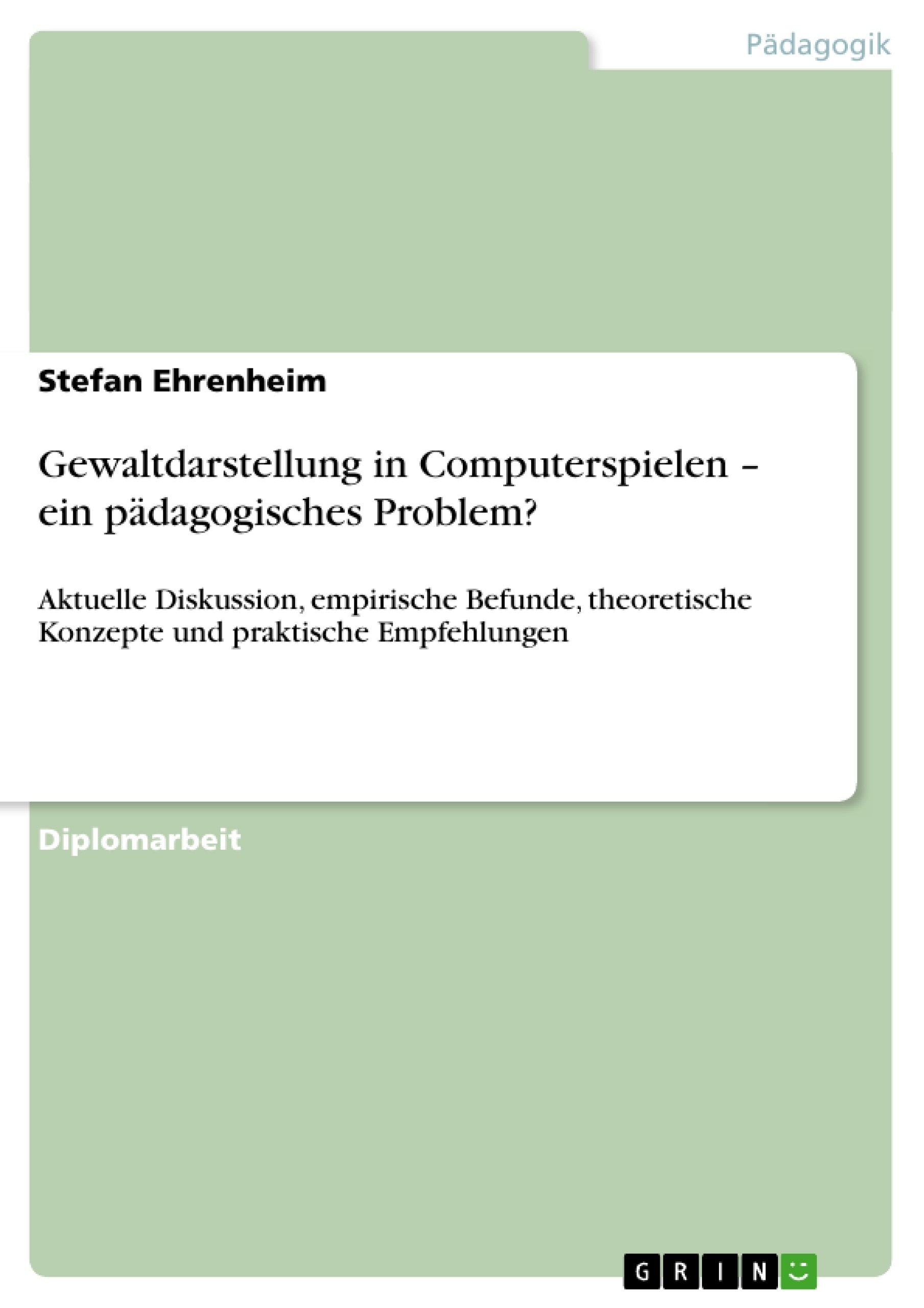Eine neue Variante der Mediengewalt wurde mit gewaltverherrlichenden Videospielen geschaffen. Gewaltdarstellungen sind gefährlich, ob im Fernsehen, im Kino, auf Videokassetten oder in Videospielen.“
(Lt. Col. Dave Grossman, ehem. Militärpsychologe, 1999).
„Es ist gelogen, dass Videospiele Kinder beeinflussen. Hätte Pac-Man das getan, würden wir heute durch dunkle Räume irren, Pillen essen und elektronische Musik hören."
(Kristian Wilson, Nintendo Inc., 1998)
Computerspiele haben eine zentrale Bedeutung im Alltagsleben der meisten Kinder und Jugendlichen. Sie sind oftmals ein essenzieller Bestandteil der Freizeitgestaltung, die oftmals sehr argwöhnisch und mit Unverständnis von der restlichen Gesellschaft betrachtet wird. Vor allem die ältere Generation, die nicht mit Pc, Playstation und Gameboy aufgewachsen ist, tut sich oftmals sehr schwer Verständnis für das Geschehen am Bildschirm aufzubringen.
Computerspiele sind schon lange kein Nischenprodukt mehr, den jährlich erscheinen weit über 2000 neue Computerspiele auf dem deutschen Markt. Alleine 2005 erwirtschaftete die Computerspielbranche einen Umsatz von mehr als 1,32 Mrd. Euro. Ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor.
Keine Frage, Computerspiele sind ein aktuelles Phänomen unserer Gesellschaft, dass allerdings mehr Kritik als Lob einstecken muss, vor allem in Deutschland. Vier Jahre nach dem Amoklauf des Schülers Robert Steinhäuser am Gutenberg Gymnasium in Erfurt, ist die Diskussion über die Wirkung von gewalthaltigen Computerspielen in Medien, Politik und wissenschaftlichen Diskurs immer noch präsent. Die oftmals anzutreffende trügerisch einfache Erklärung: Ohne einen Zugang zu gewalthaltigen Computerspielen, wäre Robert Steinhäuser niemals auf die Idee gekommen 16 Menschen das Leben zu nehmen und sich im Anschluss selber umzubringen.
2005 wurde im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung, angelehnt an den bayerischen Innenminister Günther Beckstein, ein Verbot von „Killerspielen“ gefordert, allerdings ohne zu formulieren, was man unter dem Begriff genau zu verstehen hat.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt mit der Killerspieldebatte und versucht dabei den aktuellen Forschungsstand der Medienwirkungsforschung zu berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Computerspiele
- 2.1 Definition von Computerspielen
- 2.2 Geschichte des Computerspiels
- 2.2.1 Das erste Computerspiel
- 2.2.2 Die Entwicklung der Videospiele
- 2.2.3 Die Entwicklung der Computerspiele
- 2.3 Kategorisierung von Computerspielen
- 2.3.1 Die Spielgenres im Überblick
- 2.3.2 Adventures
- 2.3.3 Rollenspiele
- 2.3.4 Sportspiele
- 2.3.5 Strategiespiele
- 2.3.6 Denk- und Puzzlespiele
- 2.3.7 Simulationen
- 2.3.8 Jump 'N' Run / Plattformspiel
- 2.3.9 Beat 'Em' Up / Prügelspiel
- 2.3.10 Ego-Shooter / First-Person-Shooter
- 2.4 Zugang und Nutzung von Computerspielen
- 3. Computerspiele - Warum sind sie so faszinierend?
- 3.1 Die vier Funktionskreise nach Fritz
- 3.1.1 Sensumotorische Synchronisierung (pragmatischer Funktionskreis)
- 3.1.2 Bedeutungsübertragung (semantischer Funktionskreis)
- 3.1.3 Regelkompetenz (syntaktischer Funktionskreis)
- 3.1.4 Selbstbezug (dynamischer Funktionskreis)
- 3.2 Spielanlässe
- 3.2.1 Langeweile
- 3.2.2 Abreaktion, Ablenken und Stressabbau
- 3.2.3 Miteinander Spielen
- 3.3 Der Uses-And-Gratifications-Approach
- 3.4 Flow
- 3.5 Funktionsmodell des Computerspiels
- 4. Computerspiele - Welche Wirkung üben sie aus?
- 4.1 Konstruktion von Wirklichkeit
- 4.1.1 Die „reale\" Welt
- 4.1.2 Die Traumwelt
- 4.1.3 Die mentale Welt
- 4.1.4 Die Spielwelt
- 4.1.5 Die mediale Welt
- 4.1.6 Die virtuelle Welt
- 4.2 Transferprozesse zwischen den Wirklichkeiten
- 4.2.1 Transfer
- 4.2.2 Die Fact-Ebene
- 4.2.3 Die Skript-Ebene
- 4.2.5 Die Print-Ebene
- 4.2.6 Die metaphorische Ebene
- 4.2.7 Die soziodynamische Ebene
- 4.2.8 Formen des Transfer
- 4.3 Strukturelle Koppelung
- 4.4 Rahmungskompetenz
- 5. Wirkung und Funktion von Gewalt in Computerspielen
- 5.1 Thesen zur Wirkung von Mediengewalt
- 5.1.2 Katharsisthese
- 5.1.2 Habitualisierungsthese
- 5.1.3 Excitation-Transfer-Theorie
- 5.1.4 Lerntheorie
- 5.1.5 Inhibitionsthese
- 5.1.5 Suggestionsthese
- 5.1.6 Kultivierungsthese
- 5.1.7 These der Wirkungslosigkeit
- 5.2 Funktion von Gewalt in Computerspielen
- 5.2.1 Virtuelle Gewalt vs. reale Gewalt
- 5.2.2 Bekämpfung von Langeweile
- 5.2.3 Macht, Herrschaft und Kontrolle durch Gewalt
- 5.2.4 Virtuelle Gewalt & Strukturelle Koppelung
- 5.2.5 Ablehnung von Gewalt im Alltag
- 5.2.6 Die Bedeutung von Empathie in der virtuellen Welt
- 5.3 Schlussfolgerungen
- 6. Schutz vor problematischen Inhalten
- 6.1 Jugendmedienschutz
- 6.2 Institutionen des Jugendmedienschutzes
- 6.2.1 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
- 6.2.2 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle
- 6.2.3 Kommission für Jugendmedienschutz
- 6.2.4 Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter
- 6.3 Jugendmedienschutz durch Medienkompetenz
- 6.4 Die Killerspiel-Debatte
- 6.5 Umgang mit virtueller Gewalt im Ausland
- 6.6 Schlussfolgerung
- 7. Pädagogische Konzepte
- 7.1 Edutainment
- 7.1.1 Teachtainment
- 7.1.2 Infotainment
- 7.1.2 Tooltainment
- 7.1.3 1st Edutainment eine Alternative?
- 7.2 Das Hardliner-Konzept
- 7.2.1 Hauptthesen
- 7.2.2 Praktische Umsetzung
- 7.2.3 Zielsetzung
- 7.3 Kompetenzsteigerung durch Computerspiele
- 7.3.1 Problemlösungsfähigkeit
- 7.3.2 Räumliche Vorstellungskraft
- 7.3.3 Auge- und Handkoordination
- 7.3.4 Soziale Kompetenz
- 8. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Gewaltdarstellung in Computerspielen und untersucht deren pädagogische Relevanz. Ziel ist es, die aktuelle Diskussion um die Wirkung von Computerspielen zu beleuchten, empirische Befunde zu analysieren, theoretische Konzepte zu diskutieren und praktische Empfehlungen für den Umgang mit Computerspielen zu entwickeln.
- Definition und Geschichte von Computerspielen
- Faszination von Computerspielen und deren Funktionsweise
- Wirkung von Computerspielen auf die Konstruktion von Wirklichkeit
- Funktion und Wirkung von Gewalt in Computerspielen
- Schutz vor problematischen Inhalten in Computerspielen und pädagogische Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gewaltdarstellung in Computerspielen ein und stellt die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft heraus. Kapitel 2 definiert Computerspiele, beleuchtet deren Geschichte und kategorisiert verschiedene Spielgenres. Kapitel 3 widmet sich der Frage, warum Computerspiele so faszinierend sind und analysiert die Funktionsweise von Computerspielen unter Einbezug verschiedener theoretischer Konzepte. Kapitel 4 befasst sich mit der Konstruktion von Wirklichkeit im Kontext von Computerspielen und untersucht Transferprozesse zwischen der realen und der virtuellen Welt. Kapitel 5 analysiert die Wirkung und Funktion von Gewalt in Computerspielen und beleuchtet verschiedene Thesen zur Wirkung von Mediengewalt. Kapitel 6 untersucht verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor problematischen Inhalten in Computerspielen, darunter Jugendmedienschutz und Medienkompetenz. Kapitel 7 diskutiert verschiedene pädagogische Konzepte im Umgang mit Computerspielen, darunter Edutainment und Hardliner-Konzepte.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Gewaltdarstellung, Mediengewalt, Pädagogik, Jugendmedienschutz, Edutainment, Hardliner-Konzept, Wirkung, Funktion, Transfer, Strukturelle Koppelung, Rahmungskompetenz.
- Arbeit zitieren
- Diplom Pädagoge Stefan Ehrenheim (Autor:in), 2006, Gewaltdarstellung in Computerspielen – ein pädagogisches Problem?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69681