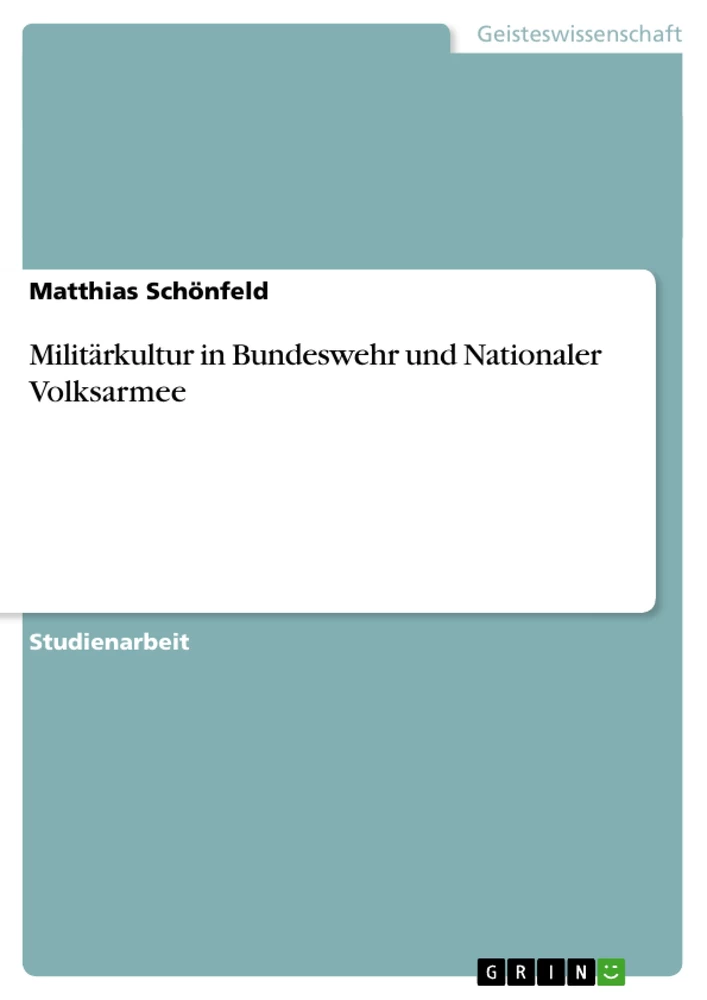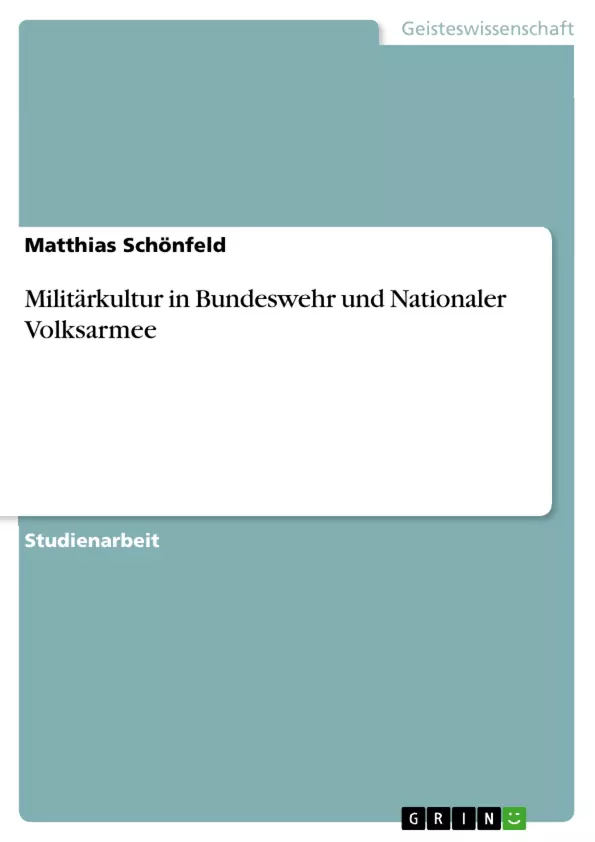Nur selten ergibt sich die Gelegenheit, das Entstehen zweier Armeen mit denselben historischen Belastungen zu untersuchen. Und noch seltener stellt sich die Frage, ob die beiden Armeen wieder zu einer Streitkraft zusammengeführt werden können. Die Entstehung der beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg hatte auch die Gründung zweier deutscher Streitkräfte zur Folge. Die Ausgangssituationen in den beiden deutschen Staaten waren zwar weit davon entfernt, große Ähnlichkeiten aufzuweisen, aber dennoch finden sich trotz der großen, systemimmanenten Unterschiede auch Gemeinsamkeiten.
Nachdem der Ostblock nach und nach in sich zusammenbrach und die Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten sich abzeichnete, wurde damit auch die Frage aufgeworfen, inwiefern die beiden Streitkräfte sich in eine einzige überführen ließen. Damit rückten die Unterschiede in den Hintergrund und es wurde vermehrt nach Gemeinsamkeiten gesucht. Eine mögliche Herangehensweise an dieses Problem ist die Suche nach Schnittpunkten zwischen den jeweiligen Organisationskulturen. An dieser Stelle setzt die Arbeit an. Allerdings soll es hier nicht um die empirische Auseinandersetzung mit dem Vereinigungsprozess der beiden Streitkräfte gehen, vielmehr stellt es den Versuch dar, aus den historischen und soziologischen Bedingungen heraus theoretisch zu erarbeiten, welche Probleme zu erwarten waren.
Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die Entstehungsbedingungen verschiedene Typen von Streitkräften entwickelt haben und dass gerade diese Unterschiede Auswirkungen auf eine Zusammenlegung der beiden Armeen haben müssten. Deshalb wird nach ein paar Vorbemerkungen zur Organisationskultur im Allgemeinen zuerst die Entstehung der Streitkräfte untersucht. Im Anschluss werden zwei Bereiche exemplarisch untersucht. Dabei wurden aus nahe liegenden Gründen die Vergangenheitsbewältigung und das Selbstverständnis in Verbindung mit der Lebensrealität gewählt. Beide Punkte sollten die Ausgestaltung der Organisationskultur entscheidend beeinflussen, da sowohl das Leben mit oder ohne eine eigene Geschichte als auch ein Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine entscheidende Variable bei der Entwicklung einer Organisationskultur spielen muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltlich methodische Vorüberlegung
- 1. Zum Begriff der Organisationskultur
- a. Allgemeine Vorbemerkung zur Organisationskultur
- b. Militärische Organisationskultur
- 2. Aufbau der Streitkraft
- a. Von der Kasernierten Volkspolizei zur NVA
- b. Die Bundeswehr und das Ringen um die Souveränität
- 3. Vergangenheit und neue Tradition
- a. Der sozialistische Soldat neuen Typs
- b. Selektive Tradition und Innere Führung
- 4. Selbstverständnis und Realität
- a. in der Nationalen Volksarmee
- b. in der Bundeswehr
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Unterschiede in der Organisationskultur der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee (NVA). Der Fokus liegt auf der Entstehungsgeschichte beider Armeen und deren Einfluss auf die spätere Organisationskultur. Es wird analysiert, wie die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, der Umgang mit der Vergangenheit und die offizielle politische Doktrin die jeweiligen Organisationskulturen prägten.
- Vergleich der Organisationskulturen der Bundeswehr und der NVA
- Einfluss der Entstehungsgeschichte beider Armeen auf ihre jeweilige Organisationskultur
- Rolle der Vergangenheitsbewältigung in der Gestaltung der Organisationskultur
- Unterschiede im Selbstverständnis und in der Realität beider Armeen
- Theoretischer Einfluss der Organisationskultur auf den Zusammenschluss der beiden Armeen nach der Wiedervereinigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: einen Vergleich der Organisationskulturen der Bundeswehr und der NVA unter Berücksichtigung ihrer Entstehungsgeschichte und des Einflusses der politischen Rahmenbedingungen. Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum von 1949 bis 1990 und schließt die Zusammenführung der beiden Armeen nach der Wiedervereinigung explizit aus. Der methodische Ansatz wird skizziert, der die separate Betrachtung beider Streitkräfte in verschiedenen Aspekten vorsieht.
1. Zum Begriff der Organisationskultur: Dieses Kapitel beginnt mit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff der Organisationskultur im Allgemeinen und spezifiziert anschließend die Besonderheiten militärischer Organisationskulturen. Es wird zwischen „Organisationskultur“ als Steuerungsinstrument der Führung und „Kultur der Organisation“ als von den Mitgliedern gelebte Kultur unterschieden, wobei letztere sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann.
2. Aufbau der Streitkraft: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Bedingungen der Entstehung der NVA und der Bundeswehr. Es wird der Weg der NVA von der Kasernierten Volkspolizei bis zur staatstragenden Armee der DDR nachgezeichnet und die Herausbildung der Bundeswehr im Kontext des Ringens um die deutsche Souveränität im Nachkriegsdeutschland untersucht. Die internationalen Rahmenbedingungen des Kalten Krieges werden als maßgeblicher Einflussfaktor hervorgehoben.
3. Vergangenheit und neue Tradition: Hier wird der Umgang mit der Vergangenheit in beiden Armeen verglichen. Die unterschiedlichen Konzepte des „sozialistischen Soldaten neuen Typs“ in der NVA und die „selektive Tradition“ sowie die „Innere Führung“ in der Bundeswehr werden analysiert. Es wird gezeigt, wie der Umgang mit der Geschichte die jeweilige innere Ordnung und das Selbstverständnis beeinflusste. Die politische Doktrin beider Staaten und ihr Einfluss auf die jeweiligen Armeen wird ebenfalls beleuchtet.
4. Selbstverständnis und Realität: Das Kapitel untersucht die Unterschiede zwischen dem Selbstverständnis und der Realität in der NVA und der Bundeswehr. Es analysiert, wie sich die jeweils propagierte Vorstellung von der Armee von der tatsächlichen Erfahrung der Soldaten unterschied. Dieses Kapitel betont die Wichtigkeit der offiziellen Doktrin und ihrer Wirkung auf die innere Ordnung der Streitkräfte.
Schlüsselwörter
Organisationskultur, Militärsoziologie, Bundeswehr, Nationale Volksarmee (NVA), Kalter Krieg, Entstehungsgeschichte, Vergangenheitsbewältigung, Innere Führung, Selbstverständnis, Realität, Systemkonkurrenz, Wiedervereinigung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Organisationskultur der Bundeswehr und der NVA
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht und vergleicht die Organisationskulturen der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR. Der Fokus liegt auf den Unterschieden beider Armeen, beeinflusst durch ihre Entstehungsgeschichte, den Umgang mit der Vergangenheit und die jeweilige politische Doktrin. Der Zeitraum umfasst die Jahre 1949 bis 1990, wobei die Zusammenführung nach der Wiedervereinigung explizit ausgeschlossen wird.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Vergleich der Organisationskulturen, den Einfluss der Entstehungsgeschichte beider Armeen, die Rolle der Vergangenheitsbewältigung, Unterschiede im Selbstverständnis und der Realität, sowie den theoretischen Einfluss der Organisationskultur auf den Zusammenschluss nach der Wiedervereinigung (allerdings nur theoretisch, nicht empirisch untersucht).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und ein Resümee. Kapitel 1 definiert den Begriff der Organisationskultur im Allgemeinen und im militärischen Kontext. Kapitel 2 beschreibt den Aufbau der Streitkräfte, die Entstehung der NVA und der Bundeswehr unter den Bedingungen des Kalten Krieges. Kapitel 3 analysiert den Umgang mit der Vergangenheit und die Entwicklung von Traditionen in beiden Armeen. Kapitel 4 untersucht das Selbstverständnis und die Realität in beiden Organisationen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der die Bundeswehr und die NVA separat in verschiedenen Aspekten betrachtet, um die Unterschiede in ihren Organisationskulturen aufzuzeigen. Der methodische Ansatz ist in der Einleitung skizziert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Zu den zentralen Begriffen gehören: Organisationskultur, Militärsoziologie, Bundeswehr, Nationale Volksarmee (NVA), Kalter Krieg, Entstehungsgeschichte, Vergangenheitsbewältigung, Innere Führung, Selbstverständnis, Realität, Systemkonkurrenz und Wiedervereinigung.
Was ist das Ergebnis der Analyse im Kapitel zu „Vergangenheit und neue Tradition“?
Dieses Kapitel vergleicht den Umgang beider Armeen mit ihrer Vergangenheit. Es analysiert Konzepte wie den „sozialistischen Soldaten neuen Typs“ (NVA) und die „selektive Tradition“ sowie die „Innere Führung“ (Bundeswehr), um aufzuzeigen, wie der Umgang mit der Geschichte die jeweilige innere Ordnung und das Selbstverständnis beeinflusste. Der Einfluss der politischen Doktrin beider Staaten auf die jeweiligen Armeen wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird der Begriff „Organisationskultur“ definiert?
Kapitel 1 unterscheidet zwischen „Organisationskultur“ als Steuerungsinstrument der Führung und „Kultur der Organisation“ als von den Mitgliedern gelebte Kultur. Letztere kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben.
Welche Rolle spielt der Kalte Krieg in der Analyse?
Der Kalte Krieg wird als maßgeblicher Einflussfaktor auf die Entstehung und Entwicklung beider Armeen hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Matthias Schönfeld (Author), 2006, Militärkultur in Bundeswehr und Nationaler Volksarmee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69706