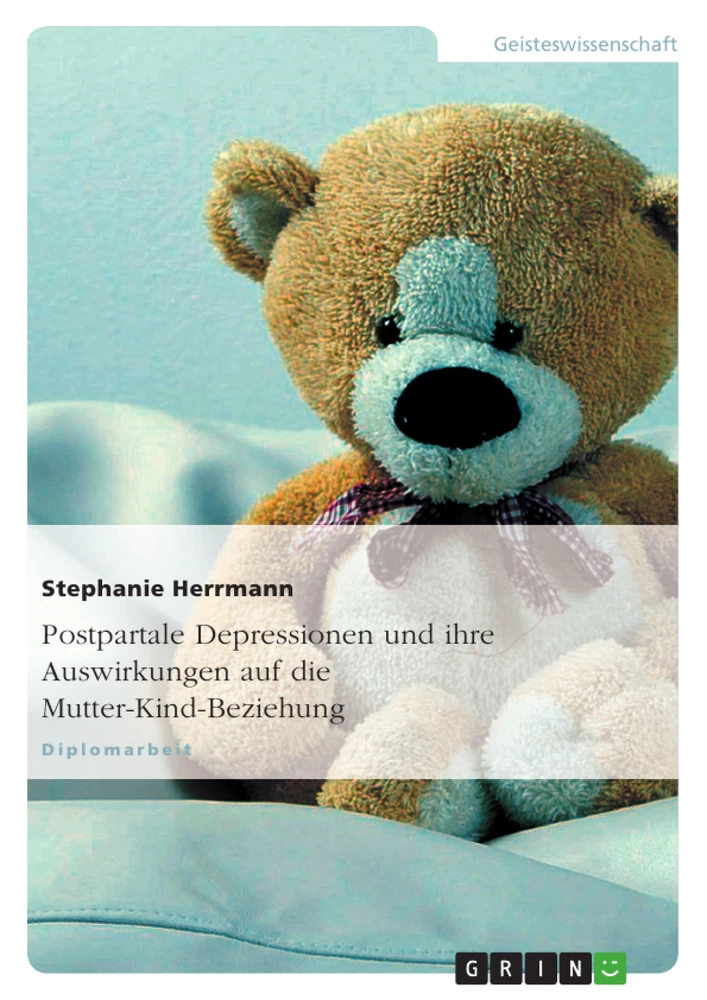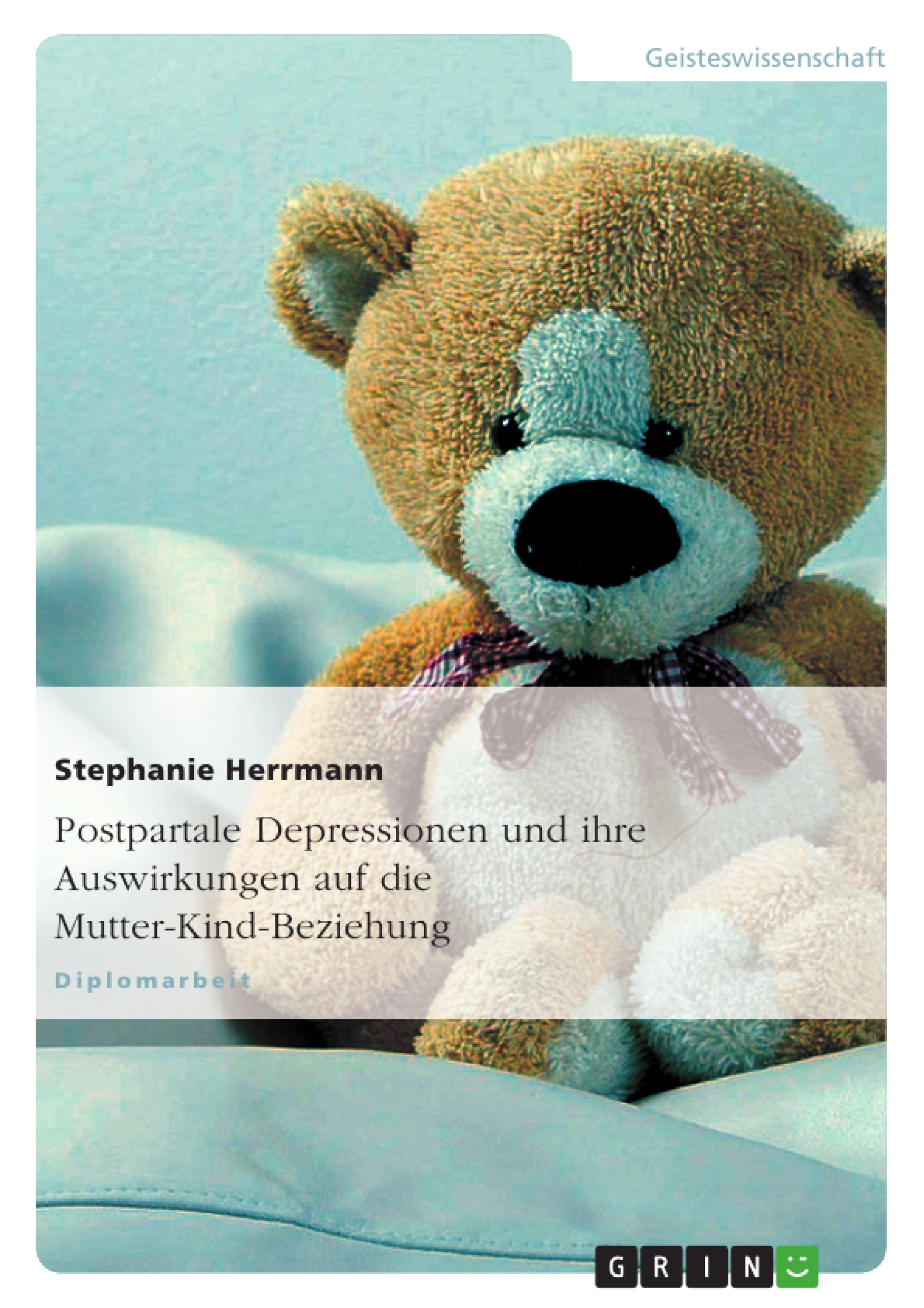Postpartale psychische Erkrankungen fallen in einen Lebensabschnitt, der im Allgemeinen als glückliches Ereignis betrachtet wird. Gefühle der Traurigkeit lassen sich mit der Geburt eines Kindes nur schwer vereinen. In unserer Gesellschaft herrscht diesbezüglich ein Mythos vor, der den noch unerfahrenen Müttern suggeriert, dass sie in dieser Phase so glücklich sein müssen wie noch nie in ihrem Leben. Diese Annahme erweist sich in der Realität oftmals als Trugschluss.
Mit einer Auftrittswahrscheinlichkeit von bis zu 70 Prozent sind depressive Störungen im Wochenbett keine Seltenheit, sondern sie zählen zu den häufigsten postpartalen Komplikationen, die ersichtlich werden. Dieser Umstand lässt sich vor allem auf die zahlreichen biologischen und psychosozialen Veränderungsprozesse zurückführen, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen.
Es ist somit durchaus nachvollziehbar, dass Frauen in dieser Schwellensituation zur Mutterschaft eine erhöhte psychische Vulnerabilität ausgebildet haben, die den Ausbruch einer postpartalen Erkrankung begünstigen kann. Das Störungsbild, was sich diesbezüglich verzeichnen lässt, ist sehr umfassend und weit ausdifferenziert. Die drei klassischen postpartalen Krankheitsformen umfassen den Baby-Blues, die Wochenbettdepression und die Wochenbettpsychose.
Postpartale Erkrankungen fallen in einen Zeitraum, indem Säuglinge fundamental auf die Bedürfnisbefriedigung ihrer primären Bezugsperson, die in der Regel durch die Mutter verkörpert wird, angewiesen sind. Vor allem in den ersten Lebensmonaten ist die psychische Entwicklung eines Kindes noch extrem störungsanfällig, weshalb man eine Erkrankung post partum, als erhöhtes Risiko einstuft.
Angesichts der zahlreichen Belastungsfaktoren, die mit einer mütterlichen Depression einhergehen, ist eine schnelle, präventive Hilfe unabdingbar, um eine Beziehungsstörung zwischen Mutter und Säugling zu vermeiden.
Das Problem was sich diesbezüglich ergibt ist, dass viele Frauen nur geringe Informationen über dieses Krankheitsbild erhalten, weshalb die damit einhergehende Symptomatik oftmals übersehen wird und somit eine Chronifizierung nach sich zieht. Durch diese Arbeit möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, den Blick für postpartale Depressionen zu öffnen. Die Tabuisierung der Erkrankung und die damit einhergehenden Schuldgefühle, die von vielen Müttern ausgebildet werden, sind ein gesellschaftlich bedingtes Problem, dem nur durch Aufklärung entgegengewirkt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Begriffsbestimmung
- 2.1 Depressionen
- 2.2 Pränatal und postpartal/postnatal
- 2.3 Depressionen in der Postpartalzeit
- 3. Biologische und psychosoziale Veränderungsprozesse durch den Übergang zur Mutterschaft
- 3.1 Biologische Faktoren
- 3.1.1 Körperliche Veränderungen
- 3.1.2 Hormonelle Umstellungen
- 3.2 Psychische und soziale Faktoren
- 3.2.1 Neufindung in die Rolle als Mutter
- 3.2.2 Partnerschaft und soziale Unterstützung
- 3.2.3 Beziehung zur eigenen Mutter
- 3.2.4 Verlusterfahrungen
- 4. Postpartale depressive Erkrankungen
- 4.1 Klassifikation
- 4.2 Postpartale Dysphorie
- 4.3 Postpartale Depression
- 4.4 Postpartale Psychose
- 5. Die Bindungstheorie
- 5.1 Entwicklungsverlauf von Bindung
- 5.2 Exploration und sichere Basis
- 5.3 Das innere Arbeitsmodell
- 5.4 Konzept der Feinfühligkeit
- 5.5 Konzept der kindlichen Bindungsqualität „Fremde Situation“
- 5.6 Adult-Attachment-Interview (AAI)
- 5.7 Langfristige Effekte früher Bindungsmuster
- 6. Die frühkindliche Interaktion zwischen Mutter und Kind
- 6.1 Fantasien über das imaginäre Kind
- 6.2 Spracherwerb und kognitive Entwicklung
- 7. Postpartale Depressionen und ihre Folgen für die Kinder
- 7.1 Psychische Erkrankungen als Familienerkrankungen
- 7.2 Die Lebenssituation betroffener Kinder
- 7.3 Auswirkungen von postpartalen Erkrankungen auf die Kinder
- 7.3.1 Regulationsstörungen in der frühen Kindheit
- 7.3.1.1 Folgen des exzessiven Schreiens
- 7.3.2 Störung der Mutter-Kind-Interaktion
- 7.3.2.1 Still-face-Situation
- 7.3.3 Deprivationsverhalten
- 7.4 Schutzfaktoren für die psychische Entwicklung
- 8. Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten
- 8.1 Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit
- 8.2 Psychoanalyse im sozialen Feld
- 8.3 Gesetzliche Grundlagen
- 8.4 Kooperation Jugendhilfe und Psychiatrie
- 8.5 Präventive Hilfsangebote
- 8.5.1 Geburtsvorbereitungskurse
- 8.5.2 Edinburgh Postnatal Depression Scala (EPDS)
- 8.5.3 Schreibaby-Ambulanz
- 8.6 Interventionsangebote für Mütter und ihre Kinder
- 8.6.1 Feinfühligkeitstraining
- 8.6.2 Modellprojekt ,,Patenschaften“
- 8.6.3 Kindergruppenprojekt AURYN
- 8.6.4 Säuglings-Mutter-Psychotherapie
- 8.6.5 Stationäre Mutter-Kind-Behandlung
- 9. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht postpartale Depressionen und ihre Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung. Sie beleuchtet die biologischen und psychosozialen Veränderungen im Übergang zur Mutterschaft sowie die Klassifikation und Folgen von postpartalen depressiven Erkrankungen. Die Arbeit betrachtet die Bindungstheorie und die frühkindliche Interaktion zwischen Mutter und Kind im Kontext von postpartalen Depressionen. Sie analysiert zudem die Folgen für die Kinder und bietet einen Überblick über Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten.
- Postpartale Depressionen und ihre Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung
- Biologische und psychosoziale Veränderungen im Übergang zur Mutterschaft
- Bindungstheorie und frühkindliche Interaktion
- Folgen von postpartalen Erkrankungen für die Kinder
- Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema postpartale Depressionen ein und beschreibt die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 definiert grundlegende Begriffe wie Depression, Pränatal und Postpartal sowie Depressionen in der Postpartalzeit. Kapitel 3 beleuchtet die biologischen und psychosozialen Veränderungen im Übergang zur Mutterschaft, einschließlich hormoneller Umstellungen, der Neufindung in die Rolle als Mutter und der Bedeutung von sozialer Unterstützung. Kapitel 4 konzentriert sich auf postpartale depressive Erkrankungen, ihre Klassifikation und die verschiedenen Formen, wie postpartale Dysphorie, Depression und Psychose. Kapitel 5 präsentiert die Bindungstheorie, ihren Entwicklungsverlauf und das Konzept der Feinfühligkeit. Es werden die verschiedenen Bindungsqualitäten und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung beleuchtet. Kapitel 6 widmet sich der frühkindlichen Interaktion zwischen Mutter und Kind und der Bedeutung der fantasievollen Interaktion für die Entwicklung. Kapitel 7 untersucht die Folgen von postpartalen Depressionen für die Kinder, einschließlich Regulationsstörungen, Störungen der Mutter-Kind-Interaktion und Deprivationsverhalten. Kapitel 8 stellt verschiedene Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten vor, darunter Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit, Psychoanalyse im sozialen Feld, gesetzliche Grundlagen und präventive Hilfsangebote.
Schlüsselwörter
Postpartale Depression, Mutter-Kind-Beziehung, Bindungstheorie, Feinfühligkeit, Regulationsstörungen, Deprivationsverhalten, Interventionsmöglichkeiten, Ressourcenorientierung, Psychoanalyse, Prävention.
- Arbeit zitieren
- Diplom- Sozialpädagogin Stephanie Herrmann (Autor:in), 2006, Postpartale Depressionen und ihre Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69725